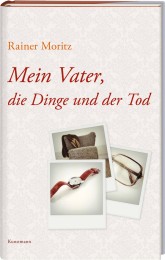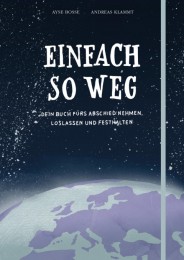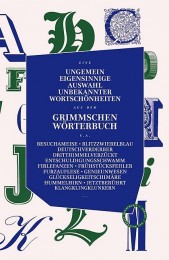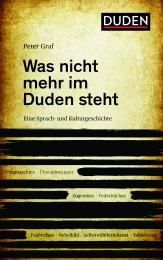Gegengift in Buchform – einige Empfehlungen
Kurzkritiken von Borgward Hobermann, Alf Mayer und Thomas Wörtche zu:
Volker Angres, Claus-Peter Hutter: Das Verstummen der Natur
Sue Black: Alles was bleibt
Ayse Bosse, Andreas Klammt: Einfach so weg
Christiane Collorio, Michael Krüger (Hg.): The Poet’s Collection
Peter Graf: Was nicht mehr im Duden steht & Ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch
Ursula Heinzelmann: Vom Käsemachen
Justinian Jampol (Hg.): Das DDR-Handbuch
Rem Koolhaas: Elements of Architecture
Rainer Moritz: Mein Vater, die Dinge und der Tod
Rudi Palla: Verschwundene Arbeit
Wolfger Pöhlmann: Es geht um die Wurst
Roland Schulz: So sterben wir
Slow Food Deutschland (Hg.): Slow Food Genussführer Deutschland 2019/20
Ina Katharina Uphoff, Nicola von Velsen: Schaubilder und Schulkarten
Giorgio van Straten: Das Buch der verlorenen Bücher
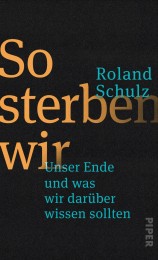 Die Wahrheit macht frei
Die Wahrheit macht frei
(AM) Sterben, Schritt für Schritt? Und aus vielen Perspektiven? So etwas wie dieses Buch hat es noch nicht gegeben. Autor Roland Schulz, ein ausgewiesen unerschrockener Reporter, fand in der Literatur nicht viel Anhalt dafür, viel Skepsis erst einmal auch bei den Spezialisten, die er befragte. „Sterben folgt keinem Fahrplan sagten sie.“ Sterben sei dynamisch, sei komplex. Sterben sei Teil des Lebens. Der Tod, das sei danach. Sie wollten ihn mit Studien abwimmeln, mit Aufsätzen und Statistiken, dann brachte er sie doch zum Reden: alte und junge Ärzte, Palliativmediziner, Hospizpersonal, Pfleger und Bestatter – sie alle erfahren in tausenden Toden. Sie redeten mit ihm, weil sie eine Erfahrung aus ihrer Arbeit mit Sterbenden eint: „Schmerzlicher als Sprechen ist Schweigen.“
Roland Schulz bricht das Schweigen über das Sterben, er zeigt, So sterben wir, er bricht durch die Angst, die jeder von uns auf eigene Weise vor diesem Thema und dieser Sache und diesem Ende hat. Im Sterben stoßen der Verstand, das Denken, die Gefühle und die Vernunft an ihre Grenzen.
Roland Schulz – große Achtung davor – macht das alles ohne Sensationalismus, ohne Geisterbahneffekte, weder trägt er dick auf noch verharmlost er. Sprache und Duktus sind angenehm und präzise, ohne allzu leisezutreten. Er nennt die Dinge beim Namen, nimmt uns Leser mit, hautnah sozusagen. Zeitlupe, Nahaufnahme, alles klar und deutlich. Und tatsächlich stellt sich immer wieder der Effekt ein: Wissen kann befreien. Rücksichtnahme, falsche und echte und feige, bringt hier nichts. In der Medizin gibt einen schönen Begriff für diese Strategie: barmherzige Lügen. Aber solche Lügen bringen nichts, all die Ausweichmanöver sind nutzlos: Aussitzen, Weglaufen, Schönreden. Sie funktionieren nicht. Nicht beim Sterben.
„Und Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird Euch frei machen“ (Joh. 8,32) taugt nicht nur als Inschrift in der Eingangshalle des CIA-Hauptquartiers in Langley – warum eigentlich dort? -, dieser Wahlspruch gilt erst Recht fürs Sterben. Roland Schulz unterteilt es in drei große Kapitel: Sterben. Tod. Trauer. Zu jedem hat er Wichtiges und Wahres zu sagen. Dann gibt es noch drei Seiten Hinweise auf weiterführende Literatur. Ein großes, hervorragend recherchiertes und sinnstiftendes Buch. Anschauungsmaterial auch dafür, wozu Qualitätsjournalismus in der Lage ist.
Roland Schulz: So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Piper Verlag, München 2018. Hardcover, 240 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen.
 Feuer, Zensur, Diebstahl, Krieg oder die Erben
Feuer, Zensur, Diebstahl, Krieg oder die Erben
(AM) Ein persönliches Erlebnis, ein Trauma, gab Giorgio van Straten, Leiter des Italienischen Kulturinstituts in New York, den Anstoß zu der kleinen Kostbarkeit Das Buch der verlorenen Bücher, die bibliophil mit Hardcover, Schutzumschlag und Lesebändchen daherkommt. Er hatte als einer der ganz wenigen einmal ein Buchmanuskript von Romano Bilenchi gelesen, „Il viale“(Die Allee) hatte sich an die Anweisung gehalten, es nicht zu fotokopieren – um dann später zu erfahren, dass die Witwe des Autors es vernichtet habe. Welch ein Verlust! Ein Trauma, wie gesagt.
Giorgio van Straten bewältigt es, indem er auch die Schicksale anderer verlorener Bücher nachzeichnet. Verlorene Bücher sind keine vergessenen Werke, sondern solche, die tatsächlich existiert haben, die es aber nicht mehr gibt. Es sind Bücher, die jemand gesehen, womöglich auch gelesen hat, und die dann zerstört wurden oder von denen man nie wieder etwas gehört hat. Sie können der Unzufriedenheit des Autors zum Opfer gefallen sein – ich habe einen Freund, der einmal ein Roman-Manuskript verbrannt hat -, dem Krieg, der Zensur, einem Unglück, einem Diebstahl, einem Brand, einer Schlamperei oder, fast am schlimmsten, den Erben.
Acht solcher Fälle versammelt die Recherche. Da ist Sylvia Plath mit einem unvollendeten Buch und ein Ehepartner, der für sie entscheidet, das sind Walter Benjamin und Bruno Schulz, deren letzte Bücher im Krieg verschwinden, da ist die abgebrannte Hütte von Malcolm Lowry, da sind die Zensurinstanzen für Lord Byron, da wird Ernest Hemingway eine Reisetasche gestohlen und da ist der mit sich chronisch unzufriedene Nikolai Gogol.
Van Straten tröstet sich und uns mit einem Zitat von Anne Michaels: „Es gibt keine Abwesenheit, solange auch nur die Erinnerung an die Abwesenheit bleibt. Erinnerung stirbt, wenn man ihr keinen Sinn verleiht. […] Wenn man kein Land mehr hat, aber die Erinnerung an das Land besitzt, dann kann man eine Karte zeichnen…“
Giorgio van Straten: Das Buch der verlorenen Bücher – Acht Meisterwerke und die Geschichte ihres Verschwindens (Storie di libri perduti, 2016).. Aus dem Italienischen von Barbara Kleine. Insel Verlag, Berlin 2017. Hardcover, Lesebändchen, 168 Seiten. Verlagsinformationen.
 So viel DDR war lange nicht
So viel DDR war lange nicht
Soviel DDR auf solch kompaktem Platz, das ist nicht nur für Ostaliker interessant, die den Verlust des Arbeiter- und Bauernstaates beklagen. Das handschmiegsame DDR Handbuch mit Flexibindung versammelt mehr auf über 800 Seiten mehr als 2.000 Gegenstände aus dem Wendemuseum von Los Angeles. 13 Jahre nach dem Fall der Mauer in Culver City, Kalifornien, gegründet, ist dies eine der weltweit größten Sammlungen mit Artefakten aus der DDR. Die kluge Auswahl bietet den bislang umfassendsten Überblick über die visuelle und materielle Kultur der DDR: Designobjekte und Alltagsgegenstände, Propaganda und Werbung, Mode und Privates, Staatstragendes und Dissidentes, Skurriles und Tragisches – all das zu einem Spottpreis angesichts von Umfang und Qualität. (Es handelt sich um die Volksausgabe einer XL-Version von 2014, nur ein international so gut aufgestellter Verlag wie Benedikt Taschen kann solche Projekte und solche Preise stemmen.)
Was wir sehen ist luxuriös und gewöhnlich, hässlich und schön, handgefertigt und maschinell produziert, ist persönlich und offiziell, ist Alltag und Besonderheit. Alles rund um den Lebensmitteleinkauf, Kochbücher, Rezepthefte, Speisekarten, Brigadebücher, Kataloge, Broschüren, Formulare, Werbung, Bierdeckel, Getränkeetiketten, Zigarettenschachteln. Möbelkataloge, Kondomaten, Aufklärungsbroschüren, Nierentische, Leuchten, Stühle. Toilettenartikel, Seifen, Haushaltswaren, Geschirr, Waschmittel, Plaste und Elaste, Spielzeug, das Sandmännchen, Modellbaukästen, Renate Müllers Stofftiere, Kunsthandwerk, Kleidung, Textilien, Radios, Robotron-Computer, 33 Seiten über Schallplatten, Theater-, Kino- und Konzertplakate, die Zeitschrift „Das Magazin“, die DEFA, zwölf Seiten über den Palast der Republik, Erotika, Lotto, Camping, umfangreich der Sport, Verkehrsmittel, Autos, Landwirtschaft, Produktion und Bergbau, die Leipziger Messe, Parteitage, Paraden und Festivals, Gedenkteller, Büsten und Denkmäler, Junge Pioniere, die FDJ, Zivilverteidigung und Volksarmee, Vopos, die Mauer, Checkpoint Charlie, Übungsblätter zum Erkennen von Gesichts- und Körpermerkmalen und ein eigenes Kapitel zum Verhältnis der DDR zu Amerika.
Justinian Jampol (Hg.): Das DDR-Handbuch. Die DDR-Sammlung des Wendemuseums (Neuausgabe von Beyond the Wall, 2014). Verlag Benedikt Taschen, Köln 2017. Flexicover, in Leinen gebunden, mit Leseband. Format 16,5 x 24 cm, mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch. 816 Seiten, 29,99 Euro. Verlagsinformationen.
 Kunsthandwerk, zum Reinbeissen
Kunsthandwerk, zum Reinbeissen
(AM) Dieses Buch ist gut gereift. Gereift wie guter Käse. Ursula Heinzelmann erzählt darin Vom Käsemachen, erzählt von Tradition, Handwerk und Genuss, also von all dem, was die industrielle Lebensmittelproduktion nicht oder nur nachgeahmt kann, was vom Verlust bedroht ist. Oft genug in diesem Buch sind es einzelne Personen, die da für etwas stehen, die eine Tradition erhalten, die einen Käse herstellen, wie es ihn eben nicht in jedem Supermarktregal und als Schnäppchen gibt.
Käse, das ist ein eigener Kontinent. Ursula Heinzelmann – gelernte Köchin, Sommelière und Gastronomin, Journalistin und Autorin mit Schwerpunkt Kulinarik und Wein – hat ihn bereist. Vom Allgäu bis Anatolien, vom Bregenzerwald nach Sizilien, von Irland und Norwegen bis Kalifornien. 2002 war sie auf ihrer ersten Käse-Recherchereise in Sonoma Country. Das mit Käse-Porträtfotos von Manuel Krug ausgestattete Buch ist die Summe vieler Recherchen und Journalistinnenjahre, liegt satt und fett und schön in der Hand, lässt sich gut lesen. 15 Kapitel mit Geschichten von Menschen, Tieren, Landschaften führen rund um die Welt, überall war die Autorin vor Ort, hat sich fachkundig mit den Käserinnen und Käsern unterhalten, ergänzt das immer wieder mit Hintergrund und Historie, ist eine sehr unterhaltsame Reiseführerin. Langweilig wird es in diesem Buch nicht
Käse, lernen wir ganz schnell, ist Kunsthandwerk. Schon deshalb vom Verlust bedroht. Jetzt aber auf zum Markt, an den Käsestand… Oder in Berlin in die Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg, wo Ursula Heinzelmann einmal im Monat an einem Freitag um 18h an dem langen Tisch gegenüber vom Suff-Weinstand zum „HeinzelCheese Talk“ lädt, spannende Käse mitbringt und ein paar spezielle Flaschen Wein öffnet. Die Runde ist exklusiv, aber offen, Teilnehmerzahl 16, Anmeldung per Email. Letztes Mal ging es um Stilton in all seinen originalen und verwandten Formen und Portwein.
Ursula Heinzelmann: Vom Käsemachen – Tradition, Handwerk und Genuss. Mit Fotos von Manuel Krug. Insel Verlag, Berlin 2018. Hardcover, 236 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen. Ursula Heinzelmanns Blog Heinzelcheese.
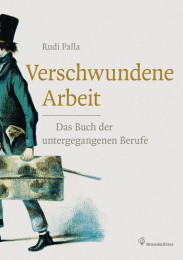 Von Drahtziehern und Lustfeuerwerkern
Von Drahtziehern und Lustfeuerwerkern
(AM) Manche unserer Großväter oder Urgroßväter haben ihr Leben lang einen Beruf ausgeübt, von dem man heute kaum noch weiß. Wie viel an hochspezialisiertem Wissen, an qualitätsvoller Produktion, an Wert und Sinn ist uns hier verloren gegangen? Ein beträchtlicher Teil deutscher Familiennamen leitet sich von Berufsbezeichnungen, Tätigkeiten, Werkzeugen, von Erzeugnissen und Handelswaren ab, ja auch von Arbeitsgeräuschen und Begleiterscheinungen. Schauen Sie Ihr persönliches Freundes- und Adressbuch einmal nach diesem Ordnungsprinzip durch.
„Alle Arten von Arbeit, sein Brot zu verdienen, sind einem ehrlichen Mann gleich anständig, Holz zu spalten oder am Ruder des Staates zu sitzen. Es kommt seinem Gewissen nicht darauf an, wieviel er nützt, sondern wieviel er nützen wollte“, betont Gotthold Ephraim Lessing unter dem Buchstaben „D“ dieses extravaganten Lexikons. Der erste dort dargestellte Beruf ist der der Dienstboten. Vom Niederen zum Hohen und zurück schweift Rudi Palla in seinem Ausnahmewerk Verschwundene Arbeit. Das Buch der untergegangen Berufe aus dem Wiener Brandstätter Verlag, der banale Bücher gar nicht machen kann und das Handwerk des Schöne-Bücher-Machens unverdrossen hochhält. Nach einer vom Verleger Christian Brandstätter selbst illustrativ ausgestatteten Ausgabe von 2010 ist dies nun eine erneut vollständig neu gestaltete und erweiterte Ausgabe. Sie hat 117 Abbildungen, darunter viele historische Fotografien.
Einen „Streifzug durch die Sedimente menschlicher Anstrengung“ wolle er unternehmen, schreibt Rudi Palla im Vorwort. Sein Vademecum verlorener Arbeit versammelt neben handwerklichen Tätigkeiten auch solche der Dienstleistungen, der Unterhaltung, des Kleinhandels und der Beförderung, ist reich an Details, Anekdoten und Kuriosa über Barometermacher, Drahtzieher, Eichmeister, Landsknechte, Lustfeuerwerker, Nachtwächter, Planetenverkäufer, Roßtäuscher, Seifensieder, Sesselträger, Wachsbossierer, Wäschermädel, Zinngießer und viele andere untergegangene Berufen.
„Verschwundene Arbeit“ erschien erstmals vor über 20 Jahren, im Juni 1994, als sozusagen indirektes Manifest und einhundertfünfzehnter Band der „Anderen Bibliothek“. Gesetzt war es in limitierter Auflage im Bleisatz. Das aber war – leider – einmal. Ab Band 145 wurde das Druckverfahren der Liebhaberreihe auf Offsetdruck umgestellt, die Begründung des in seiner pekuniären Not kostenoptimierenden Verlages: „Weil mittlerweile der Computersatz den Standard des besten Bleisatzes übertrifft.“ Immerhin wurde so im Eichborn Verlag der Bleisatz im Buchdruck bis 1997 und damit bis kurz vor die Jahrtausendwende erhalten, dann war auch dieses Handwerk – bis auf wenige Ausnahmen wie heute etwa die Friedenauer Presse in Berlin – stillgelegt.
Rudi Palla: Verschwundene Arbeit. Das Buch der untergegangen Berufe. Format 17 x 24 cm. Hardcover. 272 Seiten. 117 Abbildungen. Lesebändchen. Wien: Christian Brandstätter Verlag 2014. 35,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
 Garantiert kein Verlustgeschäft
Garantiert kein Verlustgeschäft
Wer 80 Jahre alt wird, nimmt im Lauf seines Lebens 120.000 Mahlzeiten zu sich. Nicht alle davon muss man gedankenlos hineinschaufeln. Für manche lohnt auch ein Ausflug oder ein Umweg. Ein Restaurant- und Gasthauswegweiser der anderen Art dafür ist der Slow Food Genussführer 2019/20. In Italien sind die Gastrononie- und Kulinarik-Führer der „Slow Food“-Bewegung schon seit gut 30 Jahren eine Institution, in vielen Buchhandlungen haben sie beinahe ein eigenes Regal. (Ich schwöre darauf, oft sind es unscheinbare Kaschemmen mit sagenhafter Kulinarik; selbst in Rom, Florenz, Vendig oder gar Monaco muss man damit nicht großes Geld für gutes Essen auf den Tisch legen.) Für Deutschland liegt jetzt der vierte Jahrgang vor, und so dick war er noch nie. Unter den insgesamt 548 Lokalempfehlungen befinden sich 125 Neueinträge. Zahlreiche Hintergrundinformationen gehen weit über einen „normalen“ Restaurantführer hinaus. Hier geht es um aktiven Widerstand gegen den Verlust von mehr als nur Gastrokultur, nämlich ursprünglichen Lebensmitteln und Produktionsweisen, mit Hausmannskost, Mutters Küche, regionaler Vielfalt und artgerechter Landwirtschaft nur unzureichend beschrieben. „Slow Food“ ist so etwas wie eine gelebte Utopie. Im internationalen Projekt „Arche des Geschmacks“ der Slow Food Stiftung für Biodiversität werden weltweit rund 4.900 regional wertvolle Lebensmittel, Nutztierarten und Kulturpflanzen vor dem Vergessen und Verschwinden geschützt, die unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen am Markt nicht bestehen oder „aus der Mode“ gekommen sind.
 „Slow Food“ bedeutet nicht, dass man lange auf das Essen warten muss (siehe dazu das CulturMag vom Dezember 2014). Die inzwischen weltweite Bewegung wurde 1986 an jenem Tag in Bra im Piemont gegründet, an dem in Italien der erste McDonald’s – am Fuß der Spanischen Treppe in Rom – eröffnete. Im Gegensatz zu „Fast Food“ finden nur Lokale Beachtung, die eisern die alte Tugenden der Kochkunst hochhalten: gut, sauber, regional und saisonal, fair nicht zu vergessen. Es gibt umfangreiche Hintergrundinformationen mit einer Warenkunde zu den Grundnahrungsmitteln, ein ABC der regionalen Spezialitäten und einem Blick auf Deutschlands Regionen und ihre Gerichte. Ein Führer, dessen Kosten man schon nach dem ersten Essen wieder drin hat. – Und schon vormerken: Die deutsche Ausgabe der „Osterie d’Italia 2o19/20“ erscheint am 30. 1. 2019.
„Slow Food“ bedeutet nicht, dass man lange auf das Essen warten muss (siehe dazu das CulturMag vom Dezember 2014). Die inzwischen weltweite Bewegung wurde 1986 an jenem Tag in Bra im Piemont gegründet, an dem in Italien der erste McDonald’s – am Fuß der Spanischen Treppe in Rom – eröffnete. Im Gegensatz zu „Fast Food“ finden nur Lokale Beachtung, die eisern die alte Tugenden der Kochkunst hochhalten: gut, sauber, regional und saisonal, fair nicht zu vergessen. Es gibt umfangreiche Hintergrundinformationen mit einer Warenkunde zu den Grundnahrungsmitteln, ein ABC der regionalen Spezialitäten und einem Blick auf Deutschlands Regionen und ihre Gerichte. Ein Führer, dessen Kosten man schon nach dem ersten Essen wieder drin hat. – Und schon vormerken: Die deutsche Ausgabe der „Osterie d’Italia 2o19/20“ erscheint am 30. 1. 2019.
Slow Food Deutschland (Hg.): Slow Food Genussführer Deutschland 2019/20. 548 Lokalempfehlungen, darunter 125 Neueinträge. oekom verlag, München 2018. Stabiler, biegsamer Einband, 752 Seiten, 28 Euro. Verlagsinformationen.
Zu Slow Food Deutschland geht es hier, zur Bewegung in Österreich hier, in der Schweiz hier und in Italien hier. Den Slow Food-Führer für Österreich, Südtirol und Slowenien finden Sie hier und den Urtyp, den „Osterie d’Italia“, hier.
In den nächsten Tagen folgen hier noch mehr Besprechungen – schauen Sie wieder vorbei.
Ina Katharina Uphoff, Nicola von Velsen: Schaubilder und Schulkarten. Von Bildern lernen im Klassenzimmer. Prestel Verlag, München 2018. Hardcover, Format 24,5 x 29,0 cm, 200 farbige Abbildungen, 240 Seiten, 40 Euro. Verlagsinformationen.
u.a.