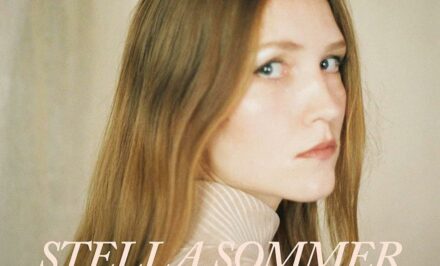In den „Blitzbeats“ stellt die CULTurMAG-Musikredaktion regelmäßig kurz und knapp (oder auch mal länger) Platten verschiedenster Provenienz und Güte vor; heute hat sich Thomas Wörtche was aus seinem Jazzkeller hochgeholt…
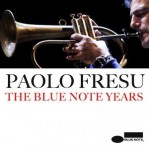 Musique noir
Musique noir
Obwohl erst 1961 geboren, gehört der Sarde Paolo Fresu zu den ganz großen Trompetern Europas – in die Klasse der Manfred Schoof, Kenny Wheeler, Tomasz Stanko und Enrico Rava (nein, Till Brönner habe ich nicht übersehen, der gehört da nicht hin …). Wenn man sich mit zeitgenössischem Jazz beschäftigt, weiß man das. Dann besitzt man vermutlich auch eine erkleckliche Anzahl von Fresu-Tonträgern. Seine Diskographie nennt 220 Alben, darunter ungefähr 30 als Leader. Die ästhetische Bandbreite seines Schaffens ist enorm – das geht von imaginärer musique noire (wenn diese Parallelbildung zum roman noir erlaubt ist – der Prototyp ist nicht umsonst Miles Davis‘ „Fahrstuhl zum Schafott“-Musik und Miles Davis‘ Einfluss auf Paolo Fresu ist nicht nur in jeder Note zu hören, sondern auch in Fresus Konzept, sich auf nichts auszuruhen, immer neue Pfade zu gehen, immer das Neue perfekt machen zu wollen und auch zu machen) über subtilen Kammerjazz im modalen Modus bis hin zu den „Projekten“ – wie dem „Mare Nostrum“-Projekt mit Robert Galliani und Jan Lundgren, die Zusammenarbeit mit Nguyên Lê, mit Ralph Towner oder oder oder… Die beiden CDs, die Blue Note Italy hier mit 32 Tracks aus den Jahren 2004 bis 2009 vollgepackt hat, konzentrieren sich auf Fresus „Standard Quintett“, wenn dieser Terminus Sinn ergibt: Also auf die Formation mit Roberto Cipelli am Piano, Ettore Fioravanti am Schlagzeug, dem Bassisten Attillio Zanchi und dem Reeds-Mann Tino Tracanna. Besonders, wenn der zum Sopransaxophon greift, ergeben sich wunderbare Dialoge mit Fresus Trompete. Am Flügelhorn spielt Fresu sowieso seine enorme melodische Kompetenz wollüstig aus. Und Klavier, Schlagzeug und Bass sorgen für absolut präzise, kluge, sparsame und doch enorm swingende Unterböden, die Cipelli hin und wieder mit robust-impressionistischen (ja, kann man so sagen) Ausflügen verlässt.
Die zweite CD konzentriert sich hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit dem Pianisten und Sounderfinder Uri Caine, auch fünf Tracks mit dem Alborada String Quartet sind dabei, darunter das ziemlich sehr geniale „Ossi“, das man zunächst für ein Stück deutscher Spätromantik halten könnte, bevor sich Fresus gedämpfte Trompete einschleicht und Uri Caine mit ein paar ausgefuchsten ostinaten Klaviereinwürfen (erst vom Piano, dann vom Fender Rhodes) die Jetztzeit herstellt. Das hat Witz und Verstand…
Wie gesagt: Wenn man Fresu-Fan ist, hat man vermutlich die Original-CDs. Wenn man Fresu mit dieser Doppel-CD kennenlernen will, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man nur ein paar Aspekte seines Gesamtwerkes angeboten bekommt. Die aber in höchster Qualität.
Paolo Fresu: The Blue Note Years. 2 CD. Blue Note.
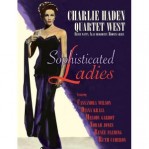 Hoher Kitschanteil
Hoher Kitschanteil
Charlie Hadens Quartet West, immer noch neben dem Leader/Bassisten bestehend aus Ernie Watts, Alan Broadbent und Rodney Green, versteht sich auch auf der ersten neuen Produktion seit elf Jahren (meine Güte ….) als musikalischer Arm der Raymond-Chandler-L.A.-noir-Nostalgie-Bewegung. Die Atmosphäre des Californian noirs in Film, Literatur und Ambiente soll die Musik prägen. Keine Ahnung, ob das misogyne Weltbild des stets von Haden beschworenen Raymond Chandler hier eine ironische Pointe setzen soll – aber immerhin featured Haden sechs Sängerinnen. Und die vertragen die Streicherarrangements im manchmal sehr idealtypisch rekonstruiert klebrigen Sound der 1940er und 1950er nicht alle gleich gut. Cassandra Wilson und Diana Krall zum Beispiel würden ja gerne swingen, hat man den Eindruck, fühlen sich aber deutlich eingeengt und müssen auch eher mit den Streichern duettieren als z. B. mit Hadens nach wie vor wunderbarem Bass (hören Sie sich mal daraufhin „My Love and I“ mit Cassandra Wilson an). Erstaunlich gut schlagen sich dagegen Melanie Gardot (die viel besser ist, als ihre derzeit nervige PR-Kampagne sie aussehen lässt) und vor allem: Norah Jones, ausgerechnet bei einem ganz schweren Brocken, bei „Ill Wind“. Renée Fleming und Ruth Cameron, na ja… Die Instrumentals, nur das Quartett ohne Streicher mit dem schönen Alt-Sound von Ernie Watts, sind so gesehen natürlich einfache Gewinnspiele. Solide, klasse, gut, wie zu erwarten.
Das Problem bei der ganzen Sache: Das Ding zündet nirgends wirklich. Vielleicht hat sich diese Art musikalisch-kultureller Nostalgie wirklich erschöpft. Vielleicht hören und bemerken wir die Kitschanteile des noir inzwischen auch nicht mehr nur positiv, sondern auch als überständig, zopfig und problematisch. Oder ganz einfach: Haden hat eine diesmal nicht so richtig gelungene Produktion abgeliefert. Das kann ja schon mal vorkommen und ist auch okay.
Charlie Haden Quartet West: Sophisticated Ladies feat. Cassandra Wilson, Diana Krall, Melody Gardot, Norah Jones, Renée Flemming, Ruth Cameron. UMG/Emarcy.
 Verknappung
Verknappung
Erstmal scheint alles ein bisschen seltsam: Ein Produzent, der statt der ausübenden Musiker oder eines Formationsnamens sich selbst in den Titel setzt; dazu eine fürs unbewaffnete Auge auf dem Cover und im Booklet kaum lesbare Schnörkelschrift, die vermutlich Romantik und exquisites Ambiente vermitteln soll; und letztendlich eine ziemlich dreiste CD-Laufzeit von knapp 35 Minuten. Hmmmm… Das kommt so: Bei dem Produzenten Meeco handelt es sich um den in Paris lebenden Pianisten und Komponisten Michael Meier, der die acht Kompositionen der CD geschrieben hat (es sind neun Tracks, der letzte ist ein alternate take zum Opener „Cabelos ao vento“), aber nicht als Pianist agiert. Am Klavier sitzt nämlich ein Großmeister, Kenny Barron, dessen brillant sprödes Spiel bestens zu Buster Williams passt, dessen Bass wohlklingende, spielökonomische Intelligenz verströmt. Zusammen lassen Barron und Williams einen Schlagzeuger vergessen, den es auf dieser Produktion auch gar nicht gibt. Eddie Henderson spielt Trompete im Miles-Davis-Modus, und die beiden Saxophonisten James Moody und Vincent Herring (wahrlich auch keine Nobodies – man könnte fast von Star-Besetzung reden) werfen hin und wieder ein paar Phrasen und kleine Soli ein. Über allem die flüsternde Stimme der Sängerin Eloisa, die auf Portugiesisch zu der dunkel-samtenen Atmosphäre der Session beiträgt. Alles low tempo, alles gehaucht, getupft, zurückgenommen, konzentriert, gedämpft, subtil und veritabel elegant. Klangfarbe und Stimmung geht vor drive und Dynamik, aber das ist schon okay. Und insofern sind auch die 35 Minuten nicht so ausgedehnt, dass sich Langeweile einstellen könnte. Wenn man Qualität knapp hält, verlangt das Publikum vielleicht bald nach mehr. Wenn so ein Kalkül aufginge, wär’s schön…
Meeco: Perfume e Carícias. Connector Records.
Thomas Wörtche