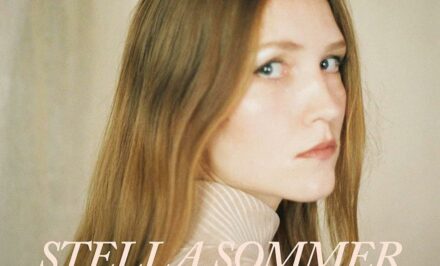Zum Jahresbeginn hat unsere Autorin Christina Mohr ein wenig über all die Möglichkeiten kontempliert, die nun vor uns liegen – und gleich noch die passende Musik dazu herausgesucht. Wem das nicht reicht, dem gibt sie auch noch was zu lesen mit auf den Weg.
Der Jahresanfang ist eine gute Gelegenheit zum Innehalten und Das-Leben-neu-sortieren. Und man muss nicht einmal das totgenudelte Hesse-Zitat mit dem Anfang und dem Zauber bemühen, um sich an dem Gedanken zu erfreuen, dass das neue Jahr als noch unberührte Abfolge weißer Kalenderblätter vor einem liegt… Welche Verheißung: So viele Möglichkeiten und noch so viel freier Platz – wunderbar! Die passende Musik für eine solche Stimmungslage will sorgsam ausgesucht sein. Rockiges Gitarrengegniedel würde wie schmutziger Schneematsch auf die freien Seiten spritzen, House- und Discobeats hingegen beanspruchen den Körper viel zu sehr, als dass der Kopf sich noch auf das Schmieden von Zukunftsplänen konzentrieren könnte. Nein, der Jahresanfangszauber der eventuell noch anwesende Neujahrskater verlangen nach klaren Tönen, die frei sind von hedonistisch-bacchantischer Verlockung. Also Klassik? Schwere Entscheidung für popkulturell verdorbene geschulte Ohren und Herzen.
 Entspannte Reise
Entspannte Reise
Das Album „Foreign Landscapes“ des als Hauschka firmierenden Düsseldorfers Volker Bertelmann löst dieses Dilemma auf fabelhafte Weise: Bertelmann/Hauschka entstammt einem Hip-Hop-sozialisierten Umfeld, zu relativer Bekanntheit kam er mit elektronisch-experimenteller Musik und Bandprojekten wie Long Fin Killie, Tonetraeger und Music A.M. Doch vor dem Pop stand bei Hauschka die klassische Ausbildung am Klavier – inzwischen sein ausschließliches Arbeitsinstrument. Für sein letztes Album „Ferndorf“ präparierte Bertelmann das Klavier im John Cageschen Stil: Ping-Pong-Bälle, Korken, Metallstücke und Gaffa-Tape sind nur einige der Gegenstände, mit denen Hauschka dem Klavier ungewöhnliche Klänge entlockt. Seiner Lust am Spielen und Entdecken lässt Hauschka auch auf „Foreign Landscapes“ freien Lauf, mit handelsüblichem Pop allerdings hat diese Musik außer ihrer Zugänglichkeit kaum etwas gemeinsam. Das Album wurde mit zwölf Orchestermusikern aus San Francisco live eingespielt, Hauschkas Piano steht keineswegs im Zentrum: Geigen, Celli, Klarinetten fügen sich zu detailreichen, dennoch klaren musikalischen Bildern. Minimalistische Strenge und verspielte Effekte schließen sich nicht aus, Begleitgeräusche wie das Klappen von Ventilen oder das Schaben der Geigenbögen sind gewünscht und ergänzen das präparierte Klavier. Hauschka entwirft Melodiebögen in hellem Dur-Klang, die sich in all ihrer Leichtigkeit doch prägnant behaupten – damit offenbart sich der Popmusiker Bertelmann, der im Übrigen auf eine gewisse Pop-Ökonomie achtet (will heißen: die Tracks sind ungefähr so lang wie Popsongs). Die Stücke heißen „Alexanderplatz“ und „Union Square“, „Kamogawa“, „Mount Hood“ oder „Madeira“ – was Ortlosigkeit meinen könnte, wird bei Hauschka zur entspannten Reise, die Kopf und Geist aufräumt. Und dass „Foreign Landscapes“ eigentlich klassische Musik ist, hat man kaum bemerkt.
Hauschka: Foreign Landscapes. Fat Cat (Rough Trade).
 Verspielte Atmosphäre
Verspielte Atmosphäre
Auch Ralf Hildenbeutel kommt aus der Club-Ecke, war dort sogar ein ganz wichtiger Player: der 40-jährige Frankfurter gilt als einer der Erfinder des typischen Trance-Sounds. Als Producer und Labelchef (Eye Q Records, Schallbau) war und ist er sehr erfolgreich, in den 1990er-Jahren produzierte er z. B. alle Veröffentlichungen von Sven Väth; mit seinem eigenen Liveact Earth Nation bespielte er große Techno-Festivals. Wie Volker Bertelmann genoss Hildenbeutel eine klassische Musikausbildung am Klavier und lernte schon als Kind das Werk von Komponisten wie Debussy, Satie, Bach und Chopin kennen. Hildenbeutels aktuelle Soloplatte „Wunderland“ ist der (modernen) klassischen Musik sehr verbunden, durch geloopte Beats und Breaks (z. B. bei „The Feast) aber näher am Clubgeschehen als Hauschkas „Foreign Landscapes“. „Lucy’s Dream“, Hildenbeutels Solo-Vorgängeralbum zu „Wunderland“, bestand ausschließlich aus Klavier- und Streicheraufnahmen und wirkte dadurch wie reinste Kammermusik. „Wunderland“ variiert das Kammermusikalische durch buntere Instrumentierung: Akkordeon, Kinderinstrumente, Klavier, Glockenspiel, Ukulele, Cello, Orgel, der Einsatz von Stimmen, Türknarren und Filmsequenzen und last but not least die fantastische Dorit Chrysler am Theremin („The Spirits That I Called“) sorgen für eine verspielte Atmosphäre, die aber nie zum Durcheinander gerät. Im Gegenteil. „Wunderland“ ist von leuchtender Klarheit, erfrischend wie ein sonniger Januarmorgen in den Bergen. Dabei herzerwärmend, nicht zuletzt durch episch-märchenhafte Stücke wie „From Elsewhere“ und „Memento“. Debussy und Satie lassen grüßen und schweben als freundliche Zitate durch Hildenbeutels „Wunderland“. Der Umstand, dass Ralf Hildenbeutel auch Filmmusik komponiert (unlängst für „Vincent will Meer“), schreit nur so danach, „Wunderland“ als Musik fürs „Kopfkino“ zu beschreiben – das tun wir hier aber nicht, denn einer der guten Vorsätze fürs neue Jahr lautet ja, auf gar keinen Fall Worthülsen dieser Art zu verwenden. „Wunderland“ ist schlicht und ergreifend ein sehr schönes Album, das sich zu entdecken lohnt. Wenn man beim Hören auch noch Bilder sieht, geht das voll in Ordnung.
Ralf Hildenbeutel: Wunderland. Rebecca & Nathan.
www.ralfhildenbeutel.com
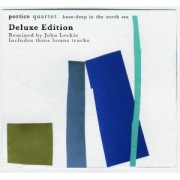 Melodie und Groove
Melodie und Groove
Wir verlassen die klassischen Gefilde und wenden uns dem Jazz zu – sofern Puristen die Musik des Portico Quartet überhaupt als Jazz durchgehen lassen. Im vergangenen Jahr machten die vier jungen Londoner mit ihrem zweiten, auf Peter Gabriels Real Life-Label erschienenen Album „Isla“ Furore. Jazz- und Popfans konnten sich gleichermaßen auf die eklektische und dabei ziemlich neuartige Mixtur aus Sechzigerjahre-Jazz, afrikanischen Grooves, elektronischen Loops, flächig arrangierten Ambient- und Trancesounds, Weltmusik und Experimenten mit Neuer Musik verständigen. Dass Jack Wyllie (Alt-Saxophon, Elektronik), Milo Fitzpatrick (Kontrabass), Nick Mulvey (Percussion) und Duncan Bellamy (Schlagzeug) gern an publikumsträchtigen Orten wie Kunstgalerien, Chillout-Lounges und Kirchen auftreten, mag einiges zur Mehrung ihres Ruhms beigetragen haben. Das wirklich Neue und Besondere an der Musik des Portico Quartet ist aber die Verwendung des Hang, eines elektronischen Percussion-Instruments, das vor zehn Jahren von einem Schweizer Tüftler erfunden wurde. Das (der? die?) Hang klingt ein bisschen wie afrikanische Steeldrums, aber ein wenig heller und flirrender. Die Tracks wirken dadurch federnd und leicht, bei gleichzeitiger Erdung durch brummenden Kontrabass und Alt-Saxophon. Was das Portico Quartet trotz unterschiedlicher musikalischer Ausrichtung mit Hildenbeutel und Hauschka verbindet, ist ihre Popaffinität: die Stücke gönnen sich mäanderndes Ausufern mit Improvisationscharakter, im Zentrum aber stehen Melodie und Groove. Jedes Instrument ist klar akzentuiert, doch kein Musiker beansprucht zu viel Raum für sich. Wegen des großen Erfolgs von „Isla“ wird Porticos Debütalbum von 2007, „Knee-deep in the North Sea“ jetzt als Deluxe-Edition wiederveröffentlicht. Stücke wie „The Kon Tiki Expedition“, „Too Many Cooks“ oder „Steps in the Wrong Direction“ verströmen Entdeckergeist und Aufbruchstimmung – man spürt förmlich die Begeisterung der Musiker darüber, was ihnen hier gerade gelingt. Von Angeberei ist nichts zu spüren, von Bescheidenheit allerdings auch nicht: „Knee-deep in the North Sea“ klingt für ein Debüt erstaunlich reif, und es verwundert nicht, dass dieses Album für den Mercury Music Prize nominiert wurde.
Portico Quartet: Knee Deep In The North Sea. Real World.
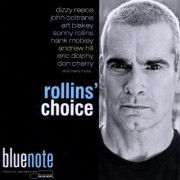 Im Blue Note-Archiv
Im Blue Note-Archiv
Weiter im Jazz: Henry Rollins war bis dato nicht unbedingt als Jazz-Experte bekannt, sondern mehr für seine eindrucksvollen Spoken-Word-Performances, die in ihrer manifesten Körperlichkeit nahtlos an Rollins‘ Hardcore-Vergangenheit mit Black Flag anknüpfen. Der knapp 50-Jährige (am 13.2.2011 hat er Geburtstag) ist allerdings auf so vielen Gebieten bewandert, dass das ehrwürdige Blue Note-Label an ihn herantrat, damit er aus deren Fundus ein persönliches Lieblingsalbum zusammenstellen sollte – dabei herausgekommen ist ein Doppelalbum mit Jazz-Klassikern, das gleichzeitig überrascht und überzeugt. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man selbst beim blinden Herumstochern in Blue Note-Veröffentlichungen Hervorragendes zutage fördert. Aber Rollins ist tief eingestiegen ins Blue Note-Archiv und hat seine Fundstücke auf eine „Evening“- und eine „Night“-CD sortiert. Die „Evening“-Songs sollen auf spätere Ereignisse einstimmen und sind ein wenig eingängiger, gefälliger und auch schlicht bekannter als die Stücke auf „Night“: Dexter Gordons „Modal Mood“ eröffnet smooth und leicht, darauf folgen Art Blakey, Sonny Rollins (kein Verwandter, Henry Rollins bürgerlicher Nachname lautet Garfield), Freddie Hubbards‘ „Open Sesame“ und das wunderbare „Blue Train“ von John Coltrane. Die „Night“-Seite hält einige anspruchsvolle Schätze bereit wie zum Beispiel Eric Dolphys „Out To Lunch“, „There Is The Bomb“ von Don Cherry, das Henry Rollins nicht erst seit dem Blue Note-Auftrag kennen dürfte. Auch „Voodoo“ von Sonny Clark und Herbie Hancocks „Maiden Voyage“ sind so energetisch und kraftvoll, dass sie nicht nur das Herz eines Hardcore-Punkrockers erfreuen dürften. Kurzum: „Rollins‘ Choice“ darf man ohne Bedenken an Menschen weiterreichen, die nicht wissen, wer Henry Rollins ist. Wer Rollins-Fan ist, dürfte mit seiner Jazz-Selection auch sehr viel Freude haben – und kann dabei so einiges lernen, was wiederum dem mitteilsamen Henry gut gefallen wird.
Rollins‘ Choice. 2 CD. Blue Note (EMI).
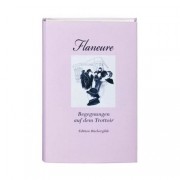 Beobachtungen
Beobachtungen
Vielleicht hat all die schöne Musik (s. o.) zu einer so entspannten Haltung geführt, dass man bereit ist, das Haus zu verlassen, um gänzlich absichtslos ein wenig durch die Straßen zu streifen – oder besser: zu flanieren. Die Hände auf dem Rücken verschränken, dabei mal nach oben in den Himmel schauen, dann nach unten, ob sich dort nicht ein interessanter, rätselhafter Gegenstand findet, oder auch: einfach mal stehen bleiben und in die Auslagen der Geschäfte blicken. Moment: „Auslagen“ sagt heute kein Mensch mehr, und auch das Flanieren scheint aus der Mode gekommen. Schlimmer sogar: wer es sich erlauben kann, ziellos durch die Stadt zu schlendern, ohne zu einem ach so wichtigen Termin zu müssen, der ist entweder arbeitslos oder ein reicher Geldsack, beide Modelle sind äußerst schlecht beleumundet. Vor knapp hundert Jahren stand es um den Ruf des Flaneurs anders, elegante Dandys und intellektuelle Scribenten schritten durch die Häuserschluchten der frisch hochgezogenen Citys und machten sich Gedanken. Seine große Zeit hatte der Flaneur (wir beginnen an dieser Stelle keine Diskussion darüber, weshalb es wohl so wenige Flaneurinnen gab/gibt und auch im vorgestellten Buch nur ganze zwei Autorinnen zu finden sind – eine Schelmin, die da an Böses wie bspw. ein Zuviel oder Zuwenig an Freizeit dabei denkt…) in den 1920er- und 30er-Jahren und wandelte bevorzugt durch europäische Metropolen wie Wien, Berlin, Zürich, Paris und Prag. Schriftsteller wie Robert Walser, Fernando Pessoa, Siegfried Kracauer oder – aktueller – Peter Handke, Wilhelm Genazino, Christa Moog und Botho Strauß verstanden/verstehen sich nicht nur selbst als Flaneure, sondern befanden ihre alltäglichen, zuweilen kuriosen Beobachtungen der Verschriftlichung wert. Zum Glück: Essays, Kurzgeschichten und Großwerke wie Walsers „Großstadtstraße“, Franz Hessels „Ein Flaneur in Berlin“ oder Walter Benjamins „Waffen und Munition“ verraten mehr über das Leben in der Großstadt, als es Zeitschriften und Filme je könnten.
Der von Stefanie Proske liebevoll zusammengestellte Band „Flaneure. Begegnungen auf dem Trottoir“ passt aufgrund seines Miniformats hervorragend in die Manteltasche (es darf auch gern der Bademantel sein), aus der er beim Verweilen im Café hervorgezogen werden sollte, um darin zu blättern. Die literarischen Flaneure mögen uns inspirieren, auch mal wieder einfach nur so in der Stadt herum zu stromern, als Tonspur empfehlen sich die oben vorgestellten Alben. Und das durchaus auch noch später im Jahr, nicht nur im Januar.
Flaneure. Begegnungen auf dem Trottoir. Hg. von Stefanie Proske. Edition Büchergilde. Gebunden im Schuber, 198 Seiten. 14,90 Euro.