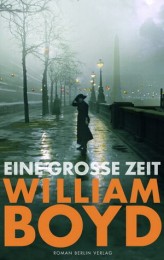 Salonliteratur – mit Handschuhen
Salonliteratur – mit Handschuhen
– William Boyds historischer Spionageroman „Eine große Zeit“ und ein Exkurs zu James Bond.
Ein junger Mann, Ende zwanzig, auf konventionelle Weise geradezu gutaussehend, der eben aus dem Wiener Hofgarten schlendert – so skizziert uns William Boyd den Protagonisten seines Buches „Eine große Zeit“, das uns als historischer Spionageroman avisiert wird. Boyd spricht seine Leser ohne jeden Umschweif sofort mit „du“ an: „Dir springt er ins Auge, weil er keinen Hut trägt, eine Ausnahmeerscheinung in der Menge geschäftiger Wiener, die alle einen Hut aufhaben, Männer wie Frauen“.
So werden wir ihm nun folgen, diesem Lysander Rief, einem englischen Schauspieler ohne eigene Mitte, der sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges durch das Wien von 1913/1914 treiben lässt. Er wird einer besonderen Form der Psychoanalyse begegnen: der „fonction fabulatrice“, der Fabulierfunktion, mit deren Hilfe Vorstellung und Wirklichkeit samt der eigenen Vergangenheit zu einer lebenserhaltenden Fiktion verschmelzen, zu einer Parallelwelt. Er wird eine unglückliche Liebschaft eingehen, die ihn ins Gefängnis und in die Fänge des englischen Geheimdiensts bringt. Wenig selbstbestimmt, ein Blatt im Wind der Affekte und unartikulierten Leidenschaften, wird er durch Wien taumeln, letztlich durch den ganzen Roman, ein entfernter britischer Verwandter des „Mannes ohne Eigenschaften“.

Robert Musil: Graffiti am Musilhaus in Klagenfurt (Quelle: wikipedia)
Jenes Hauptwerk Robert Musils – ein bis heute ungeheuerlich intelligenter, den Zeitgeist der sich vor nun rund 100 Jahren zementierenden Moderne in unendlich vielen luziden Facetten widerspiegelnder Jahrhundertroman – kam mir beim Lesen immer wieder in den Sinn, leider zum Nachteil für William Boyd. Das meine ich jedoch weniger böse, als es klingen mag. Boyd ist ein exzellenter Autor, vielfach preisgekrönt, reflexiv und vielseitig gebildet, am Wirken der Welt interessiert und dem in seinen oft an historischen „Hebelstellen“ angesiedelten Romanen, in seinen Filmskripten und Aufsätzen auf vielseitige Weise nachspürend. Der vor 60 Jahren in Ghana geborene Schotte, der neben Oxford und Glasgow auch in Nizza studierte und teilweise in Frankreich lebt, ist so etwas wie der Martin Mosebach des britischen Literaturbetriebes: universell einsetzbar auch für „kleine Arbeiten“, ein interessanter Buch-, Film- und Kunstkritiker. Sein 1981 veröffentlichter Erstlingsroman „Unser Mann in Afrika“ wurde mit Sean Connery verfilmt, die Kolonialzeit blieb ihm bis heute ebenso Thema wie das englische Schulsystem.
1998 provozierte Boyd einen Skandal mit der erfundenen Künstlerbiografie „Nat Tate. An American Artist: 1928–1960“, dessen expressionistische Bilder ebenso Fake waren wie David Bowies (abgesprochene) Einlassungen bei einer Vernissage. Dem vorausgegangen waren 1988 „Die neuen Konfessionen“ eines fiktiven Filmregisseurs, die Fälschungs-Trilogie wurde abgerundet dann 2002 mit dem Tagebuch eines fiktiven Schriftstellers, der angeblich auch Picasso und Virginia Woolf begegnet war. An die Bösartigkeit eines Charles Willeford freilich reichen diese drei Bücher nicht heran, deshalb sei hier ein Hinweis auf dessen 2005 im Maas-Verlag erschienene „Ketzerei in Orange“ erlaubt, in dem Willeford 1971 einen Kunstkritiker fabulierte, der sich eines erfundenen Künstlers bemächtigt und nun die Konsequenzen einer aus dem Ruder laufenden Fiktion zu tragen hat. Der Titel der amerikanischen Originalausgabe: „The Burnt Orange Hersey“.
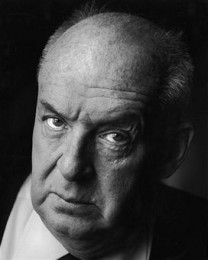
Vladimir Nabokov
Blass und unpolitisch
Häresie findet man bei William Boyd kaum, er ist, auch wenn man seine Essay- und Kritiksammlung „Bamboo“ (2005) liest, der Gegenwart ein wenig enthoben. Tschechows Geschichten sind ihm die schönste Literatur, über Shelley hat er promoviert, Nabokov und Dickens gehören zu seinen Lieblingen, zu seinen literarischen Auszeichnungen zählt der Somerset Maugham Award. Etwas von dessen salontauglichen Geheimagenten Ashenden scheint auf in „Eine große Zeit“. Wie Maugham versteht Boyd es glänzend, eine Szene zu skizzieren, indem er Nebensächlichkeiten hervortreten lässt, indem kleine Gesten wie in einer filmischen Großaufnahme an Signifikanz gewinnen und in Erinnerung bleiben.
Unter dem Strich aber – zumindest an den Meistern des historischen Thrillers wie etwa Alan Furst gemessen – bleibt Boyd in „Waiting for Sunrise“ (so der Originaltitel) merkwürdig blass in seinem Zeitgemälde, genauer gesagt: recht apolitisch. Als es ans Spionieren geht – Lysander soll/muss den Codeschlüssel besorgen, mit dem sich die Korrespondenz der deutschen Botschaft in Genf dechiffrieren lässt – haben die Instruktionsgespräche fast grotesk kasperlehaften Charakter:
„Wissen Sie eigentlich, was hier auf dem Spiel steht?“
„Sicher. Verräter. Führungsstab und so weiter. Ich weiß Bescheid.“
„Dann tun Sie Ihre Pflicht als britischer Soldat.“
(Wörtlich so im Buch, Seite 257.)
Trotz eines Ausfluges in die Schützengräben der Westfront bleibt der Kriegshintergrund vage. 750 Kilometer ist die Westfront lang, 75 km davon werden von der britischen Armee kontrolliert, soviel zur Signifikanz des Ganzen, zumal besondere Zusammenhänge etwa von Kriegslogistik oder sich entwickelnder Nachrichten- oder Waffentechnik nicht das Metier sind, für das Boyd ein Faible zeigen würde. Ein Agent namens „Freudenfeuer“ liest die gesamte Korrespondenz des deutschen Konsulats in Genf, zu seiner Kontrolle will „England“ dessen Codeschlüssel. „145 t an Haubitz Geschosse 15 cm nach Béthume. 65 beladene Güterzüge in Le Mans“, dürfen wir einmal mitlesen. Lysander soll den Schlüssel, der sich dann im Libretto der Oper „Andromeda und Perseus“ versteckt, deren Plakat er auf den ersten Seiten des Romans bereits in Wien begegnet war, mit allen Mitteln besorgen: „Sie müssen Genf mit diesem Codeschlüssel verlassen!“, verlangt sein Führungsoffizier, der wie viel anderes Personal in seinem Milieu blass bleibt. Hilft es, dass Genf den Protagonisten unweigerlich an Wien erinnert, in dem er die erste Hälfte des Romans zubrachte? Das Holzgeschnitzte der Handlung und des hobbyhaft wirkendem Agententums gemahnen an B-Movies, in denen die Darsteller in eine Szene geworfen, hölzern und ohne Gusto agieren. Nicht einmal eine Folterszene, in der Lysander einem Delinquenten nasse Topfkratzer aus Stahlwolle in den Mund steckt und sie unter Strom setzt, hat irgendeine, einen Thriller-Leser heutzutage noch beeindruckende Qualität. Die Aktion wirkt eher peinlich. Ebenso wie die Drittel Seite Gewissensbisse.
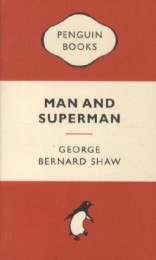 Voice over hat eben seine Grenzen
Voice over hat eben seine Grenzen
Nach all dem, was er erlebt hat, notiert sich Lysander in seinen „Autobiographischen Untersuchungen“, seinem privaten Fabulierjournal, „ist er der Meinung, etwas von der modernen Welt zu verstehen, ja vielleicht sogar eine kleine Vorschau auf die Zukunft bekommen zu haben. Ich durfte die mächtige industrielle Kriegsmaschinerie des zwanzigsten Jahrhunderts sowohl an ihrem wuchtigen bürokratischen Ursprung als auch an ihrem fragwürdigen menschlichen Ziel erleben.“ Die Schattenwelt, in die William Boyd seine Leser zu führen versucht, bleibt schemenhaft. Am Schluss stehst „du“ Leser 1915 in London in der Archerstreet, aus einem Theater enteilt ein Mann im Regenmantel, ohne Hut (you get it?), „und du erkennst ihn vermutlich als Mr. Lysander Rief wieder, der in „Mensch und Übermensch“ von George Bernard Shaw die Hauptrolle spielt“. Mehr macht Boyd nicht daraus, ein hingeworfenes, belanglos bleibendes Detail. Der Roman endet mit: „Mr. Lysander Rief ist allem Anschein nach ein Mann, der sich im kühlen Schutz der Dunkelheit am wohlsten fühlt. Geborgenheit sucht er im Schatten.“
Heiliger Strohsack. Quel Erkenntnis! Viel Lärm um nichts. Boyd ist – auch bei seinen Filmskripten – ein begeisterter Verfechter des „voice over“, des über jedwede Handlung gelegten Kommentars aus dem Off. Das mag beim Film zu einem gewissen Maße funktionieren und in der Belletristik Ausweis von Erzählkunst sein, als Antriebsmotor eines Agentenromans taugt solch ein Stilmittel nur begrenzt. (Was hat Norman Mailer in „Harlot’s Ghost“ nicht einst Furioses daraus gemacht.)
Lassen wir Boyd also den Literatursalons, Agentenliteratur sieht anders aus. Jetzt am 12. Juni erscheint Alan Fursts neuer historischer Agentenroman „Mission to Paris“ – in USA und Großbritannien. Deutsche Übersetzung: Fehlanzeige. Am 13. November 2012 wird Altmeister Robert Littell sich mit „Young Philby“ zurückmelden.
 Der ewige Untote: James Bond 007
Der ewige Untote: James Bond 007
William Boyd wird uns im Herbst 2013 wieder begegnen – als Autor des nächsten James Bond-Romans. Boyd hat sich mit den Fleming-Nachlassverwaltern darauf geeinigt, das Buch in den 60er Jahren anzusiedeln. Im Moment, kurz nach der Lektüre von „Eine große Zeit“, entlockt mir das keine Freudenschreie, muss ich sagen. Zum einen weiß ich, was Boyd vor zehn Jahren über Ian Fleming geschrieben hat. Zum anderen habe ich mich gerade durch die letzte Bond-Auftragsarbeit gebissen: Jeffery Deavers „Carte Blanche“.
Bereits vier Mal für den Edgar nominiert, ist der ungemein produktive Deaver einer der besseren global publizierten Thrillerautoren, der weniger durch literarische Ambition als durch „solid story telling“ glänzt. Bekannt gemacht hat ihn vor allem die Lincoln-Rhyme-Reihe, deren erster Roman „Der Knochenjäger“ auch im Kino ein Erfolg war. Für mich bleibt das beste Deaver-Buch nach wie vor „Manhattan Beat“ von 1988 mit der punkigen Rune als Protagonistin, dessen Originaltitel „Manhattan is my Beat“ andeutet, wie sich da jemand eine Stadt aneignet. Großartig!
In seinem vor Ehrfurcht starren Bond-Roman dauert es Äonen, bis so etwas Ähnliches wie ein Plot in Bewegung gerät, allerdings nie aus seiner Tempo-30-Zone herauskommt. Deaver beglückt uns mit schweißtreibenden Erkenntnissen (auf Seite 244) wie: „Der Alltag der Polizei und Geheimdienste hat mehr mit Papierkram als mit Waffen und technischen Spielereien zu tun. Trotz des Spätherbstes war das Klima mild und das Büro warm …“ Aha, ist ja spannend.

Jeffery Deaver (Quelle: wikipedia)
Die „Carte Blanche“ des Titels ist ein Drink: „Ein doppelter Crown Royal Whisky auf Eis. Dazu ein halbes Maß Triple Sec, zwei Schuss Angostura und einen Twist Orangenschale, keine Scheibe.“ Der Bond-Darsteller muss noch gefunden werden, der solch eine Bestellung zu einem Kabinettsstückchen machen könnte. Der komische Drink taugt aber als gute Metapher für die Rezeptur des ganzen Romans, in dem es englisch-irische Bösewichte, die irgendetwas mit Müll und geschredderten Dokumenten machen (eine sinistre, globale Müllfirma?) bis hin zur Anmutung, die Leichenfelder Afrikas zum Verschwinden bringen zu wollen, dazu eine ominöse, doppelt verzwirbelte Anschlagsdrohung, deren Ziel solange im Nebel bleibt, bis es auch den Autor kaum mehr zu interessieren scheint und das über 500 Seiten zu verhindern versuchte Ereignis zum Nachrichtenschnipsel im Fernsehen verkommt …
Hauptsächlich in Südafrika spielend, mit Bond zum Teil undercover als, gähn, Geschäftsmann, einem partout nicht zu Goldfinger- oder Blofield-Größe auflaufenden Bösewicht, einem konfusen Plot und allerlei Beschattungs- und Abhörabläufen, dazu noch Bonds der Spionage verdächtigter Vater als schweres Erbe, schleppt der Agentenbürokratenroman sich in völlig anti-deaverscher Manier dahin. Ein Zweikampf in einer alten Kosaken-Technik namens „Systema“ ist so schwerfällig beschrieben, dass einem die Socken einschlafen. Adam Hall hat das in den frühen 70ern in seinen ultra-coolen Quiller-Romanen, also vor 40 Jahren, schon weit interessanter, schneller und überraschender hinbekommen. Und dann, dann „erstarrt“ Bond, als er bei einem konfusen, anonymen shoot-out seinen toten Gegner findet. „Severan Hydt würde nirgendwohin mehr fliegen. Der Lumpensammler, der visionäre König des Zerfalls, der Herr der Entropie lag auf dem Rücken. Er hatte zwei Schusswunden in der Brust und eine dritte in der Stirn. Ein beträchtlicher Teil seines Hinterkopfes fehlte.“ – Auch hier, eine bürokratische Bestandsaufnahme mit toten Worten, jeder Stil geschreddert.

William Boyd (Quelle: wikipedia)
Nach Jefferey Deaver nun William Boyd
Bei seinem Ausflug in britische Gefilde ist amerikanische Autor Jeffery Deaver also in eine Art Demutstarre verfallen, warten wir wie William Boyd sich bei Bond aus der Affäre ziehen wird. Mit elf oder zwölf Jahren, so beschrieb er es im Jahr 2002, habe er „Liebesgrüße aus Russland“ mit einer verbotenen Erregung gelesen, als handle es sich dabei um eine nur unter Vertrauten herumgereichte, seltene Samisdat-Pornografie. Das also sei sie, die erwachsene Welt, die uns allen heute vertraute Mischung aus Snobismus, Sex, grotesker Gewalt, exotischen Reisen und Luxusgütern. Solche Schalen, bemerkte Boyd in seinem kleinen Essay, fallen einem bald von den Augen, aber der Reiz bleibe, solange er eben anhalte. Bonds Welt, so findet Boyd, seine eine comic-strip-Version des Lebens, das Fleming selbst beinahe lebte. So wurde es schließlich mehr der Autor selbst als sein Protagonist, für den sich Boyd zu interessieren begann – und ihm in seinem Text mit der Exegese mehrerer Biografien nachsteigt. Fleming spielt eine kleine Rolle in Boyds Roman „Eines Menschen Herz“ von 2002.
Als einen unglücklichen, zerrissen Charakter, dem eine Erbschaft einen snobistischen Lebensstil erlaubte, sieht ihn Boyd. Als Fleming 1939 zur Naval Intelligence Division stieß und dort Assistent von Admiral John Godfrey wurde, ließ er sich von seinem Schneider eine Uniform anfertigen. Dass seine reichen Freunde ihn aber als „chocolate soldier“ verulkten, der in Wirklichkeit Spionageeinsätze plante und im Geheimkrieg gegen Hitler aktiv war, verunsicherte ihn tief. Seine Reaktionen waren alles andere als selbstbewusst und Bond-cool. Siehe dazu auch Nicholas Rankins recht glorifizierende Recherche: „Ian Fleming’s Commandos: The Story of 30 Assault Unit in WW II“ (Faber & Faber, London 2011). Fleming selbst beschrieb sich einmal so: „Ich blieb immer mit einem Bein in der Wiege, die ich nicht verlassen wollte, während mein anderes Bein schon auf das Grab zueilte. Das führt zu ziemlich schmerzhaften Verrenkungen im Leben.“
Nachdem Deaver in seinem „Carte Blanche“ mit „spycraft“ enttäuschte und Boyd in seiner „Eine große Zeit“ sich nun nicht gerade als Thrillerautor erwies, kann man gespannt sein, wie das innere und äußere Einsatzgebiet des nächste James-Bond-Romans aussieht. Vielleicht gibt Boyd uns ja den Snob zurück. Vielleicht kann er uns etwas sagen über den infantilen Anteil am Vergnügen über Thrillerliteratur. Ein uneigentliches „period piece“ wie „Eine große Zeit“, einen weiteren Pastiche brauchen wir nicht von ihm. Hoffentlich hat Boyd nicht zu viel Hochachtung vor dem Original.
Alf Mayer
William Boyd: Eine große Zeit. (Waiting für Sunrise, 2012). Roman. Deutsch von Patricia Klobusiczky. Berlin: Berlin Verlag 2012. 446 Seiten. 22,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Jeffery Deaver: Carte Blanche. 007 – Ein James Bond-Roman. (Carte Blance, 2011) Roman. Deutsch von Thomas Haufschild. München: Blanvalet 2012. 544 Seiten. 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.











