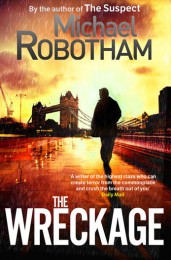 Im Trümmerhaufen der Realität zu graben
Im Trümmerhaufen der Realität zu graben
Michael Robothams Politthriller „Der Insider“, Thomas W. Youngs „Freeze“ und Atiq Rahimis „Verflucht sei Dostojewski“, besprochen von Alf Mayer.
„Follow the Money“ – was der als „Deep Throat“ bekannt gewordene Insider den beiden Reportern der „Washington Post“ in der Watergate-Affäre immer wieder einzubläuen suchte, das gibt auch den Ariadnefaden in Michael Robothams Politthriller „Der Informant“. Der Originaltitel „The Wreckage“ verweist auf den gewaltigen Trümmerhaufen, in dem Robotham hier gräbt: Es geht um den Irak, um den „Krieg gegen den Terror“ und um die dabei selbstverantwortete Zerstörung westlicher Werte durch eigene Hand. Robotham erwähnt nebenbei die wahre Geschichte eines Taliban-Führers, der nach drei Tagen Folter weinend zusammenbricht: „Ich weine für mein Land, aber am meisten für eures.“
 In Robothams „Insider“ geht es um gewaltige Summen Geldes, die im Irak-Krieg in undurchsichtigen Kanälen versickert sind, und um Fragen, die besser niemand stellt. Politische Thriller, die als realitätstaugliche Spannungsliteratur aus der akuten Gegenwart ihre Funken schlagen und dabei unsere google-gestützte Halbinformiertheit nicht beleidigen, sind selten geworden. Immer mehr wurden sie in den letzten 20 Jahren, seit dem Ende der alten Weltordnung, zu einer aussterbenden Gattung. Kaum ein Dutzend Titel im Jahr sind es heute noch, die an das Niveau von Eric Ambler, Alan Furst, Robert Littell, Ross Thomas, Charles McCarry und die guten Zeiten von John le Carré oder Brian Freemantle heranreichen und nicht altbackene Phantasien mit irgendwelchen Superagenten bedienen, die „den Westen retten“ und es „den Bösen“ zeigen.
In Robothams „Insider“ geht es um gewaltige Summen Geldes, die im Irak-Krieg in undurchsichtigen Kanälen versickert sind, und um Fragen, die besser niemand stellt. Politische Thriller, die als realitätstaugliche Spannungsliteratur aus der akuten Gegenwart ihre Funken schlagen und dabei unsere google-gestützte Halbinformiertheit nicht beleidigen, sind selten geworden. Immer mehr wurden sie in den letzten 20 Jahren, seit dem Ende der alten Weltordnung, zu einer aussterbenden Gattung. Kaum ein Dutzend Titel im Jahr sind es heute noch, die an das Niveau von Eric Ambler, Alan Furst, Robert Littell, Ross Thomas, Charles McCarry und die guten Zeiten von John le Carré oder Brian Freemantle heranreichen und nicht altbackene Phantasien mit irgendwelchen Superagenten bedienen, die „den Westen retten“ und es „den Bösen“ zeigen.
Den Traditionen des Polit-Thrillers bewusst – und ihnen auch gewachsen – zeigen sich heute nicht allzu viele Autoren: Deon Meyer etwa über Südafrika (hier und hier bei CrimeMag) oder der Amerikaner Olen Steinhauer, der über ein Jahrzehnt in Osteuropa gelebt hat und dessen CIA-Trilogie „Der Tourist“ und „Last Exit“ gerade mit „An American Spy“ seine Abrundung findet (eine deutsche Übersetzung ist noch nicht angekündigt). Auch David Ignatius, einer der wohl am besten informierten Journalisten Washingtons, gehört dazu, bekannt dürfte er einer größeren Öffentlichkeit durch die Verfilmung seines Romans „Der Mann, der niemals lebte“ geworden sein: mit Leonardo DiCaprio als Feldagenten und Russel Crowe, der per Handy auf dem Weg zum Kindergarten „seinen“ Krieg dirigiert. Sein jüngstes Buch „Der Deal“ (hier besprochen bei CrimeMag) heißt im Original „Blood Money“ und beschäftigt sich neben der Sache mit dem Geld und der Ignoranz des Westens (die er bereits im Motto mit einem schönen Zitat des britischen Staastsekretärs für Indien von 1937 erhellt) damit, wie der Krieg gegen den Terror denn jemals zu beenden sei (hier bei CrimeMag mehr dazu).
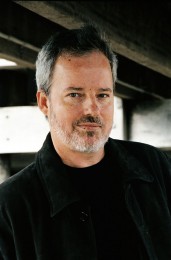
Quelle: michaelrobotham.com
Neues Handlungsfeld für alte Bekannte
Nun stößt auch der Australier Michael Robotham in diese Liga vor. Bisher konnte er mit seinen psychologisch raffinierten, glaubwürdig entwickelten und beziehungskomplexen Thrillern „Adrenalin“, „Amnesie“ , „Todeskampf“ , „Dein Wille geschehe“ und „Todeswunsch“ überzeugen. Der ehemalige Journalist, der sich als Aussie im Londoner Presse-Dschungel behauptete, hat gründlich recherchiert. Sein Thriller funktioniert als „stand alone“, das Schöne für Robotham-Leser aber ist, wie er seinen politischen Stoff mit den Protagonisten seiner „zivilen“ Thriller verknüpft. Es sind dies der an Parkinson erkrankte Psychologe Joe O’Laughlin und der grummelige, illusionslose Ex-Polizist Vincent Ruiz.
Ein kleiner Diebstahl ist in London der Auslöser, der Ruiz auf eine immer blutiger werdende Spur setzt. Im Irak sind es Banküberfälle, die dort den Journalisten Luca Terracini verwundern. Zumindest lässt „jemand“ es so aussehen: gesprengte Gebäude, verkohlte Bankbeamte, erschossene Wachleute, eine Spur von Gewalt, der nachzugehen brandgefährlich ist und die für Luca Terracini zur Obsession wird. Er trifft dabei auf eine UN-Rechnungsprüferin, die mit ihren wirtschaftsprüferischen Mitteln den ungeheuren, in den Irak gepumpten Geldströmen folgt.
Ein gutes Dutzend Figuren verwebt Robotham zu einem in jeder Hinsicht starken Erzählstrang. Im großen Stil verschwindet für den Wiederaufbau des Landes bestimmtes Geld. Robotham notiert: „Zwölf Milliarden Dollar wurden als Banknoten im ersten Kriegsjahr in den Irak geliefert, um das Land zusammenzuhalten, das Chaos zu verhindern. Aber es gab keine Übersicht oder Kontrolle. Ich habe Auszahlungen in Papiertüten, Pizzaschachteln und Seesäcken gesehen. Bargeld wurde in Privatautos durch die Stadt kutschiert, Betrug wurde ein Synonym für „Business as usual“. Eine Zeitlang erhielten mehr als 8.000 Sicherheitsleute Gehaltsschecks, obwohl man nur 600 aktive Mitarbeiter fand. Halliburton hat täglich 42.000 Mahlzeiten für Soldaten abgerechnet, tatsächlich nur 14.000 serviert.“
Als weiteres Beispiel für das Chaos im Irak mögen hier die internationalen Presseberichte vom 12. Juli 2007 dienen (googeln erlaubt): Drei Wächter einer Sicherheitsfirma hatten danach in Bagdad 282 Millionen US-Dollar (205 Millionen Euro) aus einer Bank geraubt. „Es ist damit vermutlich der größte Bankraub aller Zeiten“, meldeten die Nachrichtenagenturen der Welt. Niemand aber regte sich sonderlich auf, ebenso wenig wie über das Dementi am nächsten Tag, als das irakische Innenministerium verkündete, nicht 282 Millionen US-Dollar, sondern lediglich 282 Millionen irakische Dinar seien erbeutet worden, umgerechnet 22.500 US-Dollar. Allerdings, so das Ministerium, nahmen die Bankräuber noch rund 366.000 US-Dollar mit. Die Berichte erschienen nicht in den Politikteilen der Zeitung, sondern unter „Vermischtes“, es gab keine Analyse des Vorfalls, es blieb bei der bizarren Notiz. Alles schien eben möglich im Irak. Na und?
http://www.youtube.com/watch?v=4D3FD9qrwNM
„Es interessiert nicht mehr“
Robotham macht auch diese unsere Indifferenz zum Thema: „Glauben Sie wirklich, die Story wäre ein echter Knüller – eine lächerliche Verschwörungstheorie über Banküberfälle im Irak und eine britische Bank? In einer Woche kümmert das niemanden mehr“, sagt einer seiner Protagonisten. „Es interessiert die Leute nicht mehr. Nachrichten aus dem Irak oder Afghanistan langweilen sie, so wie sie sich irgendwann mit Vietnam, Watergate, dem Iran-Contra-Skandal, der Weltfinanzkrise und der Ölpest im Golf von Mexiko gelangweilt haben“, meint Luca, der Journalist. Trotzdem bleibt er, in gewissem Sinne wohl ein Alter ego Robothams, an der Sache dran. Mit der UN-Rechnungsprüferin Daniela diskutiert er nebenbei Heisenbergs Unschärferelation: ob denn die Beobachtung eines Ereignisses das Ereignis an sich verändere. Ihn beschäftigt auch der Unterschied zwischen beobachtetem und geteiltem Schmerz: „Beobachtender Schmerz ist der Schmerz der Journalisten, zuzusehen und zu berichten, ohne sich emotional einzumischen.“ Luca fragt sich, ob so jemand etwas Besseres sei, als jene, die die Gewalt ausüben. „Böse Samariter lautet dafür der Begriff“, meint er.
 Eine der Qualitäten des solide übersetzten Buches ist, dass Robotham auch „die Bösen“ differenziert und in ihrem Familiengefüge zeichnet. Für ihn ist das Private politisch. „Von den Reichsten bis hin zu den Ärmsten beginnt und endet alles mit der eigenen Familie“, endet der Roman. Robotham ist ein Familienmensch, hat drei Töchter. Ein Thriller ist für ihn keine kalte Reißbrettzeichnung, das macht er mit seinem bislang politischsten Buch erneut klar.
Eine der Qualitäten des solide übersetzten Buches ist, dass Robotham auch „die Bösen“ differenziert und in ihrem Familiengefüge zeichnet. Für ihn ist das Private politisch. „Von den Reichsten bis hin zu den Ärmsten beginnt und endet alles mit der eigenen Familie“, endet der Roman. Robotham ist ein Familienmensch, hat drei Töchter. Ein Thriller ist für ihn keine kalte Reißbrettzeichnung, das macht er mit seinem bislang politischsten Buch erneut klar.
Nicht in Deutschland übersetzt wurde übrigens bislang Robothams „Bombproof“ von 2009, in dem er einen Kleinkriminellen mit einem Bomben-Rucksack durch ein von Terroranschlägen erschüttertes London hetzen ließ. Den fulminanten, kleinen schmutzigen Triller stellt der Autor einer australischen Leseaktion kostenlos zur Verfügung. 300 000 Freixemplare wurden verteilt. Robothams Hoffnung damals: „Wem dieses Buch gefällt, der liest vielleicht auch mal wieder ein anderes. Das muss nicht von mir sein, es geht mir ums Lesen.“ Lesen ist für ihn elementar: „Saying you don’t like books is like saying you don’t like sex.“

Matt Taibbi (Quelle: Wikipedia)
Exkurs: Als der Journalismus noch recherchiert hat. Zwei Beispiele.
Für seinen „Insider“ weist Robotham nicht explizit bestimmte Quellen aus, zu seinen Anstößen aber dürften zwei große Recherchen gehört haben, die es wert sind, nicht in Vergessenheit zu geraten. Matt Taibbi, Reporter des „Rolling Stone“, machte in seiner großen Recherche über die Plünderung der amerikanischen Staatskasse durch gewinnorientierte Söldnerfirmen “The Great Iraq Swindle: How Bush Allowed an Army of For-Profit Contractors to Invade the U.S. Treasury” vom 31. August 2007 klar: „Die Operation “Iraqi Freedom” war nie ein Krieg gegen Saddam Hussein, es war eine Invasion des Staatshaushaltes und keine Besetzungsmacht der Geschichte war je so erfolgreich. George W. Bushs Krieg in der mesopotamischen Wüste war ein Experiment besonderer Art, die grobschlächtige Verwirklichung einer gänzlich privatisierten US-Regierung. Im Irak wurde die Linie zwischen essentiellen Regierungsaufträgen und privater Profitwirtschaft bis zur Absurdität verzerrt, bis zum Punkt, dass verwundete Soldaten den vollen Ladenpreis für frische Unterwäsche zahlen mussten und gleichzeitig Privatunternehmen riesige Gewinne garantiert wurden, egal wie sehr sie ihre Sache versiebten.
Könnten wir bitte einen „Krieg gegen Dummheit“ haben oder gegen Arroganz?“ Taibbis Fazit: „Was im Irak geschah, ging weit über Ineffizienz und Betrug hinaus. Hier ging es darum, dass eine Regierung von der Profitmaximierung so korrumpiert wurde, dass wir uns fragen müssen, ob der Staat jemals wieder seinen Job tun kann. Wenn ein katastrophales Versagen Milliarden von Dollar wert ist, wo bleibt dann der Anreiz, Erfolg zu haben? … Im Irak etablierte die Bush-Regierung eine Art Paradies für einen perversen Kapitalismus, wo die Kontraktoren sich ihre Gewinne und Renditen rücksichts- und zügellos vom Staat holten und wo nicht der Markt, sondern eine nicht zur Verantwortung zu ziehende Bürokratie obszöne Profite ausschüttet.“
„Vanity Fair“ legte im Herbst 2007 mit einer großen Story nach: “The Spoils of War: Billions over Baghdad.“ Donald L. Barlett and James B. Steele gingen dabei jenen zwölf Milliarden US-Dollar nach, die zwischen April 2003 und Juni 2004 von der US Notenbank in den Irak geschickt wurden: und zwar als Bargeld. Mindestens neun Milliarden Dollar gingen “verloren”. Kein Schwein, so fanden die Reporter heraus, hatte eine Ahnung, ein Interesse, allzu viel darüber zu erfahren, wo all dies viele Geld abgeblieben war oder – was für ein Stoff für einen Ross Thomas oder einen Richard Condon!
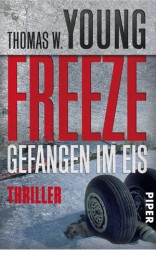 Am Boden – ohne Plan
Am Boden – ohne Plan
Ja, ich vermisse sie schmerzlich, die verqueren, literarisch ambitionierten und in ihrer Formenfindung so unerschöpflich originell agierenden großen Thriller-Autoren. Nehmen wir etwa den vom Piper-Verlag mit dem Aufkleber „Top Thriller“ versehenen „Freeze. Gefangen im Eis“ von Thomas W. Young (im Original: „The Mullah’s Storm“). Young war hochdekorierter Flugingenieur für die US-Luftwaffe in Afghanistan, Bosnien, im Irak, in Lateinamerika, Afrika und Fernost. Von Transportflugzeugen, Navigation, Abwurfvorrichtungen und Abwurftechnik versteht er zweifellos eine Menge, ein echter Spezialist.
Als sein Held, der Navigator Michael Parson und die ultracoole Militärdolmetscherin Sergeant Gold zusammen mit einem gefangenen, natürlich ranghohen (?) Mullah den Absturz ihrer Maschine über dem Hindukusch überleben, schlägt auch die Geschichte auf dem Boden auf. Die ungleiche Truppe muss sich nun in Schnee und Winter durch Taliban-Land schlagen, ein Survivaldrama von der Schmackhaftigkeit einer „Eisernen Ration“, die Ingredienzien betulich gemischt.
Der Stil ist trocken, ohne besonderen Witz, selten nur gibt es Beobachtungen wie etwa diese: „Im Dämmerlicht sah er seine leeren Patronenhülsen auf dem verharschten Schnee liegen, die heißen Messinghülsen schmolzen sich selbst kleine Gräber in den Schnee.“ Stattdessen macht die Erzählperspektive den Leser zum Komplizen von ziemlich viel Ignoranz und Unkenntnis über Afghanistan. Der dramaturgische Kniff, mit Leuten unterwegs zu sein, die nur aus der Luft mit diesem Land zu tun hatten, also sehr oberflächlich, ermüdet bald. Da sind ein paar Amerikaner in einem fremden Land unterwegs und haben eigentlich nichts als ihr Feindbild und ihre Technologie. Möglicherweise ist das alles ehrlich gemeint, tiefer schürfen aber geht anders.
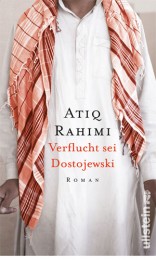 Raskolnikow in Kabul
Raskolnikow in Kabul
Als wären sie Brüder von Kafka, Daniil Charms und eben Dostojewski, begegnen uns die Figuren in dem großartigen „Verflucht sei Dostojewski“ des 1962 in Kabul geborenen
Exil-Afghanen Atiq Rahimi, der in Frankreich lebt und 2008 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. „Als Russul das Beil hebt, um es der alten Frau auf den Kopf zu schlagen, schießt ihm plötzlich die Geschichte von ‚Verbrechen und Strafe‘ in den Sinn. Und schmettert ihn nieder.“
So hebt der Roman an – und hält diese Höhe bei seinem mäandernden Taumel durch das heutige Kabul. Das Schicksal des Mörders Raskolnikow fällt da plötzlich den jungen Rassul an, einen verarmten, passionierten Leser russischer Literatur. Mit seiner Schuld an der Ermordung einer alten Wucherin, deren Tod niemanden interessiert, bleibt er alleine, er irrt durch die Stadt, durch absurde Situationen. Atiq Rahimi gelingt eine Reflexion über Gewissen und Gerechtigkeit, die dem Werk von Dostojewski keine Schande macht. Ein großes Buch, bei dem ich mir auch das Hörbuch als außergewöhnlich vorstellen kann – es mir aber (noch) nicht zu Gemüte geführt habe.
Alf Mayer
Michael Robotham: Der Insider (The Wreckage, 2011). Roman. Deutsch von Kristian Lutze. München: Goldmann 2012. 544 Seiten. 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Thomas W. Young: Freeze. Gefangen im Eis (The Mullah’s Storm, 2010 ). Roman. Deutsch von Bärbel und Velten Arnold. München: Piper 2012. 368 Seiten. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Atiq Rahimi: Verflucht sei Dostojewski (Maudit soit Dostoievski, 2011 ). Roman. Deutsch von Lis Künzli. Berlin: Ullstein 2012. 288 Seiten. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Homepage von Robotham. Lis Künzli, Übersetzerin von „Verflucht sei Dostojewskii“ im Interview.












