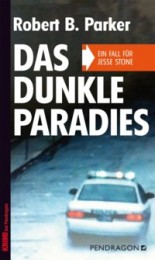 Rückkehr eines Schwergewichts
Rückkehr eines Schwergewichts
Endlich bei uns: Robert B. Parkers Jesse-Stone-Romane
Ja, er war ein Vielschreiber, und am Ende nervten mich die großen Buchstaben, mit denen in den US-Ausgaben Volumen geschunden wurde. Robert B. Parker aber gehört ganz klar zu den Großen der Kriminalliteratur, dies gewiss nicht nur wegen der schieren Zahl seiner Werke: insgesamt 68 Kriminal- und Westernromane sowie einige Sachbücher. 2010 im Alter von 77 Jahren bei der üblich-alltäglichen Produktion von fünf Manuskriptseiten tot über seine Schreibmaschine gesunken, war er ein Arbeitspferd, an der Schreibmaschine wie an seinen geliebten Hanteln, Autor auch des Standardwerks „Training with Weights“, einer, der sich 1974 als allerersten Satz für seinen ersten Roman „The Godwulf Manuscript“ („Spenser und das gestohlene Manuskript“, auch als „Die Schnauze voll Gerechtigkeit“ erschienen) folgendes ausdachte: „Das Büro des Universitätspräsidenten sah aus wie der Empfangsraum eines gut gehenden viktorianischen Bordells“, und bald darauf dann seine akademische Karriere sausen ließ, um hauptberuflich Schriftsteller zu werden.
Parkers Dissertation von 1971 trug den Titel „The Violent Hero, Wilderness Heritage and Urban Reality: A Study of the Private Eye in the Novels of Dashiell Hammett, Raymond Chandler and Ross Macdonald”. Er war ein lebenslanger Fan von Raymond Chandler, führte dessen unvollendeten Roman weiter („Poodle Springs“), stemmte mit „Tote träumen nicht“ („Perchance to Dream“) die Fortsetzung von Chandlers „Der große Schlaf“ und hielt so Philip Marlowe ein Stück länger am Leben. Privatdetektivgeschichten und Pulps waren seine Jugendlektüre gewesen. In einem netten down-to-earth-Interview mit Charles P. Silet meinte er dazu:
„Als es dann Zeit wurde für eine Dissertation, dachte ich, warum nicht über etwas schreiben, wozu ich schon all die Lektüre erledigt habe? Ich brauchte dafür zwei Wochen, das entspricht auch dem Wert des Ganzen. Die Arbeit war nicht schrecklich gut, sie aber war gut genug, mir den Doktortitel zu geben und mich an der Uni freier zu machen.“
 Hüte, die noch Dellen machen
Hüte, die noch Dellen machen
Robert Brown Parker, 1932 geboren, schenkte uns nicht nur insgesamt (und nicht alle gleichermaßen starke) 39 Romane mit dem Privatdetektiv Spenser und dessen schwarzem Sidekick Hawk. Der Herkunft des amerikanischen Privatdetektivs aus der Tradition der auf sich selbst gestellen „law men“ bewusst, unternahm er beachtliche Ausflüge in den Western, schrieb vier Romane um die freelance-Gesetzeshüter Virgil Cole und Everett Hitch, die Verfilmung von „Appaloosa“ durch und mit Ed Harris ein grandioses Vergnügen und der literarischen Vorlage erstaunlich gerecht. Man muss das Duo Ed Harris und Viggo Mortensen gesehen haben, die Hüte stets tief im Gesicht, gewaltige Dellen im Haar, wenn eine dieser Kopfbedeckungen mal gelüftet wird, Viggo mit der größten Schrotflinte der Filmgeschichte, deren Anblick alleine schon ehrfürchtig macht, wie sie als umherziehende freiberufliche Zeitarbeiter Recht und Ordnung in ein kleines Kaff bringen, dabei hauptsächlich auf einer Veranda sitzen, schweigsam, knorrig, männlich, Angst höchstens vor Frauen. Auf eine süße Art, natürlich.
„Haben Sie gerade meiner Sekretärin in den Ausschnitt geschaut?“, lautete 1974 der erste Satz, den die toughe Psychologin Susan Silverman in Parkers zweitem Roman „God Save the Child“ („Kevins Weg ins andere Leben“) an den Privatdetektiv Spenser richtet. Ihre Liasion war dann so etwas wie ein Spiegel „aufgeklärter“ Männer-Frauen-Verhältnisse in den späten 70er, 80ern und 90ern. Nicht ganz so glücklich gelang der Transfer ins Fernsehen. „Spenser: For Hire“ brachte es auf 66 Folgen, war aber ebenso bieder wie Robert Urich als der Titelheld, Avery Brooks als Hawk war zwar interessanter, das spin-off „A Man Called Hawk“ brachte es nur auf eine Saison und 13 Folgen. Ein Idris Elba, für mich der ideale Hawk, war damals noch Teenager, seine Fernsehauftritte begannen erst Mitte der Neunziger.
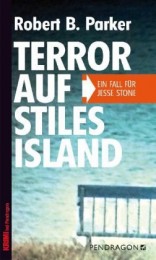 Parkers Heimstatt heute: Pendragon aus Bielefeld
Parkers Heimstatt heute: Pendragon aus Bielefeld
Auf deren eigenen Wunsch schrieb Robert B. Parker der Schauspielerin Helen Hunt die harte Polizistin Sunny Randall auf den Leib, zu einer Verfilmung kam es leider nie, „nur“ zu einer Serie von sechs Romanen (siehe unten). Keinen Schauspieler, einfach nur einen Rollenwechsel in Hinsicht auf Serienpersonal und Erzählperspektive im Blick hatte Parker, als er 1997 den tief verstörten Polizisten Jesse Stone erfand, einen abgehalfterten Ex-Säufer, aus Los Angeles vertrieben und in einem kleinen Nest in Massachusetts als Polizei-Chef gelandet. Eine in der dritten Person und auf längere Zeit angelegte Hauptfigur, kein Großdruck in den insgesamt neun Jesse-Stone-Romanen. Dichte Bücher, inhaltsreich, bravourös erzählt. Ganz klar gehört diese zwischen 1997 und 2010 entstandene Serie zu Robert B. Parkers besten Werken. Zupackend erzählt, dicht dran an den Figuren, geprägt von lebenskluger Lakonie und im Vollbesitz der erzählerischen Kräfte geschrieben, ist es Lesevergnügen pur, was der kleine große Pendragon Verlag jetzt den deutschsprachigen Lesern serviert: nämlich den Beginn einer deutschen Jesse-Stone-Werkausgabe. Die ersten beiden Bände „Das dunkle Paradies“ („Night Passage“) und „Terror auf Stiles Island“ („Trouble in Paradise“) machen Lust auf mehr, machen Lust auf den ganzen Jesse Stone. Schon auf den ersten 30 Seiten frohlockt man und staunt, wie lässig und gekonnt Handlungsstränge aufgebaut, Figuren eingeführt und Erwartungen geweckt und unterlaufen werden. Werbung für Kriminalliteratur sind diese Romane.
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, dieses Symptom des Zustands der Kriminalliteratur in Deutschland: Ein US-Bestsellerautor, von Ullstein zu Goldmann und Rowohlt gewandert, findet sein Refugium in Bielefeld. Verleger Günther Butkus, von dem sich in Sachen Autorenpflege und Wagemut manch Großverlag eine Scheibe abschneiden könnte, verlegt Robert B. Parker seit 2006 in seinem Verlag. Es wäre zu wünschen, dass die ersten beiden Stone-Romane einen Eindruck auf dem Markt und bei den Lesern hinterlassen.
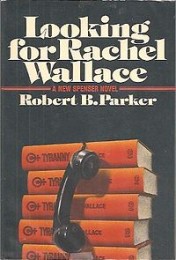 Jesse Stone ist Robert B. Parkers modernes „update“ einer romantischen Figur. Anders als der innerlich gefestigte Privatdetektiv Spenser, ein – wie es schon 1980 in „Looking for Rachel Wallace“ über ihn hieß – „fünfhundert Jahre zu spät gekommener Ritter“ („sechshundert“, korrigierte dort Spenser die Psychologin Susan Silverman ), ist Jesse Stone schon oft gestrauchelt, hat Niederlagen erlebt und eigene Grenzen, hat eine Ex-Frau, die er verprellte und aber auch nicht aufzugeben vermag, hat ein nicht zu kleines Alkoholproblem, hat Frauengeschichten und eine lange Liste zerschellter Hoffnungen. Spenser ist tatsächlich so etwas wie eine Idealfigur, Jesse Stone ein nicht nur vorteilhafter Polizist, der mit sich und der Welt klar zu kommen versucht. Jesse war für Parker ein „work in progress“, dies in vieler Hinsicht. Während Spenser und Susan ihrer idealen Beziehung frönen, in gewissem Maße sicher ein Spiegelbild von Parkers lebenslanger symbiotischen Liebe zu seiner Frau Joan, leidet Jesse an der „Bad Blond Girl Disease“, hat eine Schwäche für die oft falschen Frauen, muss sich etwa nach einer für seine Verhältnisse romantischen Liebesnacht in „Terror auf Stiles Island“ anhören, wie seine neue Flamme ihm am Morgen klar macht: „Da ist nichts weiter … Erwachsene Menschen ficken nun einmal miteinander.“ Ein Satz, der never ever in einer Spenser-Geschichte fallen würde.
Jesse Stone ist Robert B. Parkers modernes „update“ einer romantischen Figur. Anders als der innerlich gefestigte Privatdetektiv Spenser, ein – wie es schon 1980 in „Looking for Rachel Wallace“ über ihn hieß – „fünfhundert Jahre zu spät gekommener Ritter“ („sechshundert“, korrigierte dort Spenser die Psychologin Susan Silverman ), ist Jesse Stone schon oft gestrauchelt, hat Niederlagen erlebt und eigene Grenzen, hat eine Ex-Frau, die er verprellte und aber auch nicht aufzugeben vermag, hat ein nicht zu kleines Alkoholproblem, hat Frauengeschichten und eine lange Liste zerschellter Hoffnungen. Spenser ist tatsächlich so etwas wie eine Idealfigur, Jesse Stone ein nicht nur vorteilhafter Polizist, der mit sich und der Welt klar zu kommen versucht. Jesse war für Parker ein „work in progress“, dies in vieler Hinsicht. Während Spenser und Susan ihrer idealen Beziehung frönen, in gewissem Maße sicher ein Spiegelbild von Parkers lebenslanger symbiotischen Liebe zu seiner Frau Joan, leidet Jesse an der „Bad Blond Girl Disease“, hat eine Schwäche für die oft falschen Frauen, muss sich etwa nach einer für seine Verhältnisse romantischen Liebesnacht in „Terror auf Stiles Island“ anhören, wie seine neue Flamme ihm am Morgen klar macht: „Da ist nichts weiter … Erwachsene Menschen ficken nun einmal miteinander.“ Ein Satz, der never ever in einer Spenser-Geschichte fallen würde.
Im Memorial-Band „In Pursuit of Spenser“ meditiert Reed Farrel Coleman über Jesse und es dauert eine Weile, bis er bildhaft machen kann, woran diese Figur ihn erinnert: an Robert Mitchums Darstellung eines oft betrunken durch seine Welt taumelnden Sheriffs in Howard Hawks „El Dorado“. Ein angeknackster Held, der sich allen Widrigkeiten zum Trotze herzrührend behauptet.
Tom Sellecks „nagelt“ den Charakter
Mitchum wäre vermutlich tatsächlich ein guter Jesse Stone geworden, aber auch vor dem Mann, der sich diesen Charakter dann aneignete, ist jeder Hut zu ziehen. Teilweise von ihm selbst mitproduziert, gibt es acht Jesse-Stone-Verfilmungen mit Tom Selleck in der Hauptrolle. Die ersten beiden Episoden wurden im ZDF 2009/2010 ausgestrahlt und laufen als Wiederholungen zu Unzeiten wie 3.15 Uhr. Sie transportieren den Geist der Bücher, obwohl der 1945 geborene Tom Selleck deutlich älter ist als die von Parker im ersten Roman gesetzten 35 Jahre. Auf seinem Blog konstatierte Parker damals: „Tom nails the character head on.“ Selleck, der zwischen 1980 bis 1988 in insgesamt acht Staffeln und 162 Episoden als Privatdetektiv Thomas Magnum ein weltweites Publikum hatte, und als Markenzeichen häufig „Dusseldorfer Alt“ und das „nur aus der Flasche“ trank, läuft in den Jesse-Stone-Filmen zu richtig großer Form auf.
Mit Standard-Krimikost haben diese sorgfältig gemachten, atmosphärischen dichten Filme nichts zu tun. Der vorläufig letzte Jesse Stone-Film „Benefit oft he Doubt“ brachte es beim US-Sender CBS im Mai 2012 auf stolze 13 Millionen Zuschauer, der TV-Konzern informierte jedoch wenige Tage später Hauptdarsteller und Produzent, dass keine weiteren Episoden mehr geordert würden, weil die Filme in der Mehrzahl nur ein älteres Publikum anziehen würden. Ihre chronologische Reihenfolge:
- „Knallhart“ (Night Passage)
- „Eiskalt“ (Stone Cold)
- „Totgeschwiegen“ (Death in Paradise)
- „Alte Wunden“ (Sea Change)
- „Dünnes Eis“ (Thin Ice)
- „Ohne Reue“ (No Remorse)
- „Innocents Lost“
- „Benefit oft he Doubt“
Aber erst lesen. Dann schauen.
 Kritiken zu lesen, das überließ Parker seiner Frau
Kritiken zu lesen, das überließ Parker seiner Frau
Bis zu drei Bücher haute Robert B. Parker pro Jahr in die Tasten. Fünf Seiten am Tag waren sein Arbeitspensum. „Ich habe versucht, langsamer zu schreiben“, sagte er einmal, „aber das hat die Bücher auch nicht besser gemacht.“ Bis auf wenige Ausnahmen schrieb er ohne outline, einfach drauf los. Das Selbstbewusstsein dafür hatte er: „Ich schreibe seit 1971 und ich weiß, ich kann mir was ausdenken. Da kommt dann schon rechtzeitig das Richtige hoch.“ Stolz war er auf die Ökonomie seiner Sprache. „Viele Worte, denke ich, verschwende ich nicht. Wahrscheinlich ist es das, was ich am besten kann: Viel mit ganz wenig sagen.“ Kritiken zu lesen, das überließ er seiner Frau Joan, er selbst hielt sich an Hemingway: „Wenn du das gute Zeugs glaubst, das sie über dich schreiben, dann musst du dir auch die bösen Sachen zu Herzen nehmen.“
Herausgegeben vom unermüdlichen Otto Penzler, dem Prinzipal des Mysterious Bookshop in New York, erschien 2012 das Trade Paperback „In Pursuit of Spenser“(Ben Bella Books/ Dallas, 207 Seiten, $ 14.95). Eine ganze Riege von Schriftstellerkollegen zollt hier einem großen Kollegen Tribut: Dennis Lehane, Lawrence Block, Loren D. Estleman, Gary Phillips, S.J. Rozan, Ed Gorman, Max Allan Collins, Reed Farrel Coleman, dazu gibt es ein hübsches Profil von Spenser, verfasst von Robert B. Parker höchst selbst. Seine Gefährtin Susan Silverman an der Seite, gibt Spenser da einer jungen Autorin Auskunft, die an einem Buch über wagemutige Berufe arbeitet: „Men Who Dare“. Spenser wie sein Autor geben sich als glückliche Menschen zu erkennen, die für sich den richtigen Beruf gewählt haben. Auch in der gegenüber einem Spenser ziemlich beschädigten Figur von Jesse Stone scheint dies auf: die innere Freiheit, die es einem gibt, das Richtige zu tun.
- Die Jesse Stone-Romane:
Night Passage (1997) – jetzt neu als “Das dunkle Paradies” bei Pendragon
Trouble in Paradise (1998) – jetzt neu als „Terror auf Stiles Island“ bei Pendragon
Death in Paradise (2001)
Stone Cold (2003)
Sea Change (2006)
High Profile (2007)
Stranger in Paradise (2008)
Night and Day (2009)
Split Image (2010)
Killing the Blues (2011) - Die Western-Romane mit Virgil Cole und Everett Hitch:
Appaloosa (2005)
Resolution (2008)
Brimstone (2009)
Blue-Eyed Devil (2010) - Die Sunny Randall-Romane:
Family Honor (1999)
Perish Twice (2000)
Shrink Rap (2002)
Melancholy Bay (2004)
Blue Screen (2006)
Spare Change (2007) - Die Spenser-Romane:
1974 – 1978: The Godwulf Manuscript/ God Save the Child/ Mortal Stakes/ Promised Land/ The Judas Goat
1980 – 1989: Looking for Rachel Wallace/ Early Autumn/ A Savage Place/ Ceremony/ The Widening Gyre/ Valediction/ A Catskill Eagle/ Taming a Sea-Horse/ Pale Kings and Princes/ Crimson Joy/ Playmates
1990 – 1999: Stardust/ Pasttime/ Double Deuce/ Paper Doll/ Walking Shadow/ Thin Air/ Chance/ Small Vices/ Sudden Mischief/ Hush Money
2000 – 2011: Hugger Mugger/ Potshot/ Widow’s Walk/ Back Story/ Bad Business/ Cold Service/ School Days/ Hundred-Dollar Baby/ Now and Then/ Rough Weather/ The Professional/ Painted Ladies/ Sixkill
Eine ausführliche Bibliographie gibt es auch hier
Alf Mayer
Robert B. Parker: Das dunkle Paradies (Night Passage), 1997/1998 (Rowohlt)/2013 Pendragon. Übersetzt von Robert Brack, Nachwort von Frank Göhre. Bielefeld: Pendragon Verlag 2013. 347 Seiten. 10,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Robert B.Parker: Terror auf Stiles Island (Trouble in Paradise), 1998/ 2013. Deutsche Erstausgabe, übersetzt von Bernd Gockel. Bielefeld: Pendragon Verlag 2013. 308 Seiten. 10,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.Parker-Foto: wikimedia commons, Manchester (N.H.) Library











