Cheerio! Darauf lohnt es sich anzustoßen. Mit „Dämmerung in Mac’s Place“ liegen nun alle vier McCorkle- und Padillo-Romane von Ross Thomas auf Deutsch vor, sorgfältig übersetzt und vor allem vollständig, bei der Editionsvergangenheit der früheren Ausgaben bei Ullstein ein leider notwendiger Hinweis. Der inzwischen zwölfte Band der Maßstäbe setzenden Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag Berlin ist einmal mehr ein Grund, sich vor Verleger und Herausgeber Alexander Wewerka zu verneigen. Nach dem Trio der Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fälle nun also ein vollendetes Quartett – wenn das kein Anlass für eine Lokalrunde ist. Am Tresen u. a. Ross Thomas, Steve McQueen und Alf Mayer
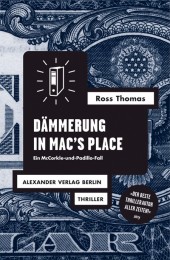 Lokalrunde! Das Mac’s-Place-Quartett von Ross Thomas ist vollständig
Lokalrunde! Das Mac’s-Place-Quartett von Ross Thomas ist vollständig
Mit 391 Seiten ist „Dämmerung in Mac’s Place“ (Twilight in Mac’s Place, von 1990, verstümmelt als „Letzte Runde in Mac’s Place“ bei Ullstein erschienen) der dickste Fall für die ungleichen Barbesitzer McCorkle und Padillo, die außer der Fähigkeit, einen guten Schuppen in Schwung zu halten, auch über viele andere Problemlösungsmöglichkeiten verfügen. Beweisen konnten sie das bereits in „Kälter als der Kalte Krieg“ (The Cold War Swap, mit dem Ross Thomas 1966 die Autorenbühne betrat und sogleich einen „Edgar“ errang), dann 1967 in „Gelbe Schatten“ (Cast a Yellow Shadow, wo es dazu lakonisch heißt: „Ich kannte Padillo seit langem, und wir hatten zusammen schon einige Leute sterben sehen.“) und 1971 in „Die Backup-Männer“ (The Backup Men).
„Wie viel kostet Schweigen?“
Beinahe 20 Jahre nach ihrem letzten Fall brauchen die beiden wiederum all ihren Witz und ihre Schläue, um der gestohlenen Memoiren eines einer Herzattacke erlegenen ehemaligen CIA-Agenten mit dem schönen Namen Steadfast Haynes erst habhaft zu werden und sich ihrer dann am eigenen Leibe unversehrt wieder zu entäußern. Haynes Sohn Granville hat zwei Bieter für das Werk. In deutlich erpresserischer Absicht geschrieben („Und wie viel kostet Schweigen?“ – „Nicht so viel, wie Sie denken.“) und unangenehm an den Alptraum Vietnam und viele Geheimnisse des Kalten Krieges rührend, will die Firma ein Erscheinen mit allen Mitteln verhindern. Wir Thrillerleser ahnen, was das bedeutet.
Unter der Feder von Ross Thomas wird daraus eine Screwball-Comedy bester Güte, voller byzantinischer Wendungen, scharfzüngiger Dialoge, bösem Humor, einem Reigen bizarrer Protagonisten, etwa der Sicherheitsleute Schlitz, Bud und Coors und jeder Menge Einsicht in die Deals der Mächtigen und Skrupellosen. Eine der interessantesten Figuren ist der Ex-Fremdenlegionär Tinker Burns, der vermutlich einzige amerikanische Veteran von Dien Bien Phu. 1990 ist der Kalte Krieg vorbei, nur die alten Säcke, die darauf gesetzt haben, ihre Söhne und Enkel im militärisch-industriellen Komplex in die Lehre zu schicken, sind zu stur, um es zuzugeben, mosert einer der Vernünftigen.
Ross Thomas erzählt, anders als in den ersten Mac’s-Place-Romanen, hier in der dritten Person. Erzählerisch ist das anspruchsvoller, aber Thomas zieht wie immer die elegantesten Kurven, gewinnt dem Plot vom „Verbotenen Buch“ witzig-neue Seiten ab. Dennoch sei hier der Hinweis auf Brian Garfields „Hopscotch“, Charles McCarrys „The Secret Lovers“ und auf P. G. Wodehouse gestattet, der in seinen Büchern immer wieder einen alten Fuchs mit Enthüllungen drohen ließ.
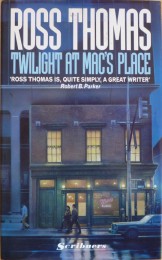 Ein Ausflug in Mac’s Place
Ein Ausflug in Mac’s Place
Nach meinem gefühlt zwölften Artikel über den sardonischen Großmeister des Politthrillers will ich mich dieses Mal endlich einmal auf einem der Barhocker in Mac’s Place niederlassen und ein wenig – Fortsetzung folgt im nächsten CrimeMag – über Alkohol und die Notwendigkeit von Bars in der Kriminalliteratur sinnieren. Mit eigentlich nur wenigen Strichen, äh Sätzen, hat Ross Thomas einen geradezu mystischen Ort der Kriminalliteratur erschaffen: Mac’s Place, die ideale Bar. Nein, Sägemehl wird hier nicht gestreut, kein Billardstock für eine Schlägerei zweckentfremdet, weder über die Theke gekotzt noch allzu sehr am Leben gezweifelt. Mac’s Place ist ein ruhiger und diskreter Ort, dunkel ist es dort und ruhig, die Preise schrecken die jährlichen Pilgerscharen der High-School-Abschlussklassen ab. Aber lassen wir McCorkle selbst erzählen:
„Vor einigen Jahren hatten Padillo und ich eine Kneipe mit Namen Mac’s Place in Bonn am Rhein besessen. Genau genommen war das in Bad Godesberg gewesen, und es hatte einigen Ärger gegeben, bei dem das Lokal in die Luft gesprengt worden war, und dann war Padillo über ein Jahr verschwunden gewesen. Ich hatte geheiratet und in Washington nördlich der K Street und etwas westlich von der Connecticut Avenue eine andere Kneipe eröffnet.
Auch sie hieß Mac’s Place, und noch hatte niemand die in die Luft gesprengt; obwohl es, als Padillo wieder auftauchte, einige Schwierigkeiten mit einem schwarzen Washingtoner Gangster, einem Agenten des Rauschgiftdezernats und dem sterbenden weißen Ministerpräsidenten eines südafrikanischen Landes gegeben hatte, der von Padillo verlangte, er solle ihn durch ein Attentat töten; doch war es nichts, was nicht geregelt werden konnte, ohne daß mehr als drei oder vier Personen dabei ums Leben kamen. Ich träume kaum noch davon.
Manche sagen, Mac’s Place sei inzwischen etwas abgenutzt, aber ich sehe darin lieber ein Anzeichen von Reife. Die Beleuchtung ist angenehm gedämpft, und deshalb kann das Lokal gut als Zuflucht für Leute dienen, die gern mal mit der Frau eines anderen zu Mittag essen oder einen Drink nehmen. Der Service ist schnell, leise und unaufdringlich, die Getränke angemessen gekühlt und vielleicht mehr als großzügig, und wer sich für den jüngsten Klatsch interessiert, kann sich an die Bar setzen und zuhören, wie Karl, der Chefbarkeeper, jeden beliebigen Charakter oder Ruf völlig unvoreingenommen seziert.“ (Die Backup-Männer)
Barkeeper Karl kennt alle im US-Kongress
Dieser Karl, ein Liebhaber alter schöner Autos, den McCorkle „aus Deutschland importiert hatte“, ist ein Politik-Junkie:
„Manche Leute lungern in Polizeirevieren rum. Karl lungerte im Kongreß herum. Er war noch kein Jahr in den Staaten, aber er kannte die Namen der hundert Senatoren und der vierhundertfünfunddreißig Abgeordneten des Repräsentantenhauses und konnte sie in alphabetischer Reihenfolge aufsagen. Er wußte, wie sie bei jeder Abstimmung ihr Votum abgegeben hatten. Er wußte, wo und wann Ausschüsse tagten und ob ihre Sitzungen öffentlich oder geheim waren. Er konnte einem den Status jeder wichtigen Gesetzesvorlage sowohl im Senat wie im Abgeordnetenhaus nennen und mit neunzig bis fünfundneunzig Prozent Sicherheit voraussagen, welche Chancen sie hatten, angenommen zu werden. Er las gewissenhaft die Protokolle des Kongresses und kicherte dabei. Er hatte für mich in einem Lokal gearbeitet, das mir in Bonn gehört hatte, aber der Bundestag hatte ihn nie amüsiert. Den Kongreß fand er zum Totlachen.“ (Gelbe Schatten)
Karl serviert, heißt es an anderer Stelle, „eine schnelle, intelligente Art von Geplauder, das gerade noch keine Verleumdung war“. Er war ein Kriegswaise, spricht Amerikanisch ohne jeden deutschen Akzent, hatte sein Englisch überwiegend vor dem riesigen PX-Laden der Army in Frankfurt aufgeschnappt – den es übrigens bis in die 1980er Jahre hinein real gab.
„Wie sieht unser neuer Laden aus?“, will der lange untergetauchte Padillo schließlich in „Gelbe Schatten“ von McCorkle wissen.
„Hundertzwanzig Plätze, ohne die Bar. Wir haben Karl als Chefbarmann und Herrn Horst als Oberkellner. Wir haben zwölf Kellner, zwei Cocktail-Girls, Abräumer und Küchenpersonal … die Kellner arbeiten in zwei Schichten. Wir öffnen mittags um halb zwölf und schließen um zwei Uhr früh, außer Samstag, wenn wir um Mitternacht zumachen, weil dann unser freier Tag beginnt, an dem wir nicht geöffnet haben.“
„Verdienen wir daran?“
„Nicht schlecht. Die Bücher können wir uns später vornehmen.“
„Wer ist die Klientel?“
„Ich habe die Preise hoch angesetzt, und die Leute sind anscheinend bereit, für den Service und das Essen zu zahlen. Nicht viele Touristen, außer bei Tagungen. Einige von der Presse und Typen vom Capitol Hill, einige Militärs, einige Geschäftsleute und PR-Leute, leitende Angestellte großer Unternehmen, gelangweilte Hausfrauen und eine Menge alter Gäste, die wir schon in Bonn hatten.“
Dass das Lokal dann 1990 noch existiert, liegt „hauptsächlich an einer florierenden Kanzlei von Strafverteidigern, die sich bisweilen in Immobilien versuchten“. 1987 hatten sie ein Konsortium gebildet, um den Grund und Boden unter und neben Mac’s Place zu kaufen, hatten ein siebenstöckiges Gebäude über dem Restaurant errichtet, aber sich „große Mühe gegeben, seine unansehnliche Fassade und seine exzellente Küche zu erhalten.
Wenn sie gefragt wurden, rechtfertigten die Anwälte die extravagante Erhaltung immer mit den Worten: „Wir brauchten ein nettes Lokal in der Nähe zum Mittagessen.“ Es war, wie Mitbesitzer Michael Padillo einmal meint: „Die Art von Laden, wo du hingehst, wenn du mit jemandem verabredet bist und erklären mußt, warum du die Scheidung am Ende doch nicht durchkriegst.“ Herr Horst, der Oberkellner, ist inzwischen 74 Jahre alt, hat die beneidenswerte Haltung eines Drillmeisters und bewegt sich stets langsam auf die Gäste zu, „als führe er eine Prozession von Bischöfen an“.
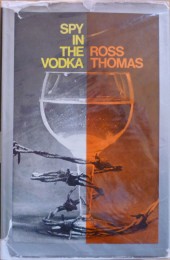 „Ein Spion im Wodka“ – Ross Thomas in England
„Ein Spion im Wodka“ – Ross Thomas in England
Ross Thomas kannte sich ganz zweifellos aus in der Welt der Bars und „social drinks“, viele seiner Figuren wissen zu bechern, Schriftstellerkollege Lawrence Block nannte sie „sehr überzeugende Trinker“. Block, dessen Matthew Scudder sich das Saufen peinvoll abgewöhnt, verbrachte einige Urlaube mit Ross Thomas. In seinem Nachruf „Remembering Ross Thomas“, den er „als Schreiber elegant pervers“ nennt, spricht er auch das Thema Alkoholismus an: Ross Thomas war für ihn die einzige Person, der er 1977 erzählen mochte, dass er das Trinken eingestellt hatte. Postwendend kam ein ermunternder Brief und der Hinweis auf die Vorzüge der Mitgliedschaft in einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker: „Was ich da wirklich mag sind die Geschichten, etwa wenn jemand erzählt, wie er tief abstützte und heute der Chef von IBM ist.“
CrimeMag-Kolumnist Christopher G. Moore hat einmal versucht, die Zahl der konsumierten Drinks in „Kälter als der Kalte Krieg“ zu zählen und – „it defies belief“ – ungläubig aufgegeben. Ein nettes Detail hierzu ist die antiquarisch ziemlich begehrte englische Hardcover-Erstausgabe von „Cold War Swap“: 1967 von Hodder & Stoughton herausgebracht und mit einem Cover von Peter Calcott versehen, trug sie den Titel „Spy in the Vodka“. Die Taschenbuchausgabe von 1968 trug dann wieder den US-Titel „The Cold War Swap“.
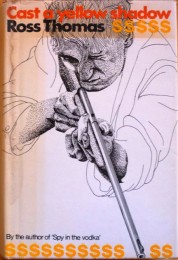 Steve McQueen konnte sich nicht entscheiden
Steve McQueen konnte sich nicht entscheiden
Darauf einen Wodka. Und dazu eine eher unbekannte Ross-Thomas-Anekdote, die den Hinweis verifiziert, den ich auf dem Umschlag der englischen Hardcoverausgabe von „Cast a Yellow Shadow“ fand. Dort hieß es in Bezug auf das Vorläufer-Buch „now being filmed as The Cold War Swap starring Steve McQueen“. Ross und Steve kannten sich tatsächlich, trafen sich öfter, fachsimpelten über Sportwagen, Ross fuhr damals, so verriet John Carmody in einem Artikel der „Watertown Daily News“ vom 7. April 1969 einen weißen 69er Camaro Convertible.
Steve McQueen freilich konnte sich nicht entscheiden, ob er McCorkle oder Padillo spielen solle, wollte dann beide Figuren in eine Person packen – daran scheiterte das Projekt. Einen weiteren Beleg für diese Geschichte fand ich in den Erinnerungen des Filmproduzenten Robert E. Relyea „Not So Quiet On The Set. My Life In Movies During Hollywood’s Macho Era“, der Anfang 1967 in der zusammen mit Steve McQueen gegründeten Firma Solar Productions nach einem würdigen ersten Projekt suchte. Eine Pressekonferenz spülte eine Flut von Drehbüchern und Manuskripten an, aber nichts war gut genug. „McQueen came up with every reason imaginable to reject each script, treatment or novel that crossed our desks.“
Unter den abgelehnten Stoffen war ein netter kleiner Thriller namens „Play Misty For Me“, Steve hatte Bammel, gegen eine vom Skript her solch starke Hauptdarstellerin anzutreten. „Es ist ihr Film“, sagte er, musste sich dann im Kino von Clint Eastwood eines Besseren belehren lassen. Gekauft wurden schließlich die Filmrechte des Kriminalromans „Man on a Nylon-String“ von Whit Masterson, aber McQueen fand wieder ein Haar in der Suppe. Einen Monat später kaufte die Firma die Rechte an „The Cold War Swap“, aber, so Robert E. Relyea: „McQueen wasn’t ready to make that film.“ Über 500 Projekte waren bis dahin verworfen, während der nächsten Monate kamen weitere 500 dazu. Dann nochmal.
Robert E. Relyea: „Over two thousand projects evaluated-and none of them were ‚worthy‘ of being the first Solar film green-lit into actual production. Meanwhile, truckloads of screenplays were sent back to their original address with a standard rejection notice from our office, including one from a wannabe musician-an ex-con named Manson who lived outside of Los Angeles with his ‚family‘ in a place called Spahn ranch.“ Schließlich trat McQueen wieder vor die Kamera: für Norman Jewison und „The Thomas Crown Affair“. Der eigenen Produktionsfirma würdig fand er ein Jahr später dann „Bulitt“.
Fortsetzung folgt
Das hatte jetzt nicht unbedingt mit Trinken & Saufen im Kriminalroman zu tun, aber so ist das mit Gesprächen an der Bar. Abschweifungen erlaubt. Also noch eins drauf: Vor seinem Debüt mit „The Cold War Swap“ wurde Ross Thomas 1966 von dem Kolumnisten Andrew Russell „Drew“ Pearson und dessen Partner Jack Anderson angeheuert, beide einflussreiche und establishmentkritische Washingtoner Journalisten, um aus einer Raubkopie der Bekenntnisse des Mafia-Informanten Joseph Valachi ein 360-Seiten-Buch zu machen. Peter Maas aber war mit seiner Buchversion schneller auf dem Markt, das Manuskript wurde nie veröffentlicht. Ross Thomas fand es dennoch eine prima Erfahrung, er erzählte John Carmody, dass er dabei lernte, wie Mobster reden, und fand in den rund 1000 Seiten der Valachi-Papiere „Stoff genug für sechs oder sieben Romane“.
Nächste Woche: Die durstige Muse: Booze and the crime novel – die Zusammenhänge von Prohibition und der Entstehung der hardboiled novel/ schon bei Dostojewskij wird gesoffen/ auch Perry Mason hat eine Flasche im Schreibtisch/ Hammett und seine Absacker nicht nur im Dünnen Mann/ Chandler als Promotionsagent für den Gimlet/ Inspektor Morse, Rebus, Dave Robicheaux und Clete Purcell, Charlie Resnick, Harry Hole und eine Legion anderer Trinker vor dem Herrn/ James Crumley und der hier unübersetzt gebliebene Rotweinsüffler Gabriel Du Pre von Peter Bowen/ Robert Mitchum zugedröhnt bis zur Halskrause in „Tote schlafen besser“ … u.v.m. … till „The Sacred Ginmill Closes“ (Larry Block).
Ich trat an die Bar und schenkte mir einen Drink ein. „Wie wäre es mit einem Absacker?“ (Gelbe Schatten, Seite 183)
… will be continued
Alf Mayer
Die Mac McCorkle- und Michael Padillo-Romane von Ross Thomas
The Cold War Swap (1966)
Kälter als der Kalte Krieg: Ein McCorkle-und-Padillo-Fall. Durchgesehen und überarbeitet von Gisbert Haefs und Anja Franzen. Berlin: Alexander Verlag, 2007. Erste vollständige deutsche Ausgabe. 265 Seiten. 14,90 Euro. Zuvor als Der Ein-Weg-Mensch. Deutsch von Wilm W. Elwenspoek. Ullstein 1969.
Cast a Yellow Shadow (1967)
Gelbe Schatten: Der 2. McCorkle-und-Padillo-FAll. Deutsch von Wilm W. Elwenspoek, Stella Diedrich und Gisbert Haefs. Berlin: Alexander Verlag 2012. Erste vollständige deutsche Ausgabe. 283 Seiten. 14,90 Euro. Zuvor als Der Tod wirft gelbe Schatten. Deutsch von Wilm W. Elwenspoek. Ullstein 1970.
The Backup Men (1971)
Die Backup-Männer: Ein McCorkle-und-Padillo-Fall. Deutsch von Wilm W. Elwenspoek, Heinz F. Kliem und Jochen Stremmel. Berlin: Alexander 2012. Erste vollständige deutsche Ausgabe. 243 Seiten. 14,90 Euro. Zuvor als Was ich nicht weiss, macht mich nicht kalt. Deutsch von Wilm W. Elwenspoek und Heinz F. Kliem. Ullstein 1972.
Twilight at Mac’s Place (1990)
Dämmerung in Mac’s Place: Ein McCorkle-und-Padillo-Fall. Polit-Thriller. Deutsch von Bernd Holzrichter. Berlin: Alexander Verlag 2013. Erste vollständige deutsche Ausgabe. 391 Seiten. 14,90 Euro. Zuvor als Letzte Runde in Mac’s Place. Deutsch von Bernd Holzrichter. Ullstein 1994.











