Bloody Chops im März 2016
– Heute am Hackklotz: Zoë Beck (ZB);Katja Bohnet (kb); Anne Kuhlmeyer (AK); Joachim Feldmann (JF); Sonja Hartl (SH); Alf Mayer (AM); Thomas Wörtche (TW) – über Don Winslow, Alfred Bodenheimer, Olaf R. Dahlmann, Franzobel, Charlotte Otter, Michael Bar-Zohar und Nissim Mischal, Christiane Dieckerhoff, Ana Paula Maia, Joe R. Lansdale, Helmut Müller-Enbergs, Armin Wagner, Alfred W. McCoy, Tom Cooper und Norman Lewis.
 Frankie goes in den Puff
Frankie goes in den Puff
(TW) So kann´s gehen, vom Top-Act zur Marginalie: Don Winslows neues Buch „Germany“ ist noch nicht mal mehr ein Aufreger, sondern nur noch unfreiwillig komisch. Sein aktueller Serienheld Frank Decker, der vermisste Menschen aufspürt, lässt sich von einem Ex-Marine Kumpel anheuern, um dessen verschwundene Gattin zu finden, die er in den Fängen böser Gangster wähnt, die diesen Engel in Menschgestalt der Zwangsprostitution zuzuführen drohen. Oder so. Deswegen muss Decker quer durch Deutschland (ein riesiges Bordell, könnte man meinen) reisen, unter anderem in die Zentren des Organisierten Verbrechens hierzulande wie Saarbrücken, Lüneburg und Erfurt.
Dabei stellt sich heraus, dass Frauen, besonders schöne und kluge, betrüblicherweise fiese, eiskalte Schlampen sind. Verbrecher sind, neben ein paar eher benevolenten schwarzen Gangstas, vornehmlich Russen und Ukrainer. Reiche Leute feiern Orgien und sind ganz böse. Ex-Marines sind treu, semper fi, jaja. Außer sie sind reich, dann siehe oben. Ex-Marines töten die Bösen rudelweise und ganz alleine. Und weil Decker auch haufenweise Böse umbringt und ein wenig foltert, muss er sich mantraartig andauernd fragen, ob er auch böse sei. Ist er aber nicht, weil man Böse eigentlich nur umbringen und ein wenig foltern kann, wenn man das Herz auf dem rechten Fleck trägt. Man muss eben gemein sein, wenn man Gutes tut, das ist alternativlos. Und wenn man die amerikanische Kleinstadt als normativen, wenn auch ein bisschen langweiligen Wertmaßstab hat.
Das Ganze ist so hochauflösend, überraschend, originell, unvorhersehbar, klischeefrei, stimmig geplottet, virtuos und blauäugig erzählt, dass es früher glatt als Heftchenroman durchgegangen wäre. Aber eins muss man Winslow lassen: Man kann vor lauter Fassungslosigkeit nicht aufhören, das Teil auf einen Happs durchzulesen.
Don Winslow: Germany (kein O-Titel). Roman. Deutsch von Conny Lösch. München: Droemer 2016. 379 Seiten. 14,99 Euro.
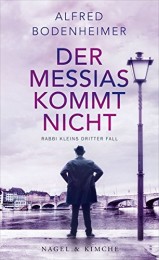 Rabbi Klein muss ran
Rabbi Klein muss ran
(JF) Die Älteren unter uns werden sich noch an Rabbi David Small erinnern, der in seiner kleinen Gemeinde an der amerikanischen Ostküste zum Detektiv wider Willen wird. Und ein erfolgreicher obendrein, dabei helfen ihm seine Erfahrungen beim akribischen Studium des Talmud. Elf Romane, die auch hierzulande sehr erfolgreich waren und seit dem vergangenen Jahr im Union-Verlag neu aufgelegt werden, hat der 1996 verstorbene Harry Kemelman seinem Amateurermittler gewidmet. Es dürfte kein Zufall sein, sondern als Reverenz an ein großes Vorbild verstanden werden, dass Alfred Bodenheimer seinem Helden den Namen Gabriel Klein gegeben hat. Schon zum dritten Mal verstrickt der Professor für Jüdische Literatur- und Religionsgeschichte an der Universität Basel den fiktiven Zürcher Rabbi in einen Mordfall.
Eigentlich hatte Klein ja vor, während seiner halbjährigen Pause von der Seelsorge wissenschaftlich tätig zu sein, doch dann kommt die Anfrage, ob er nicht vertretungsweise den Basler Gemeindeschabbat leiten möge. Schon bald bereut er die rasche Zusage, und dies umso mehr, als an just diesem Wochenende eines der Vorstandsmitglieder erschossen wird. Im Unterschied zu anderen Amateurdetektiven ist Rabbi Klein gar nicht erpicht darauf, der Polizei ihre Arbeit abzunehmen, doch als der leitende Kriminalist ihn um Unterstützung angeht, sagt er nicht nein. Verdächtige gibt es mehrere, doch die Wahrheit liegt, wie man es erwarten darf, jenseits der Vorstellungskraft der beamteten Ermittler. Der Rabbi andererseits versteht es, auch die kleinsten Hinweise, die ihm der Zufall in die Hände spielt, ernst zu nehmen und zu einer plausiblen Lösung zu verbinden. Dass er dann doch wieder „alles vermasselt“, ist erstens so nicht richtig und zweitens ein sympathischer Charakterzug. Die überraschende Volte, mit der Bodenheimer seinen Roman enden lässt, darf man als Aufforderung verstehen, über das Thema „Gerechtigkeit“ nachzudenken, von der es, glaubt man der Täterfigur, eben doch „ein bisschen“ gebe.
Alfred Bodenheimer: Der Messias kommt nicht. Rabbi Kleins dritter Fall. Zürich. Nagel und Kimche: 2016. 206 Seiten. 19,90 Euro.
Wer Gutes will …
(JF) Der Heimatstadt durch großzügiges Mäzenatentum Gutes tun, dem raffgierigen Staat aber durch ein geschickt gewobenes Netz von Stiftungen und Scheinfirmen seinen Pflichtteil vorenthalten: Mit dieser Praxis ist die hanseatische Unternehmerfamilie Koppersberg jahrzehntelang bestens gefahren. Doch die schöne Zeit nimmt ein jähes Ende, als ein gedungener Killer einem Liechtensteiner Anwalt eine Kugel in den Kopf schießt und sämtliche Akten aus der Kanzlei entwendet. Hinter dieser unfeinen Aktion steckt, wie sollte es anders sein, ein Erpresser. Angetrieben von einem fanatischen Hass auf Steuerhinterzieher, plant er einen privaten Rachefeldzug, der ihm so ganz nebenbei die eigenen Taschen füllen soll. Von all dem weiß die junge Rechtsreferendarin Katharina Tanzer nichts, als sie ihre Ausbildung beim renommierten Hamburger Steueranwalt Friedemann Hausner, der auch die Koppenbergs vertritt, beginnt. Doch schon bald ist sie mittendrin im turbulenten Geschehen und muss, da der Chef nach einem Unfall außer Gefecht gesetzt ist, selbst die Initiative ergreifen. Aber das ist lebensgefährlich. Denn nicht nur der unbekannte Erpresser geht über Leichen, auch manche Mitarbeiter des Bundeszentralamts für Steuern kennen keine Skrupel, wenn es darum geht, ihrem Dienstherrn vorenthaltene Millionen zu sichern.
Erfunden hat diesen in mancherlei Hinsicht gar nicht so abwegigen Plot ein Rechtsanwalt mit dem Arbeitsschwerpunkt Steuerrecht. Nun gut, so ganz hat er der Thrillertauglichkeit des Fiskalwesens nicht getraut und wartet mit Mord auf, wo es auch der schlichte Diebstahl der entsprechenden Daten getan hätte. Zudem unterliegt Olaf R. Dahlmann, der mit „Das Recht des Geldes“ sein Debüt gibt, offenbar dem Glauben, dass ein Kriminaloman umso interessanter wird, je mehr man aus dem Privatleben der Figuren erfährt. Und ich befürchte, dass viele Leser ihm da Recht geben werden. Wer Redundanzen schätzt und bei der Lektüre nicht ständig versucht ist, den imaginären Rotstift zu zücken, wird mit den mehr als 350 Seiten dieses Schmökers sicher seinen Spaß haben.
Olaf R. Dahlmann: Das Recht des Geldes. Kriminalroman. Dortmund. Grafit 2016. 377 Seiten. 12,00 Euro.
 Routiniert und brachial
Routiniert und brachial
(JF) Er sieht nicht aus wie ein Kriminalkommissar, sondern eher wie ein Provinzkünstler, Restaurantkritiker oder Weinhändler. Das meint zumindest der Mann, dem wir diese, für das Genre durchaus typische, Ermittlerfigur zu verdanken haben. Bereits zum zweiten Mal schickt der österreichische Schriftsteller Franzobel den 45-jährigen Wiener Kriminalisten Falt Groschen auf Mörderjagd. Eine greise Pornoautorin hat es in den eigenen vier Wänden erwischt. Ebenfalls dran glauben mussten eine abgehalfterte Schauspielerin und ein Prominentenschneider. Dass die drei Fälle miteinander verknüpft sind, ist zunächst nur eine Ahnung des griesgrämigen Kommissars, wird aber im Laufe der kunterbunten Handlung zur Gewissheit. Die Spur führt zurück in jene bewegten Zeiten, als es galt, das bürgerliche Subjekt von Zwängen und Sexualneurosen zu befreien. Wer sich hier an die berüchtigten Sozialexperimente des vormaligen Aktionskünstlers Otto Mühl (1925-2013) in seinen diversen Kommunen erinnert fühlt, liegt nicht ganz falsch. Wirklich wichtig ist das allerdings nicht, geht es doch vor allem darum, die genrekonforme Auflösung des Falles hinreichend zu unterfüttern.
Franzobel erweist sich in „Groschens Grab“ als routinierter Spannungsautor mit einem Sinn für Brachialkomik. Auch betagteren Witzen wird hier wohlwollend Aufnahme gewährt. Und das hat, wider Erwarten, einen beachtlichen Unterhaltungswert.
Franzobel: Groschens Grab. Kriminalroman. Wien. Zsolnay: 2015. 285 Seiten. 17,90 Euro.
Zu wenig Raum für Grautöne
(JF) Dass Literatur zum Medium politischer Aufklärung taugt, scheint, zumindest was den Kriminalroman angeht, unumstritten. Spannend zu unterhalten und gleichzeitig kritisch über gesellschaftliche Missstände zu informieren, ist das legitime Anliegen vieler Autorinnen und Autoren. Die Ergebnisse sind allerdings nicht immer ästhetisch überzeugend und damit auch politisch zweifelhaft. Wenn die Welt säuberlich in Gut und Böse eingeteilt wird, bleibt für die interessanten Grauzonen menschlichen Zusammenlebens wenig Raum.
„Karkloof Blue“, Charlotte Otters zweiter Südafrikakrimi über die mutige Reporterin Maggie Cloete, kommt diesem identifikationsfördernden Schematismus bedenklich nahe. Auf der dunklen Seite haben wir geldgierige Industrielle und gewissenlose Lakaien des verflossenen Apartheidregimes, während sich die Kräfte des Lichts um die aufrechte Zeitungsfrau scharen. Dass diese sich vorwirft, ihren psychisch derangierten Bruder nicht genügend unterstützt zu haben, macht sie nur noch sympathischer. Und da sich die Autorin darauf versteht, eine wendungsreiche Handlung zu konstruieren, liest man das Buch nicht ungern, zumal die zahlreichen Informationen über die sozio-ökonomische Situation im heutigen Südafrika das Gefühl vermitteln, hier gehe es nicht nur um ein spannendes Lektüreerlebnis. Aber wie ernst ist das politische Anliegen eines Kriminalromans zu nehmen, dessen Epilog suggeriert, es reiche den Mann an der Konzernspitze auszuwechseln, damit aus Umweltfrevlern edle Naturschützer werden? Wahrscheinlich weiß Charlotte Otter wie ihre Heldin, dass „der alte Teufelskreis von Geheimhaltung und Korruption durchbrochen werden“ muss, damit die Bösen ihre gerechte Strafe bekommen. Das ist eine ehrenwerte, aber wenig realistische Hoffnung, auch was den Fortgang der Reihe angeht. Denn irgendwoher müssen die Fälle für das Detektivbüro, das Maggie Cloete aufmachen möchte, nachdem sie ihren Zeitungsjob gekündigt hat, ja kommen.
Charlotte Otter: Karkloof Blue. Kriminalroman. Deutsch von Katrin Kremmler und Else Laudan. Hamburg. Ariadne Krimi im Argument Verlag 2016. 288 Seiten. 13,00 Euro. E-Book bei Culturbooks
 Fanboy-Prosa
Fanboy-Prosa
(ZB) Nun ist es ja so, dass man Büchern über Geheimdiensten ungefähr so sehr trauen sollte und kann, wie den Geheimdiensten selbst. Die Faktenlage lässt sich nur teilweise überprüfen, wobei, sicher sein kann man sich eigentlich bei nur sehr wenigem, und bei diesem Buch über den Mossad, das 2010 im Original erschien und dadurch auch schon recht unaktuell ist und eher historisch gelesen werden muss, hat auch erst eine, nun, Absegnung durch entsprechende Stellen stattgefunden. Dies im Hinterkopf lässt sich feststellen, dass die Sammlung an Geschichten über den israelischen Geheimdienst doch interessant ist. Die Eichmann-Entführung, die Folgen des Olympia-Attentats von 1972, die irakische Atompolitik …
Wie gesagt, all das ist interessant zu lesen, wenngleich stilistisch nah am Unerträglichen, weil sämtliches Personal beschrieben wird wie in einem klischeestrotzenden Agententhriller. Die Mossad-Spione sind durchweg geniale Burschen, die Beschreibung der Einsätze mit eingestreuten Dialogen wirkt unfreiwillig komisch, und auch wenn die beiden Autoren des Buchs auf Fehlschläge und Niederlagen des Geheimdienstes hinweisen, fehlt vollkommen eine kritische Auseinandersetzung mit ebendiesen Aktionen. Klar ist, wer gut (Mossad) und wer böse (im Zweifel alle anderen) ist, ob die Autoren so schreiben wollten (vermutlich) oder mussten (vielleicht auch ein bisschen), sei dahingestellt, der Text ist, wie er ist. Faktenreich und informativ sicherlich, aber diese Heldenprosa aus Fanboy-Perspektive ist für ein Sachbuch, um es nett zu sagen, anstrengend.
Michael Bar-Zohar und Nissim Mischal: Mossad: Missionen des israelischen Geheimdienstes. Übersetzt von Katrin Harlaß. Bastei Lübbe (Quadriga), 2015. 512 Seiten. 19,99 Euro.
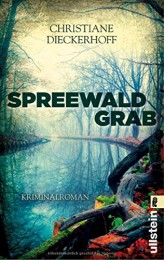 Neues im Konventionellen
Neues im Konventionellen
(AK) Über „den Regio-Krimi“ ist genug geschrieben und geschimpft worden, häufig zu Recht. Doch Etiketten sind heikel, dienen sie sowohl der Orientierung als auch dem Vorurteil. Deswegen sollte man sich das Einzelne gelegentlich genau ansehen.
„Spreewaldgrab“ ist ein konventionell angelegter Krimi mit Handlungsort, wie der Titel verrät, im Spreewald – Fließe, Kähne, Fachwerk, Idylle, die Legende über die Entstehung des Spreewalds zur Illustration. Der Roman beginnt mit einer Szene von Gefangenschaft, nichts Neues für den routinierten Leser. Aber die Frau, die da namenlos im Verließ vegetiert, wird nicht einfach vergessen, um sie, objektiviert wie in vielen Krimis, am Schluss zu retten oder sterben zu lassen, sondern bekommt eine Stimme, besser gesagt: viele Stimmen.
Plastisch und eindrücklich stellt die Autorin das Phänomen der Dissoziation dar, diesen „Trick“ der Seele, der es dem Individuum ermöglicht, Lebensgefahr zu überleben. Überhaupt gelingen Christiane Dieckerhoff wunderbar komplexe Charaktere. Der „Halbvietnamese“ Thang zum Beispiel, der seine Rachewünsche nach erlittener Ausgrenzung kanalisiert, in dem er Polizist wird, an seiner Seite eine Frau mit Bing Eating Disorder. So kenntnisreich und detailliert, wie anschaulich und plausibel zeigt die Autorin die sozialen Auswirkungen der Esssucht in dieser Nebenfigur. Schmerz und Wut unter dem Fettmantel der Frau werden spürbar. Keine Didaxe, gleich gar keine Häme.
Oder die Neue, Klaudia Wagner aus dem Ruhrpott, die im Mord eines Unternehmers ermittelt, während die Menièresche Erkrankung ihr den Boden unter den Füßen schwanken lässt, der ohnehin instabil ist, nachdem ihr Freund sie austauschte.
Es sind die bildstark und mitfühlend erzählten Beobachtungen des menschlichen Soseins, die den ersten Roman der geplanten Reihe zu etwas Besonderem in der Flut der „Regio-Krimis“ machen. Mühsam, aber lohnenswert ist es, Etiketten abzukratzen.
Christiane Dieckerhoff: Spreewaldgrab. Kriminalroman. Ullstein Berlin, 2016. 352 Seiten. 9,99 Euro.
 Pulp Rio Love
Pulp Rio Love
(kb) Anstatt diese Kurzbesprechung zu lesen, greifen Sie doch lieber direkt zu der Mordnovelle, die nur unwesentlich länger ist und nach dem verdienstvollen Erscheinen im A1 Verlag (CrimeMag dazu hier) nun als Taschenbuch vorliegt. Auf 232 Seiten nimmt die Autorin ihre Leser mit auf einen schrillen Trip. Menschen werden überfahren, abgeknallt, jemand spaltet ihnen den Kopf oder schlägt ihnen die Visage zu Brei. Derweil fressen sich Termiten durch ein marodes Gebäude. Seien Sie versichert: Genauso wie die gesellschaftlichen Zustände im stickigen Rio wird es nicht lange halten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Kleine oder große Ganoven, andere Lebensformen gibt es nicht.
McGuffin ist eine Tasche mit Dope. Alle wollen sie, aber das Ding ist weg. Ein semi-ambitionierter Pornodarsteller stahl sie in einem günstigen Moment. Da kommt es überraschend, dass eine vermeintliche Hauptfigur auf Seite 70 leider schon ihr Leben lassen muss. Autounfall. Schade. Aus. Man kennt das ja aus „Game of Thrones“. Die schräge Story will nicht ganz in Fahrt kommen, bis der Leser auf Seite 100 endlich die Protagonistin kennenlernt: Gina, eine sexy Preisboxerin, die gern auch einem Mann die Lichter ausknipst. Aber sie ist verstrickt, verschuldet bei einer Veranstalterin mit nur einem Bein. Das andere, künstliche, verbirgt süße Geheimnisse. Wer „Pulp Fiction“ liebt, erkennt die Anleihen. Hier wird nicht tief geschürft, dafür schnell und skurril. Ein Menschenleben bedeutet nicht viel in dieser Welt, aber kleine Hunde kommen sehr gut weg. Killer haben eben auch ein Herz. Ana Paula Maia lässt es richtig krachen, und das geht runter wie der erste feuchte Zungenkuss.
Ana Paula Maia: Krieg der Bastarde (A guerra dos bastardos, 2007) Roman. Deutsch von Wanda Jakob.(Deutsche Erstausgabe A 1 Verlag, 2013.) Droemer Taschenbuch, München 2016. 240 Seiten. 9,99 Euro.
 Blut und Sprüche
Blut und Sprüche
(SH) Während in den USA gerade die ersten Folgen von „Hap & Leonard“ im Fernsehen zu sehen sind, ist hierzulande der zweite Teil der Reihe von Joe R. Lansdale wieder erhältlich. Die Bücher um den weißen, heterosexuellen Kriegsdienstverweigerer Hap Collins und den schwarzen, schwulen Vietnam-Veteran Leonard Pine haben eine abenteuerliche Publikationsgeschichte hinter sich: Rowohlt veröffentlichte in den 1990er Jahren den zweiten und dritten Teil der Hap-Leonard-Reihe, der vierte Teil erschien dann im Rahmen von Dumont Noir, ehe 2006 bei Shayol, einem Vorläufer des Golkonda-Verlags, der erste Teil herausgebracht wurde. Bei Golkonda erscheint nun nach der Neuauflage des Auftakts „Wilder Winter“ auch „Mucho Mojo“ mit durchgesehener Übersetzung erneut.
Die aus dem ersten Teil resultierende Verletzung von Leonards Bein ist noch nicht abgeklungen, da steht er mit Krücken am Rand des Rosenpflückerfeldes im Osten Texas – dem Lansdale-Universum –, auf dem Hap gerade arbeitet: Sein Onkel Chester ist verstorben, Hap soll ihn zur Beerdigung begleiten. Seit Leonard seinem Onkel gesagt hat, dass er homosexuell sei, wollte Chester keinen Kontakt mehr mit ihm haben, was er nie verwunden hat. Nun muss Leonard verwundert zur Kenntnis nehmen, dass Chester ihm nicht nur sein baufälliges Haus in der Nachbarschaft einer Crack-Höhle, sondern auch eine beträchtliche Summe Geld, ein Bild, Rabattmarken, einen Schlüssel zu einem Bankschließfach und eine Kinderleiche unter den Hausdielen hinterlassen hat.
Der Plot ist – wie in „Wilder Winter“ – nicht gerade raffiniert, aber die Dynamik des ‚Desaster-Duos’, die gewitzten Dialoge und die mit viel Blut, etwas Sex sowie einem Schuss Horror gewürzte Gesellschaftskritik sind allemal unterhaltsam. Als Serienvorlage (gerade im Entstehen) ist dieses Buch daher ebenso gut geeignet wie Michael K. Williams („The Wire“) als Besetzung von Leonard.
Joe R. Lansdale: Mucho Mojo (Mucho Mojo, 1994). Übersetzt von Christoph Schuenke. Golkonda 2015. (Erstausgabe als „Texas Blues“, 1996, Rowohlt Verlag.)
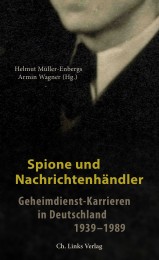 Zweite Reihe, erste Güte
Zweite Reihe, erste Güte
(AM) Daran werden wir uns erst gewöhnen müssen, dass solch ein interessantes Forschungsfeld einen Dammbruch erfährt. Ab Herbst 2016 ist es soweit, wenn die offiziell eingesetzte Unabhängige Historikerkommission ihre Ergebnisse in Sachen Erforschung der BND-Geschichte veröffentlichen wird. Parallel dazu sind eine Biographie des Geheimdienstchefs Reinhard Gehlens, eine Geschichte des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) und eine Studie zur Geschichte der Hauptabteilung II des Ministeriums für Staatssicherheit, der Spionageabwehr der DDR, zu erwarten. Im Vorgriff auf all dies nun dieser fulminante „Panoramaband“, in dem elf Historiker „Lebensläufe der zweiten Reihe“ aus der Zeit des Kalten Krieges aufblättern und einer deutsch-deutschen Geheimgeschichte sozusagen „Gesicht“ geben.
Die ausführlich porträtierten neun Männer und eine Frau stehen beispielhaft für die Idealisten und Pragmatiker des nachrichtendienstlichen Geschäfts, für politisch Überzeugte wie für zufällig Anheimgefallene. Unter ihnen sind nicht nur klassische Spione, sondern auch freie Nachrichtenhändler, Ministerialbeamte, Spezialisten für Subversion und Propaganda. „Zehn Beobachtungen zum Zeitalter der Extreme“ überschreiben die Herausgeber das Nachwort dieser informationsreichen Politik- und Kulturgeschichte der anderen Art. Die Wirklichkeit ist eben oft spannender als alle Fiktion, zumal es in Sachen Bundesnachrichtendienst eigentlich nur „Mister Dynamit“ gab, den BND Agenten Nummer 18, Bob Urban, Held einer zwischen 1965 und 1992 auf 329 Bände gewachsenen Romanreihe. Aber das ist eine andere Geschichte.
Helmut Müller-Enbergs, Armin Wagner (Hg.): Spione und Nachrichtenhändler. Geheimdienst-Karrieren in Deutschland 1939-1989. Ch. Links Verlag, Berlin 2016. 11 Abb., 376 Seiten, 25 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
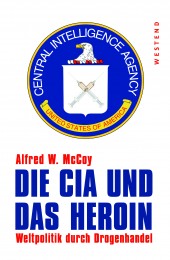 Standardwerk, wieder zugänglich
Standardwerk, wieder zugänglich
(AM) Der Frankfurter Westend-Verlag beweist sich nach dem „CIA-Folterreport“ und James Risens „Krieg um jeden Preis“ (CM-Besprechungen hier und hier) erneut als beachtlicher Player im Feld der – früher hätte man gesagt, anti-imperialistischen – Politikanalyse, stellt jetzt mit Alfred W. McCoys Klassiker „Die CIA und das Heroin. Weltpolitik durch Drogenhandel“ eine grundlegende Lektüre in Sachen „War on Drugs“ zu Verfügung, aus der auch ein Don Winslow für „Power of the Dog“ (Tage der Toten) und „Kartell“ geschöpft hat. Erstmals 1972 erschienen, damals vor Ort in Südostasien recherchiert und über die letzten 40 Jahre immer wieder überarbeitet und ergänzt (etwa 2003 im Verlag Zweitausendeins), ist dies schlicht „das“ Standardwerk zum internationalen Drogenkrieg. Später hinzugekommene Kapitel befassen sich mit der Rolle der CIA in Latein- und Südamerika und Afghanistan.
Für Alfred William McCoy, Professor für südostasiatische Geschichte, ist es ein Lebenswerk. Eine zehnjährige Dozentur in Australien nutzte er beispielsweise für Recherchen zum organisierten Verbrechen zum Drogenhandel down under. Sehr genau beschreibt er in seiner umfassenden Studie, was er als „staatlich verdeckte Unterwelt“ bezeichnet – mit klandestinen sozialen Milieus, einem illegalen ökonomischen Nexus und einer Politik, die all dies möglich macht. Eines seiner neueren Bücher übrigens untersucht die Foltermethoden der CIA und deren Geschichte, zieht eine Linie vom Kalten Krieg zum Krieg gegen den Terror.
Alfred W. McCoy: Die CIA und das Heroin. Weltpolitik durch Drogenhandel (The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade. Afghanistan, Southeast Asia, Central America, Colombia; 2003). Westend-Verlag, Frankfurt 2016. 760 Seiten, 24 Euro.
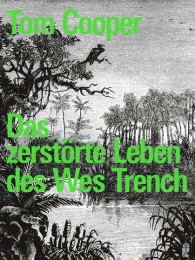 Nicht nur außen gut
Nicht nur außen gut
(AM) Oft genug gibt es ja Anlass genug, die hiesige Präsentationspolitik von Kriminalliteratur zu kritisieren – eine grundsätzliche Untersuchung alleine etwa der Optik steht aus (Judge a book by its cover) -, aber es gibt auch die positiven Ausnahmen. Wer die amerikanische Originalausgabe von „The Marauders“ (Crown, 2015) kennt, kann sich nur freuen, was Ullstein aus der läppischen US-Vorlage gemacht hat. Ein Bravo nach München an das (mir nicht bekannte) Büro Jorge Schmidt für die Umschlaggestaltung. So macht man Wertigkeit. Auch das Giftgrün zum Entree ist prima. Da lasse ich sogar mit dem Titel handeln: „Das zerstörte Leben des Wes Trench“ hieß im Original schlicht „The Marauders“, was man gut mit „Die Freibeuter“ übersetzen könnte. Wir sind am Golf von Mexiko, in den Bayous von Lousiana, in James-Lee-Burke Territorium.
Die Blurbs der US-Ausgabe waren phänomenal: Stephen King, Donald Ray Pollock, Robert Olen Butler, Richard Lange und Nic Pizzolatto. Ullstein verkürzt auf „True Detective“-Autor Pizzolatto, streicht ihn arg zusammen, schummelt auch ein wenig. Aus einer „severely beleaguered nature“ wird eine „alles beherrschende Natur“. Nee, die ist von Hurrikan Kathrina und der Ölkatastrophe der Bohrplattform Deepwater Horizon schwer angeschlagen, was die bunte Schar der Roman-Charaktere zu teils recht verzweifelten Freibeutern macht. Stoff für „Country Noir“ zuhauf, wie Thomas Wörtche das in seinem „Leichenberg“ exemplifiziert hat.
Tom Cooper, bisher nur mit Shortstories aufgefallen, zollt in seinem überbordenden Erstling dem Noir seinen Respekt – etwa mit einem Gerichtsmediziner namens Dr. Woodrell – aber er haucht den Protagonisten derart anarchische Widerstandskräfte ein, dass die Erzählung sich freischwimmt in eigene Gewässer. „Angetrieben“, um Pizzalotto vollständig zu zitieren, „von wunderbaren Charakteren, die mit Anmut, Würde und dem seltensten der Talente gezeichnet sind: mit wirklich urkomischem Witz. Mr. Cooper befindet sich in Gesellschaft von Meistern wie Mark Twain und Charles Portis, wenn er der den Humor der Freak Show des amerikanischen Südens dazu nutzt, von den universellen Werten des menschlichen Herzens zu erzählen.“ Also, nicht nur guter Umschlag, sondern auch drinnen richtig gutes Buch.
Tom Cooper: Das zerstörte Leben des Wes Trench (The Marauders, 2015). Übersetzt von Peter Torberg. Ullstein, Berlin 2016. 384 Seiten, 22 Euro.
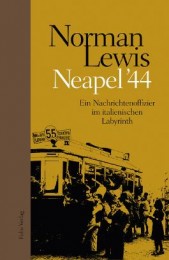 Wiederauftritt eines großen Autors
Wiederauftritt eines großen Autors
(AM) Norman Lewis (1908 – 2003) war für eine gewisse Zeit der einzige Thrillerautor, der Eric Ambler das Wasser hätte reichen können. Sein „A Suitable Case for Corruption“ von 1964 kreiste um einen Plot, Oberst Gaddafi zu ermorden, „Darkness Visible“ erzählte von amerikanischen Ölfirmen und ihren Machenschaften in Algerien, „The Volcanos Above Us“ von einer Revolution in Guatemala, „The Missionaries“ (1988) wurde zu einer Filmvorlage für Robert deNiro. Sein wahres Metier freilich war der Reisebericht und war der Blick auf Gesellschaften im Umbruch. „Spanish Adventure“ (1935) seinem ersten Buch, folgten mehr als 35 weitere. Seine Biographie ist die eines Jahrhundert. Norman Lewis war an vielen Fronten, in vielen Winkeln. „A Dragon Apart“ von 1951 ist der beste Bericht über Indochina vor dem Vietnamkrieg, gefolgt von 1952 von „Golden Earth“ über Burma. Das elegische „Voices of the Old Sea“ (1984) erzählte von seinen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in einem spanischen Fischerdorf, bevor der Tourismus die ganze Küste verunstaltete. Lewis‘ erste Frau war Schweizer-Sizilianerin, das sizilianische Leben, die Mafia inklusive, war eines seiner großen Themen. „Die ehrenwerte Gesellschaft. Die Geschichte der Mafia“ von 1964 wurde einer der ersten tiefen und kundigen Einblicke in den Mafia-Komplex.
Norman Lewis zu lesen ist ein Lesegenuss, beste britische, halb distanzierte, verhalten ironische, feinst beobachtende Zeitzeugenschaft. Graham Green hielt ihn für einen der größten Schriftsteller. So trocken und treffend wie Norman Lewis zu schreiben, das ist wahrlich Kunst. Zuletzt 1995 in deutscher Übersetzung aufgelegt, macht der Folio Verlag aus Bozen nun „Neapel 44“ wieder zugänglich, dies in einer schönen, bestens als Geschenk geeigneten Ausgabe. Lewis führte vom Herbst 1943, der Landung der alliierten Truppen bei Salerno, bis zum Herbst 1944 Tagebuch über seine Zeit als Nachrichtenoffizier in Neapel. So haben Sie noch nie über Schwarzmarkt gelesen. Oder über eine Stadt in Kriegszeiten. Oder über Neapel. Eines der ganz großen Bücher über den Zweiten Weltkrieg, ganze 238 Seiten stark. Bärenstark.
Norman Lewis: Neapel ’44 (Naples ’44, 1978). Ein Nachrichtenoffizier im italienischen Labyrinth. Aus dem Englischen von Peter Waterhouse. Folio Verlag, Bozen 2016. 240 Seiten, 22,90 Euro.













