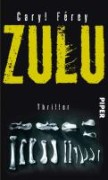 Postkoloniale Gewalt oder Das Überleben der Apartheid
Postkoloniale Gewalt oder Das Überleben der Apartheid
Afrika beziehungsweise Südafrika sind kriminalliterarische Boom-Themen, auch bei uns. Gut für manche Bücher, die ohne diesen Rückenwind vermutlich keine Chancen gehabt hätten. Was wiederum schlecht gewesen wäre. Elfriede Mueller stellt einen solchen Fall vor.
Der 2008 in Frankreich erschienene roman noir musste zwei Jahre warten, bis er zum „Thriller“ degradiert kurz vor der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika auf Deutsch erscheinen durfte. Caryl Férey schreibt in der Tradition des Post-68er-Kriminalromans von Jean-Patrick Manchette, Jean-Bernard Pouy, Dominique Manotti und anderen, auch wenn er erst 1967 geboren wurde. Politik und Verbrechen, gespickt mit Psychoanalyse, Gesellschaftskritik und manchmal beißendem Witz, bestimmen seine Bücher. Zwölf Romane hat er bisher geschrieben, drei mit dem Serienhelden Mc Cash. Zulu ist sein erster auf Deutsch übersetzter Krimi, dem sicherlich andere folgen werden. Momentan arbeitet Férey an einem Buch über die Militärdiktatur in Argentinien. Für Zulu hat er fast alle französischen Krimipreise abgeräumt.
Die Gewalt in Südafrika stellt Férey in einen politischen Kontext. Er geht dabei der Frage nach, warum die erste afrikanische Demokratie zum gefährlichsten Land der Welt geworden ist. Sein Held Ali Neumann, ein Zulu, flieht als Kind vor den Milizen der Inkatha, die sich im Krieg mit dem noch illegalen ANC befindet. Sein Vater wurde ermordet, er stark misshandelt. Von diesem Ereignis wird er sich nicht mehr erholen, es bestimmt sein Leben, es hat ihn impotent gemacht. Neumann wird Chef der Kriminalpolizei von Cape Town und kämpft im demokratischen Südafrika gegen die Überreste der Apartheid, 15 Jahre nach deren Ende. Die Tochter eines Rugbychampions wird ermordet, seine fast blinde Mutter im Township überfallen, in dem sie seit Jahren lebt.
Der Plot kreist um chemische Drogen, Flüchtlinge aus der Subsahara, unermessliche Gewalt (50 Morde am Tag), Aids (20 Prozent der Bevölkerung ist HIV-positiv) und großes Leid. Brian Epkeen, ein Afrikaaner, der gegen die Apartheid aktiv war, und Dan Fletcher sind Neumanns Kollegen, die am Aufbau einer neuen Polizei mitarbeiten, einer Polizei, die den Opfern gerecht werden will. Epkeen war vorher Privatdetektiv im Kampf gegen seinen Vater und auf der Suche nach verschwundenen Aktivisten. Bei der Ermittlung der Mörder junger Frauen wird Dan Fletcher brutal ermordet. Damit endet der erste Teil des Buches „Die gegrillte Hand“. Im zweiten Teil „Zaziwe“ werden die Täter und ihre Motive eingeführt. „Moege die Erde erbeben“, der dritte Teil des Bandes, verspricht die Auflösung der Verbrechen, beschreibt die Verantwortung von Pharmaindustrie und Mafia daran und einen Showdown in der besten Noir-Tradition, der nichts übrig lässt.
Strukturelle Gewalt
Die politisch isolierte Apartheidregierung konnte so lange überleben, weil sie es verstand, ihre Feinde zu spalten. Auch davon handelt Féreys Roman. So waren in den Achtziger Jahren dreimal so viel Menschen Opfer interethnischer Verbrechen als Opfer von Polizeigewalt. Auch das neue Südafrika produziert Serienmörder, ehemalige Soldaten, Milizionäre, Deserteure, darunter Joost Terreblanche, der zentrale Gegner von Ali Neumann, ein reaktionärer Afrikaaner, der mit chemischen Drogen und Waffen handelt, um das Land in den Abgrund zu treiben und das Weltgericht einzuläuten.
Während der Apartheid versuchten 200 Wissenschaftler im Auftrag des Geheimdienstes chemische Waffen zu entwickeln, um die schwarze Bevölkerung und Apartheidgegner zu dezimieren. Diese Angelegenheit wurde vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) verhandelt, doch der Hauptverantwortliche wird freigesprochen. Terreblanche, ehemaliger Oberst, hatte an diesem Projekt teilgenommen und war für die Sicherheit der Labore zuständig. Nun will er die obdachlosen Kinder der Townships mit Aidsviren verseuchen, die in die Drogen gemischt werden, die sie üblicherweise konsumieren, um sie daran sterben zu lassen.
Neumann verliebt sich in die mysteriöse Tänzerin Zina Dukobe, ein ehemaliges Mitglied der Inkatha und eine Verteidigerin der Tradition der Zulus. Die Zulupartei Inkatha wurde von Buthelezi gegründet, als der ANC verboten war und machte dem ANC seine oppositionelle Führungsrolle im Kampf gegen die Apartheid streitig. „Wenn ich einen Weißen töte, ist meine Mutter glücklich“ oder „Wir werden euch töten“ lauteten die Losungen der radikalen Fraktion der Inkatha. Mehrere Morde an Tätern des Apartheidregimes wurden zur selben Zeit verübt, als Zinas Band vor Ort auf Tournee war, weshalb sie unter Verdacht gerät.
Férey erzählt auch die Geschichte Südafrikas nach dem Ende der politischen Apartheid und die Entstehung einer sozialen Apartheid, die an die alte Gewalt anknüpft und neue produziert. Rassismus und Xenophobie sind nicht verschwunden, sie haben nur andere Formen angenommen wie die Gewalt, die für schwache Nerven manchmal kaum zu ertragen ist.
Elfriede Müller
Caryl Férey: Zulu (Zulu, 2008). Thriller.
Aus dem Französischen von Jörn Pinnow.
München: Piper 2010. 475 Seiten. 20,60 Euro.











