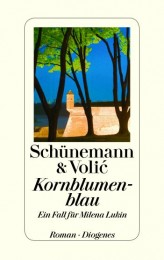 Partisanenhaushalt
Partisanenhaushalt
– Der Zerfall Jugoslawiens und die Konstitution der postjugoslawischen Staaten aus Gewalt, Korruption und Privatisierung bieten viel Stoff für Kriminalliteratur. Gleichwohl sind die Ohnmacht, das Unverständnis und das Trauma für die Bevölkerungen im postjugoslawischen Raum noch zu präsent, um eine Aufarbeitung der Vergangenheit in Angriff zu nehmen, die sich sowohl in politischen, theoretisch-wissenschaftlichen wie auch künstlerischen Formen äußern kann. Eine Besprechung von Christian Schünemanns und Jelena Volićs Roman „Kornblumenblau“ von Elfriede Müller.
Innerhalb Europas und der westlichen Welt gilt Serbien als hauptverantwortlicher Staat für Krieg und Gewalt, der Widerstand gegen die diversen Jugoslawienkriege und die Diktatur innerhalb Serbiens selbst sind kaum bekannt. Da Serbien keine Mittelmeerküste besitzt wie Kroatien, sondern nur durch den Kosovokonflikt in den internationalen Nachrichten präsent ist, stellt dieses Land für die meisten Europäer einen blinden Fleck auf der Landkarte dar.
Seine Europatauglichkeit macht sich nicht daran fest, unter welchen Bedingungen die Menschen leben, sondern ob der Kosovokonflikt beigelegt wird. Innerhalb Serbiens selbst ist man sich der internationalen Isolation bewusst, die Kriegshelden gelten als Loser und haben mittlerweile ein schwaches gesellschaftliches Standing. Im Bereich des Films lässt sich am ehesten eine Spurensuche nach den Gründen für Zerfall und Krieg erkennen, wie z. B. in der ästhetisch anspruchsvollen Doku-Fiktion von Želimir Žilnik, „Tito among the serbs for a second time“ oder im Comedy-Drama von Srđan Dragojević, „Parada“, das über die Thematisierung der Homophobie in einer kriegstraumatisierten Gesellschaft mit dem Mittel der Boulevardkomödie den Nationalismus gleich mit dekonstruiert.
… was nur die Kriminalliteratur vermag …
Nun haben der bereits in die Kriminalliteratur eingeführte Christian Schünemann und die Belgrader Historikerin Jelena Volić, einen vierhändigen Roman vorgelegt, der in Belgrad spielt und eine Reihe mit Milena Lukin einleitet. Erstaunlich ist, dass der Roman nur auf Deutsch erscheint. Trotz der manchmal etwas verkrampft wirkenden Bemühungen, einen europakompatiblen Plot zu konstruieren, ist Schünemann/Volić etwas gelungen, das nur die Kriminalliteratur vermag. Es geht selbstredend um Verbrechen, dabei natürlich um Kriegsverbrechen, aber auch um eine Einführung in die serbische Gesellschaft, die hierzulande nicht präsent ist.
Die Heldin Milena Lukin, Spezialistin für internationales Strafrecht, ist eine gelungene Figur, die sich wohltuend von anderen supercoolen Krimiheldinnen absetzt, da sie dem wirklichen Leben entstammt. Auch die anderen Protagonisten sind erfrischend unprätentiös in einer unglaublich komplizierten Lebens- und Gesellschaftslage, wie die Freundin Milenas, Tanja, die als Ärztin während der Kriege Kriegsopfer versorgte und nun ihr vieles Geld mit Schönheitschirurgie verdient.
Mit dem Halodri Siniša Stojković, einem Anwalt, der das neoliberale demokratische Serbien des Zoran Djindjić repräsentiert, recherchiert Milena über den Tod zweier Gardisten der serbischen Eliteeinheit, die auf dem Militärgelände von Topčider tot aufgefunden werden. Dieser Kriminalfall beruht auf einer wahren Begebenheit. Den Autoren gelingt es, das unterschiedliche individuelle Aufarbeiten bzw. die Amnesie im Umgang mit den Kriegstrauma darzustellen. Diese unterschiedlichen Narrative hindern oder befördern die Erkenntnis und das Leben der Menschen. Die liebevolle Schilderung des Belgrader Alltags lässt ahnen, mit welch schwierigen Verhältnissen die Menschen sich dort herumschlagen.
Milena kommt mehr schlecht als recht über die Runden, sie schreibt ihre Habilitation über Kriegsverbrechen mit einem deutschen Stipendium, dessen Weiterführung von Bürokraten abhängt, die sich nicht für die Lebensverhältnisse ihrer Stipendiaten interessieren. Sie wohnt mit ihrer Mutter Vera und ihrem pubertierenden Sohn zusammen, das Kind einer Ehe mit einem Deutschen, die während des Krieges in die Brüche ging. Adam hat einen SS-Opa und einen, der bei den jugoslawischen Partisanen war, wie es Großmutter Vera immer wieder klarstellt, die für das leibliche Wohl aller sorgt und den Vielvölkerstaat Jugoslawien in der kleinen Küche wieder aufleben lässt.
Subtil wird die soziale Hierarchie Serbiens dargestellt, in der Jugoslawien manchmal noch weiterlebt. So lächelt Stojković, wie es nur ein Montenegriner vermag, und die Küchenhilfe Samir wird es aufgrund seiner kosovarischen Herkunft nie schaffen, Mitglied der Eliteeinheit zu werden. Das Team Siniša/Milena entstand durch ihr gemeinsames Engagement zur Aufklärung von Kriegsverbrechen in Bosnien und im Kosovo, ein Engagement, das beide aus unterschiedlichen Gründen leisteten. Auch die Umdeutung von Geschichte ist Thema des Romans, die Verwirrung, sich in den neuen Straßennamen zurechtzufinden, die nicht nur an das jugoslawische Königreich erinnern und das sozialistische Jugoslawien unter den Tisch kehren, sondern die auch nur noch kyrillisch geschrieben werden:
„Das halbe Jahrhundert einer ganzen Nation war von der Tafel der Weltgeschichte gewischt worden (…) weil man Kriegsgenerälen und Politikern erlaubte, die Geschichte umzuschreiben.“
Verbrechen und Kontexte
Der Roman macht deutlich, dass heutige Verbrechen im postjugoslawischen Raum mit der unaufgearbeiteten Geschichte der Jugoslawienkriege zu tun haben. So ist der Täter Pawle, wie so viele seiner Zeitgenossen, auch ein Opfer dieser Kriege und kann aus ihrer Logik nicht entfliehen. Die Aufklärung des heutigen Verbrechens führt nach Bosnien 1993, nach Srebrenica und dem größten Massaker in Europa nach dem zweiten Weltkrieg.
Schünemann/Volić erinnern auch an die unrühmliche Rolle der Bundesrepublik im Jugoslawienkonflikt, die überstürzte Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, die dem Bürgerkrieg mit entfachte. Den Roman durchzieht eine leichte Melancholie über den endgültigen Verlust eines Lebensgefühls:
„Das Leben, das wir geführt haben, gibt es nicht mehr, nichts von seiner Schönheit und Leichtigkeit haben wir herüberretten können. Als ob es keinen Platz gehabt hätte in dem Gepäck, das wir damals schleppen konnten.“
Elfriede Müller
Christian Schünemann und Jelena Volić: Kornblumenblau. Ein Fall für Milena Lukin
. Roman. Zürich: Diogenes Verlag 2013. 361 Seiten. 19,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.











