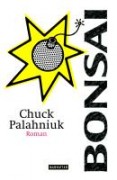 Eine ganz zarte Liebesgeschichte
Eine ganz zarte Liebesgeschichte
Auf der ersten Seite ist eins schon mal ganz klar: Bonsai ist ein unerträgliches Buch. Geschrieben aus Sicht eines 13-jährigen Jungen, der die Sprache, in der er schreibt, grammatikalisch nicht richtig erfasst hat. Dafür kennt er eine Menge Vokabeln, auch komplizierte Vokabeln, aber längst nicht alle, besonders einige einfache, alltägliche Wörter sind ihm fremd. Wenn er für etwas keine Vokabel hat, umschreibt er die Dinge eben und bleibt dann auch hartnäckig bei dieser Umschreibung. Der Junge schreibt außerdem Depeschen. Es ist also eine Art Briefroman, dieses Buch. Wie lästig. Könnte man meinen. Henrike Heiland hat weitergelesen …
Zehn Seiten später ist Bonsai gar kein unerträgliches Buch und die Sprache kein Thema mehr. Sie hat eine eigenartig hypnotische Wirkung entwickelt und birgt ganz wunderbare Möglichkeiten: Alltägliches und schon tausendfach Gelesenes frisch, komödiantisch und treffend zu verpacken. (Große Übersetzerleistung! Super Sound!) Es gibt auch einen triftigen dramaturgischen Grund für diese Sprache. Bonsai, Erzähler, Depeschenschreiber und titelgebender Held, ist als Austauschschüler aus einem nicht näher bestimmten Land für ein halbes Jahr im Mittleren Westen der USA, zusammen mit ein paar Altersgenossen, um sich die zivilisierte Welt aus der Nähe anzusehen. Sich von der Kargheit und den Entbehrungen der Heimat erholen. Das Land, aus dem er stammt, scheint eine Art winziges China-Russland-Nordkorea zu sein, in jedem Fall marxistisch geprägt, totalitär und vor allem: die USA hassend.
Bonsai ist nämlich nicht einfach nur ein Austauschschüler, sondern ein kleiner Terrorist, ebenso wie seine Freunde. Allesamt wurden sie bereits mit vier Jahren ausgewählt, in todbringenden Nahkampfspielarten und dem Erstellen ebenso todbringender chemischer Substanzen ausgebildet und indoktriniert bis zum Abwinken. Diese hoch intelligenten wie auch hoch manipulierten Teenager haben nun den Auftrag, Chaos in die USA zu bringen. Viele dieser kapitalistischen, fehlgeleiteten Amerikaner sollen dabei sterben. Zitiert wird in jedem Kapitel mindestens einer der „großen“ Meister. Das darf dann auch mal Hitler sein oder Mussolini, Hauptsache totalitär und menschenverachtend und die Doktrin rechtfertigend, da muss es nicht immer ganz astrein kommunistisch sein.
Auf der anderen Seite steht Bonsais Gastfamilie, die Cedars, typisch amerikanisch mit allen Abgründen, die dazugehören: Antidepressiva, Nymphomanie und religiöser Wahn. Und so, wie die Austauschspione nichts als Hass für dieses Land und seine Leute empfinden, sind die Cedars unumstößlich davon überzeugt, dass wahre Glückseligkeit nirgendwo anders auf der Welt zu finden ist als genau dort, wo sie leben. Nicht, dass sie sich wirklich für Bonsai als Mensch interessieren würden. Sie nennen ihn nicht mal bei seinem richtigen Namen. Sie taufen ihn einfach Bonsai, weil er ihnen so schmächtig und unterernährt vorkommt. Stecken ihn gleich am Flughafen in ein „Jesus“-Shirt, das ihm nicht passt, weil er ungefähr nur die Hälfte von seinem überfütterten Gastbruder darstellt, und wissen nicht einmal, aus welchem Land er eigentlich kommt. Sie denken sich ihren Teil: Primitiv wird es sein, arm und karg, weil, es ist ja nicht das gelobte Amerika.
Liebesroman mit Gehirnmasse
Das sind zwei gegensätzliche Positionen, die sich als Spannungsfeld schon mal gut eignen. Um Politik allerdings, das sei mal besser betont, geht es dabei gar nicht. Eher um das blinde Vertrauen in den jeweiligen Lebensentwurf, den entsprechenden Vater Staat. Keine der beiden Positionen ist sympathisch, keiner Seite mag man wirklich zugestehen, dass sie am Ende, sagen wir mal, gewinnt. Etwas Komik liegt natürlich in der Tragik, mit der Bonsai seine Gastfamilie und deren Umfeld schildert. Das ist eine Tragik, die man bereits kennt, die einen nur müde gähnen ließe, wäre da nicht Bonsais einmalige Sicht auf die Dinge. Tragisch wirkt auch die Beschreibung der Verhältnisse, aus denen Bonsai stammt. Die Art, wie er von seinen bitterarmen Eltern weggenommen wurde, wie er zu der tödlichen Kampfmaschine, die er nun ist, ausgebildet wurde. Vielleicht der Gipfel der Tragik ist die detailreiche Beschreibung der Vergewaltigung, die Bonsai aus taktischen Gründen gleich an seinem ersten Tag in den USA durchführt. Aber mal ehrlich, bei aller Tragik: Das kennt man schon, das erwartet man, das reißt einen nicht mehr um. Nicht bei einem Autor, der in so einigen amerikanischen Leihbibliotheken nur verstohlen unter der Ladentheke rausgerückt wird, weil er es immer übertreibt mit der Gewalt und dem Sex und allem.
Wer sich davon ablenken lässt, verpasst die eigentliche Geschichte. Und das ist, ja, eine zarte Liebesgeschichte. Bonsai verknallt sich nämlich sofort in seine Gastschwester. Ein gerissenes, mit allen Wassern gewaschenes Früchtchen. Wie gut, dass eine wie sie nicht zur Kampfmaschine ausgebildet wurde. Von wegen Gehirnwäsche und ferngesteuert – schwer vorstellbar. Kratzbürstig ist sie, und sie stellt ganz schnell klar, dass zwischen ihm und ihr schon mal gar nichts laufen wird.
So entwickelt sich in den Depeschen, in denen es vor Blut und Gehirnmasse nur so trieft, fast unmerklich der kleine, streng nach Vorschrift seiner Heimat handelnde Bonsai zu einem rebellischen Teenager, der in die wichtigste Phase der Pubertät eintritt.
Ein Brief-Liebes-Coming-of-Age-Roman ist es also, ein Stück heitere Gesellschaftssatire sowieso, dazu eine bemerkenswerte Zitatensammlung von Hitler über Fidel Castro bis Oscar Wilde, und ein Lexikon absurd klingender Nahkampftötungsarten. Naja und wer unbedingt will, kann Bonsai auch als tragische Gewaltorgie lesen, in der 13-Jährige strategisch vergewaltigen und gewissenlos töten. Aber da entgeht einem doch viel.
Henrike Heiland
Chuck Palahniuk: Bonsai (Pygmy, 2009). Roman.
Deutsch von Werner Schmitz.
München: Manhattan 2009. 265 Seiten. 16,95 Euro.











