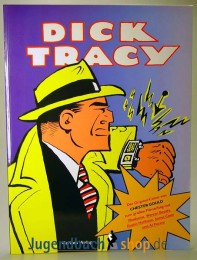Zu Besuch bei Jerome Charyn
Zu Besuch bei Jerome Charyn
– Jerome Charyn gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellern dieses Planeten. Seine Saga um Isaac Sidel, Cop, Mörder, guter Mensch und bald Präsident der Vereinigten Staaten gehört zu den Schlüsselwerken der Kriminalliteratur. Dirk Schmidt hat ihn in New York City besucht.
Jerome Charyn geht es nicht so gut. Er hat sich vor zwei Tagen beim Tischtennis verletzt. Wahrscheinlich eine Zerrung. Er empfängt in seinem Apartment im West Village. Der Blick geht auf das Grün eines idyllischen kleinen Parks, die Klimaanlage summt und rattert. Mr. Charyn schaut mich mit wachen Augen an und nippt immer mal wieder an einer Tasse Tee. Später, der offiziöse Teil des Gesprächs wird beendet sein, später, beim freundlichen after small talk, wenn man so will im Hinausgehen, wird Charyn seine wahnsinnige Leidenschaft für Basketball erwähnen und seine Augen werden leuchten. Und spätestens dann ist eins so klar wie dieser Sommertag in New York: Jeder Versuch Jerome Charyn oder sein Schreiben greif- und begreifbarer zu machen, es vielleicht einzufangen, in Topoi, Motive und Biographeme zu ordnen, ist zum Scheitern verurteilt. Noch etwas später sitze ich auf dem kleinen Platz und überfliege die 92 Minuten Material. Das Wort „Basketball“ wird nicht auftauchen.
Dirk Schmidt: Ich möchte versuchen, sofort zum Punkt zu kommen: Im Fall eines übersetzten Texts ist es ja generell nicht leicht, tief unter der Oberfläche liegenden Referenzen zu decodieren, in Ihrem speziellen Fall ist es für deutsche Leser fast unmöglich. Ein Umstand, der, nebenbei gesagt, einen großen Teil der Faszination Ihrer Romane ausmacht – der Leser ahnt, er weiß manchmal sogar, dass er sich in einem komplexen System befindet, kann es aber nicht benennen.
Jerome Charyn: Die Schwierigkeit der Übersetzung, und das gilt selbstverständlich auch für Frankreich, ist, dass man im besten Fall etwa 40% dessen bekommt, was da ist, aber so gut wie nichts von der Sprache. Sprache bedeutet mir sehr viel. Sie können sich vorstellen, dass ich keine Ahnung habe, wie die Romane für den deutschen Leser klingen.
DS: Ich werde jetzt den Versuch, sofort zum Punkt zu kommen, fortsetzen: Zur Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich zwei Amerikaner gebeten, Charyn zu lesen und inzwischen Rückmeldungen erhalten. Zwei handelsübliche, dem Literaturbetrieb fernstehende, Leser ohne großartige Präferenz für Kriminalromane. Beide hatten überraschenderweise die gleiche Assoziation: Dick Tracy.
DS: Und ich weiß nicht warum. Ein Irrtum? Sind die beiden auf dem Holzweg?
JC: Nein, ganz und gar nicht. Dick Tracy ist surreal, ein Comic, und widersetzt sich den Konventionen. Die Protagonisten, Dick Tracy und Isaac Sidel, haben nichts miteinander gemein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leser sich an Comics erinnert fühlen. Die Realität wird gebrochen und alles ist möglich. Da liegt vielleicht auch eine Gemeinsamkeit abseits der Übersetzungsproblematik – Leser, die Kriminalromane mögen – also Krimileser ganz allgemein und egal wo – bemerken wahrscheinlich schnell, wie sehr sich die Sidel-Romane von anderen Kriminalromanen unterscheiden. Sie verweigern sich dem Genre, sie haben keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende – sie passieren in einer Art Niemandsland.
DS: Das war ein Punkt, auf den ich so schnell wie möglich kommen wollte – mein persönlicher Eindruck war immer, dass sich die pure Energie der Romane unabhängig von der Übersetzung auf den Leser überträgt …
JC: Jedenfalls hoffe ich immer sehr, dass sich diese Energie überträgt. Das Grundtempo, die ständige Bewegung, ohne dem Leser Gelegenheit zur Reflexion zu geben. Und andauernd passiert etwas Neues.
DS: Ist das der „Gameplan“? Und die wichtigste Motivation?
JC: Nein. Mein Schwerpunkt ist, den Leser an einen Ort zu führen, an dem er noch zuvor nie gewesen ist. Man schließt die Augen, folgt Alice und dem weißen Kaninchen und muss dem Erzähler vertrauen. Vielleicht wird es gefährlich, aber man wird überleben. Lesen ist eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, man weiß nicht, was einem begegnen wird – vielleicht der Tod, Dinge mit denen man sich nicht auseinandersetzen will, Schmerzen. Oder natürlich Momente großer Freude.
DS: Okay. Lassen wir uns mal darauf ein. Ich bin der Leser, und ich falle in diese Welt. Ich falle und falle … und es gibt nichts zum Festhalten? Keine Haken in der Wand?
JC: Vielleicht brauchen Sie die gar nicht. Vielleicht erlaube ich Ihnen keine Haken. Vielleicht will ich Ihnen Angst machen … und Freude bereiten, Sie amüsieren und mit auf die Reise nehmen. Die Sidel-Geschichte ist mittlerweile sehr umfangreich. Es ist eine Saga … zu Beginn ist Isaac ein unbekannter Polizist und am Ende kurz davor Präsident der USA zu werden. Wie ist das passiert? Wie kann etwas so Unglaubliches passieren?
DS: Ich bin sehr glücklich mit dieser Antwort – aber immer noch auf der Suche … Während der Vorbereitung auf dieses Gespräch sind mir einige immer wiederkehrende Motive aufgefallen …
JC: Zum Beispiel?
DS: Die Dreifaltigkeit aus Jazz, Baseball und den bereits angesprochenen Comics. Drei Topoi, um die Ihre Romane immer wieder zu kreisen scheinen.
JC: Durchaus …
DS: Wie kommt man dazu? Ist das eine strategische Entscheidung? „Ich will das so, es hilft mir, den Text zu tragen“ – oder offenbart sich an diesen Stellen doch eine Menge über Jerome Charyn selbst?
JC: Jazz, Baseball und Comics … Natürlich hat diese Auswahl etwas mit mir zu tun. Ich habe mit Comicstrips zu lesen begonnen. Für ein Kind sind Comics von einer besonderen Magie, weil alles passieren kann. Captain Marvel macht … booom … aus einem verkrüppelten Jungen einen unbesiegbaren Superhelden. Ich bin in Amerika geboren, aber meine Eltern sprachen kaum Englisch. Was ich zuerst am Baseball liebte, waren die Namen der Spieler, weil sie so seltsam klangen. Kanonenkugel Sowieso … das waren Jungs vom Land, weit davon entfernt, Millionäre zu sein. Joe DiMaggio stand da ziemlich allein. Die meisten waren fahrendes Volk, Saisonarbeiter, die ihr Geld damit verdienten, in einem gestreiften Pyjama auf einem Baseballfeld zu stehen. Für einen Jungen aus der South Bronx ergab sich ein bestimmtes Bild von Amerika, das er sonst vielleicht nicht entdeckt hätte. Und Jazz … schwierig. Vielleicht habe ich versucht, beim Schreiben eine Art Jazz zu erfinden, ohne wirklich viel über Jazz zu wissen. Ich wusste nur, dass ich meine Sätze verändern, modulieren wollte. Es sollte Riffs geben, Variationen.
DS: Improvisation?
JS: Vielleicht. Ich kann das nicht benennen.
DS: Oder Sie möchten es nicht …
JS: Damals in dieser Stadt, zu dieser Zeit konnte man dem Jazz gar nicht entgehen. Ich habe mal im selben Haus wie Miles Davis gewohnt. Er war mein Vermieter. Einmal schellte es und John Lennon stand vor der Tür … (lacht), er wollte zu Miles. Kurzum: Jazz als Musik hat keinen großen Einfluss auf mein Schreiben gehabt. Als Klang der menschlichen Sprache aber umso mehr. Als kleiner Junge auf der Straße schnappt man nicht die unbedingt die Bedeutung der Worte auf, sondern erst mal ihre Musik und ihren Klang. Und so überträgt sich auch die Energie, über die wir sprachen.
DS: Vielleicht ist der schwarze Jazzmusiker Miles Davis ein gutes Stichwort, oder, was Baseball angeht, der „Christy Mathewson Club“, eine Loge alter Männer, die der Zeit nachtrauern, als Baseball noch ausschließlich weiß war. Es scheint, als könne auch das Projekt Isaac Sidel der Auseinandersetzung mit dem Rassismus, einer weiteren amerikanischen Konstante, nicht entgehen.
JC: Wie auch? Gerade in den frühen Büchern, wo ich es mit diesen rassistischen Detectives zu tun hatte, die Schwarze nicht nur ablehnen, sondern von Grund auf hassen. Cohn ist nicht so und Isaac auch nicht, aber das war es auch schon. Die Welt, in der die frühen Romane angesiedelt sind, ist absolut rassistisch. Und der Rassismus erstreckt sich selbstredend auch auf die Latinos.
DS: Also war es Ihnen wichtig, diesen Teil der New Yorker Realität der 70er Jahre in ihren Büchern auszudrücken.
JC: Ich habe an anderer Stelle schon mal erzählt, wie es zu Isaac kam. Mein Bruder war damals Detective in der Mordkommission, und ich hatte die Gelegenheit, viel Zeit mit diesen Leuten zu verbringen und sie zu studieren, hautnah, bei Einsätzen. Aber so sehr ich mich auch für die Musik und den Klang ihrer Sprache interessierte, ich konnte nicht einfach ignorieren, was sie sagten. Rassismus ist übrigens auch noch heute ein Problem der Polizei in den USA, und ich glaube nicht, dass sich das sehr bald ändert.
DS: Warum so pessimistisch?
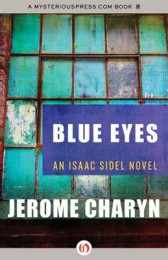 JC: Solange eine Art sozialer Segregation existiert und Schwarze in bestimmten, überwiegend von Schwarzen bewohnten Gegenden wohnen, wird es eine zweigeteilte Gesellschaft geben.
JC: Solange eine Art sozialer Segregation existiert und Schwarze in bestimmten, überwiegend von Schwarzen bewohnten Gegenden wohnen, wird es eine zweigeteilte Gesellschaft geben.
DS: Schwarz und weiß?
JC: Arm und reich. Wir steuern auf eine Gesellschaft zu, in der es arme Leute gibt, so etwas wie eine untere Mittelschicht, und sehr reiche. Die armen sind chancenlos, die middle class muss mehrere Jobs annehmen, um das schiere Überleben zu sichern und alle anderen schmeißen mit Geld um sich. Was passiert mit dem Rest? Wie geht es weiter für sie? Vielleicht gar nicht. Ich habe kürzlich gelesen, dass sich the best and brightest der Unterschicht teilweise gar nicht mehr an den Elite-Universitäten bewerben, obwohl sie vielleicht auf ein Stipendium hoffen können. Sie glauben nicht, dass sie es schaffen können.
DS: Ein Charyn-Thema. Wie viele Wunderkinder gibt es in Ihren Romanen?
JC: Viele. Aber die Wunderkinder haben keine Chance mehr. Und für die USA ist das eine Tragödie. Es geht viel verloren. Die reichen Nichtstuer gab es auch zu meiner Zeit an der Columbia Universität. Ohne Interessen oder Engagement für irgendwas. Gehirntote mit Jobgarantie. Aber es gab eben auch noch uns – die Kinder der unteren Mittelklasse, die es schaffen wollten. Heute rutschen wir langsam aber sicher in die Krise. Nicht nur ökonomisch, sondern auch intellektuell.
DS: Die ersten Sidel-Romane erschienen in einer Zeit, die ebenfalls von Krisen geprägt war
JC: „Blue Eyes“ ist 1974 entstanden und Anfang 1975 erschienen …
DS: Eine wirtschaftlich katastrophale Zeit für New York. Man kann von anarchischen Zuständen sprechen. Rassenunruhen, Gewalt, the Bronx was burning, New York geht Bankrott.
JC: Und Gerald Ford antwortet der Stadt „drop dead“ … (lacht) … das war wunderbar.
DS: Hat er das wirklich gesagt?
JC: Aber sicher. New York hat entweder überhaupt kein Geld oder viel zu viel und niemand weiß warum.
DS: Niemand?
JC: New York ist eine Comic-Book-City. Da hat sich nicht viel geändert. New York ist ein großes bande dessinée. Wo alles möglich ist und gar nichts.
DS: Das ist also die Landschaft, über die wir sprechen, als Isaac Sidel die Bühne betritt. Dunkel, aber vielleicht auch wilder und im positiven Sinne verrückter als heute. War es leichter zu dieser Zeit, sich für ein Experiment zu entscheiden und nicht für den Mainstream? Ist Isaac ein Kind des Zeitgeists?
JC: Nein, auf keinen Fall …
DS: Fest steht, Sie haben sich für einen bestimmten Weg entschieden …
JC: Ebenfalls fest steht, dass ich zu der Zeit, als ich „Blue Eyes“ schrieb, durchaus der Ansicht war, ich arbeite an einem konventionellen Kriminalroman. Meine bisherigen Romane verkauften sich nicht, also entschied ich mich für eine Kriminalgeschichte. Mein Bruder war Polizist, ich konnte ihn besuchen und so weiter … aber am Schluss war „Blue Eyes“ ein ebenso verrücktes Buch wie alle zuvor. Hinzu kommt, dass ich zu dieser Zeit zum ersten Mal in Europa war.
DS: Ein Kulturschock?
JC: Europa hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Ich habe mich dort manchmal heimischer gefühlt als in meiner Heimatstadt. Ich weiß selbst nicht, warum. Europa hatte Anmut, Kultur, eine gewisse Raffinesse, eine Melodie – New York war roh, grausam und ganz und gar nicht kultiviert. Und in dieser Phase meines Lebens taucht Isaac Sidel auf.
DS: Voilà …
JC: Isaac macht mir die meiste Freude und sicher sind die Sidel-Romane meine persönlichsten. Auch wenn ich hoffe, dass uns niemand verwechselt. Bei einem Sidel-Roman gibt es keine Konventionen und Restriktionen, und ich kann tun und lassen, was mir passt. Ich schließe die Augen und gehe wohin ich will.
 DS: War Ihnen damals schon klar, dass es eine Reihe werden wird?
DS: War Ihnen damals schon klar, dass es eine Reihe werden wird?
JC: Der Tod von „Blue Eyes“ verlangte einen zweiten Roman. Und der dritte, entstand nur wegen Richard Harris.
DS: Der Schauspieler, den sie Pferd nannten …
JC: Er rief mich an und bat mich, einen Kriminalroman für ihn zu schreiben. So kam es zu „Patrick Silver“. Ein irischer Ex-Bulle, der barfuß durch New York läuft. (lacht) … Ich erinnere mich, dass Richard Harris keine Schuhe trug, als wir uns in der Lobby des Plaza Hotels trafen. Jeden anderen hätten sie aus dem Plaza geworfen, aber Richard Harris war damals ein Star.
DS: Und dann kam „Secret Isaac“.
JC: Mit „Secret Isaac“ habe ich das Ganze auf eine andere Stufe gehoben. Literarischer. James Joyce. Zu der Zeit hatte ich in Dublin zu tun und habe Dublin und Joyce in das Buch eingearbeitet. Das Buch wurde zu einer Art Reiseerinnerung. Ich ging über eine der Brücken in Dublin und da lag ein kleines Kind, etwa vier Jahre alt, in einer Plastiktüte.
DS: Was haben Sie getan?
JC: Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich tun sollte. Das Kind schlief. Mitten auf der Brücke. Ganz allein. (schweigt eine Weile)
DS: Ich versuche es mal mit einem Zitat. Dem ersten, das man findet. Oder hat es schon den Rang einer Anekdote? Obwohl Sie sehr viel Zeit in Frankreich verbringen, weigern Sie sich französisch zu lernen.
JC: Das stimmt …
DS: Sie haben Angst, die Melodie ihres Schreibens zu verlieren …
JC: Eher Angst, auf Französisch zu träumen. Man verliert etwas, wenn man nicht von seiner eigenen Sprache umgeben ist. Ich habe immer damit geliebäugelt, in Frankreich zu leben. Hemingways „The Sun Also Rises“ hatte für einen Jungen aus dem Ghetto ein besonders kraftvolles Aroma. Als ich, mit Ende 40, die Möglichkeit dazu bekam, war ich glücklich, aber ich habe auch einen Preis bezahlt. Man verliert etwas … vielleicht auch den Mut. Die Jahre in Europa waren keine einfachen.
DS: Wann war das?
JC: In den 90ern. Ich lernte eine Frau kennen, sie war jünger. Ich dachte, ich würde eine Familie gründen. Aber das hat sich nicht ergeben. 1994 bewarb ich mich an der American University in Paris und wurde zu meinem großen Erstaunen genommen, weil der Dekan „Movieland“ gelesen hatte. Er sagte, ich solle Film lehren und das tat ich dann auch. Aber mit der Zeit war auch meine Liebesaffäre mit Europa vorbei. Und als ich zurück in die Staaten kam, spürte ich plötzlich eine starke Energie. Eine Energie wie ich sie vorher nicht hatte. Booom … Es war etwas in mir erwacht.
 DS: Für mich passt das ins Bild. Wir haben ja bereits den Übersetzungsverlust resp -quotienten festgelegt … also gibt es eine 60% Chance, das ich mich irre, aber ich habe Europa in den Sidel-Romanen nie finden können.
DS: Für mich passt das ins Bild. Wir haben ja bereits den Übersetzungsverlust resp -quotienten festgelegt … also gibt es eine 60% Chance, das ich mich irre, aber ich habe Europa in den Sidel-Romanen nie finden können.
JC: Es ist aber da. Es ist absolut da.
DS: Aber nicht in Charyn-Land.
JC: Europa ist absolut gegenwärtig.
DS: Das Wort …
JC: „Patrick Silver“ endet in Barcelona …
DS: Natürlich. Das hatte ich vergessen. Der Leser, jeder Leser, und hier müssen Sie bitte verzeihen, macht sich ein eigenes Bild – mein Bild von Jerome Charyn war bislang das des exemplarischen New Yorker Schriftstellers. Jedenfalls was einen bestimmten Zeitraum angeht.
JC: Ping-Pong.
DS: Verzeihung?
JC: Sie haben Ping-Pong vergessen. Tischtennis ist ein essentieller Bestandteil der Sidel-Romane. Es fehlt in Ihrer Heiligen Dreifaltigkeit.
DS: Ich wollte gerade zu diesem Punkt kommen. Der Grund, warum ich Tischtennis zunächst vernachlässigt habe, ist meine zweifelhafte Festlegung auf originär amerikanische Phänomene.
JC: Einigen wir uns darauf, dass die Romane nicht primär mit Europa zu tun haben, Europa aber in meinem Bewusstsein eine große Rolle spielte.
DS: Sehr gern. Vielleicht ist die Dreifaltigkeit auch nur in New York denkbar. Die 52. Straße und der Jazz, die Yankees, die Giants, die Dodgers und Baseball und wenn man „Cavalier and Clay“ von Michael Chabon liest …
JC: Und New York ist nicht Amerika. New York liegt näher an Europa und hat oft kaum eine Verbindung zum Rest der USA. Man fährt von hier aus in den Süden und hat das Gefühl, man sei in einem anderen Land. Und in Texas ist man sogar in einem Land außerhalb dieses Landes …
DS: Verstehe. Ich glaube, jetzt haben wir’s.
JC: Das ist übrigens etwas, was ich bereue. Ich hätte mehr durch die USA reisen sollen. Nicht unbedingt als Schriftsteller, sondern um das Land zu entdecken.
DS: Der nächste Fragenkomplex wird nicht leichter für mich, und ich muss meine Fähigkeit auf Zehenspitzen zu tanzen möglicherweise noch vervollkommnen.
JC: Ich höre …
DS: Sie sind ein jüdischer Schriftsteller …
JC: Ja … aber lassen Sie uns vorsichtig sein.
DS: Ich werde versuchen, so vorsichtig zu sein wie irgend möglich …
JC: Meine Eltern waren Juden, als Kind habe ich jiddisch gelernt. Aber es ist nur sehr wenig Judaismus in mir. Einige meine Charaktere sind jüdisch. Isaac Sidel verfügt über eine jüdische Sensibilität … aber ich könnte keinen Roman mit der Stimme Abraham Lincolns schreiben, wenn ich wie ein jüdischer Komiker klingen würde – ein zweiter Lenny Bruce.
DS: Die Maranen in „Blue Eyes“, eine irische Synagoge in „Patrick Silver“. Die Frage nach der Frage jüdischer Identität drängt sich auf …
JC: Natürlich. Aber diese jüdische Identität wird immer durch eine unverwechselbare Stimme überlagert. Wenn ich keine Freude am Schreiben habe, wird es das Buch nicht geben. Und wie ich bereits sagte: die Sidel-Romane geben mir die größte Freude.
Der Grund, warum ich glaube, dass die Sidel-Romane etwas Besonderes sind, ob sie gut oder schlecht sind, will ich gar nicht entscheiden, aber der Grund warum sie vollkommen anders sind, als alles, was zu der Zeit geschrieben wurde, ist die Freiheit, die ich mir genommen habe, als ich sie schrieb. Ein Mafia-Boss, der einen zerstörten Tischtennis-Keller wieder instand setzen lässt. Ich habe mich nicht von den Gesetzen der Logik einzwängen lassen …
 DS: Das ist nichts anderes als bewunderungswürdig und eigentlich ein schönes Schlusswort. Das Ziel, die Sidel-Reihe durch einen Katalog immanenter Motive einzugrenzen, war von vornherein fragwürdig. Und außerdem ist die Freiheit, von der Sie sprachen, und die man in jedem zweiten Satz spürt, ja ein Teil der Faszination.
DS: Das ist nichts anderes als bewunderungswürdig und eigentlich ein schönes Schlusswort. Das Ziel, die Sidel-Reihe durch einen Katalog immanenter Motive einzugrenzen, war von vornherein fragwürdig. Und außerdem ist die Freiheit, von der Sie sprachen, und die man in jedem zweiten Satz spürt, ja ein Teil der Faszination.
JC: Aber?
DS: Einen hätte ich noch …
JC: Bitte.
DS: Wir haben das Thema Vorbilder und Einflüsse nur am Rande gestreift, ich weiß von Faulkner, Sie erwähnten Joyce und den frühen Hemingway, aber darauf will ich nicht hinaus. Manchmal, selten, aber dann recht deutlich, findet sich doch ein gewisser Anklang, ein unbestimmtes Gefühl für die Genrekonventionen in den Sidel-Romanen.
JC: Die Konventionen des Kriminalromans.
DS: Vielleicht nur von fern, oder als mehr oder weniger zufällige Begegnung.
JC: Okay. Das kann sein. Allerdings – als ich „Blue Eyes“ schrieb, hatte ich noch nie einen Kriminalroman gelesen.
DS: Es fällt mir schwer das zu glauben.
JC: Ich habe Hammett, Chandler und Chester Himes erst später gelesen. Hammett ist der Größte. Ich halte viel von James Ellroy. Aber nein, ich hatte kein Interesse innerhalb eines Genres zu arbeiten. Ich wollte ein Buch über meinen Bruder schreiben.
DS: Dann stammen diese Anklänge aus Erfahrungen mit Film und Fernsehen.
JC: Das ist möglich. Ich habe Ross Macdonald vergessen, den kannte ich schon vor „Blue Eyes“. Lew Archer ist allerdings das komplette Gegenteil von Isaac Sidel. Isaac ist manchmal zu groß für die Buchseiten.
DS: Ich habe nicht im Traum angenommen, ich könnte in zwei Stunden ein Isaac Sidel/Jerome Charyn Cookbook aus Ihnen herauslocken, aber ich kann sagen, dass Sie einige meiner dunklen Stellen und vielleicht auch der Leser beleuchtet haben. Ich möchte Ihnen danken.
Dirk Schmidt
Mehr zu Jerome Charyn auf kaliber.38 und auf seiner Homepage. Hier mehr zu Dirk Schmidt.
Jerome Charyn: Unter dem Auge Gottes(Erscheint am 27.09.2013). Aus dem amerikanischen Englisch von Jürgen Bürger. Diaphanes. Penser Pulp 2013. 288 Seiten. 16,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Portätfoto: © Jerry Bauer; Quelle: Diaphanes.