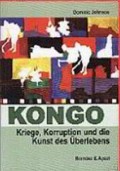 Chronik enttäuschter Hoffnungen
Chronik enttäuschter Hoffnungen
Wir können mit dem realen Afrika und seinen Problemen kaum etwas anfangen. Gerade putzige „Grimmis“ aus der Gegend belegen das immer wieder – nur Afrika ohne unschöne Realitäten „verkauft“ sich angeblich. Das stimmt aber nur bedingt – unsere Autorin Lena Blaudez, die mit Farbfilter und Spiegelreflex zwei hochbeachtete Politthriller über ein Afrika geschrieben hat, über das wir wenig wissen, das sie aber bestens kennt, hat für uns mit leiser Skepsis ein Sachbuch zum Thema gelesen.
Afrika, so wie wir Europäer es verstehen, existiert nicht.
(Ryszard Kapuściński)
Betrachtet man Geschichte und Gegenwart des Kongo, findet man Kapuścińskis Aussage hier in besonderer Weise bestätigt. Seit Joseph Conrad zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Herz der Finsternis dort verortete, waren die Bilder des Kongo von eben jener eurozentristischen Sichtweise geprägt, der Kapuściński jegliche Realität abspricht.
Bis heute scheint sich etwa die deutsche Presselandschaft nicht zu einem Konsens in der Darstellung der Ereignisse im Kongo durchringen zu können. Was sind die Ursachen für ein solch disparates Bild über eines der größten Länder Afrikas? Und: Wie könnte man sich den vielen Wahrheiten der Geschehnisse in den letzten 20 Jahren annähern?
Zeitungsleser/innen in Deutschland wird es auf jeden Fall kaum gelingen, sich auf der Grundlage deutscher Printmedien ein umfassendes, den realen Fakten entsprechendes Bild über den Kongo zu machen.
Die Geschichte des Elends
Seit die immensen Reichtümer des Kongo im 19. Jahrhundert von Europäern entdeckt wurden, tummeln sich dort bis heute die üblichen Verdächtigen: einheimische und internationale Akteure auf der Jagd nach Kautschuk und Elfenbein. Später kamen Kupfer, Gold, Diamanten hinzu und schließlich, im Handyzeitalter, das eminent wichtige Coltan. Wer aber noch nie vom Reichtum des Landes profitierte, sind seine Bewohner. Sie lebten und leben zum allergrößten Teil, gemessen an den von der UN aufgestellten Standards, unter „absoluter Armut“, d.h., sie haben weniger als einen Dollar pro Tag zur Verfügung.
Vor allem im Osten des Kongo befinden sich Konfliktherde, die das Land und die ganze Region nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Menschen werden von unterschiedlichen Rebellenorganisationen vertrieben, ausgeplündert und gefoltert, wobei keine der Kriegsparteien vor systematischen Vergewaltigungen zurückschreckt.
Der Bürgerkrieg und das unendliche Leiden der kongolesischen Zivilbevölkerung sind jedoch inzwischen aus dem Focus der Weltöffentlichkeit verschwunden. Daher werden so interessante Fragen wie etwa die nach der Rolle der USA und Frankreichs und ihrer Interessenpolitik im Kongo sehr laut nicht gestellt. Ebenso bleiben die Auswirkungen der Einmischung des ruandischen Regimes im Konfliktherd Ost-Kongo ausgeblendet oder werden widersprüchlich dargestellt.
Gegen öffentliches Abwinken
Dominic Johnson, Auslandskorrespondent der taz, will mit seinem Buch Kongo. Kriege, Korruption und die Kunst des Überlebens dem öffentlichen Desinteresse entgegenwirken und klassischen Vorurteilen wie „Inbegriff eines unzivilisierbaren Afrikas“ und „Opfer finsterer Mächte …“ eine sachliche und genaue Analyse von Geschichte und Gegenwart des Kongo entgegenstellen.
Johnson beschreibt zunächst die Entstehung des Kongo vom Königreich zum „Freistaat“ als Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II., der von 1885 bis 1908 das Land mit beispielloser Brutalität ausplündern ließ und dabei (und durch die Folgeschäden) die Hälfte seiner Bewohner ausrottete. Ausführlich geht Johnson auf die belgische Kolonialzeit ein, in der die Bevölkerung des Landes „Fremde im eigenen Land“ waren und ein „kolonialer Sonderweg“ beschritten wurde – ein „Sonderweg“, der eine rigide Kolonialpolitik auf der Grundlage einer dichten Präsenz der Kolonialverwaltung vorsah.
Erst seit Mitte der 1940er Jahre wurden staatliche Schulen (für Europäer) eingerichtet, die wiederum erst ab 1954 für Kongolesen zugelassen wurden. Aufgrund der belgischen Kolonialpolitik existierten zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit im Jahr 1960 wesentlich katastrophalere Bedingungen als in anderen Kolonien anderer Nationen. In der Folge stürzte das Land bereits wenige Tage nach der Unabhängigkeitsdeklaration in einen schlimmen Bürgerkrieg.
Kenntnisreich ist auch der komplette Verfall des Staates unter Mobuto von 1965 bis zu seinem Sturz 1997 von Johnson ausgeleuchtet. Die manische Bereicherung der Führungsclique mit ihren grotesken Auswüchsen wurde mit Geheimdiensten und Todesschwadronen gestützt und abgesichert. Mobuto bediente sich des Staatshaushaltes gleich einer Privatkasse, die Korruption gelangte zu ungeahnter Blüte und die erst im Entstehen begriffene produktive Wirtschaft brach zusammen.
Überleben ist alles
Besonders lesenswert sind die Kapitel mit den Beschreibungen des Alltagslebens der Bevölkerung unter Kolonialmacht, Diktatur und Krieg. Deutlich wird der Niedergang jeglicher Rechtsnormen und das Entstehen einer florierenden illegalen und nicht formalisierten, d.h. regulierten Wirtschaft skizziert. Dominic Johnson beschreibt sehr präzise den Anpassungsdruck, dem die Bevölkerung ausgesetzt war und deren improvisiertes, auf reine Überlebensstrategien setzendes Verhalten. Die Energie der Menschen, insbesondere der Frauen, unter menschenunwürdigen Bedingungen das Überleben zu sichern, ihr Erfindungsreichtum und Witz – das ist alles lebendig vermittelt und zeichnet ein genaues Bild der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kongo.
Minutiöse Registrierung mancher Ereignisse
Die koloniale Politik der Belgier hatte zur Ethnisierung der kongolesischen Politik beigetragen, schreibt Johnson, es wurden notfalls sogar Ethnien erfunden, um die Bevölkerung zuzuordnen, zu spalten und zu beherrschen. Dieses Konstrukt der Ethnien verselbstständigte sich zunehmend und wurde zum Beispiel durch Netzwerkstrukturen innerhalb einer ohnehin informellen Wirtschaft verstärkt. Johnson versucht mit der Darstellung des weiteren Verlaufs der Geschichte des Landes nach der Machtübernahme durch Laurent Kabila 1997 dem Phänomen „ethnische Säuberungen“ (sprich: Massaker) einen Kontext zu verschaffen.
Die nun folgenden Machtkämpfe werden von Johnson nach tagesaktuellen Nachrichten notiert – eine detailreiche Schilderung von Allianzen und Gegenallianzen, Spaltungen und Umgruppierungen diverser Parteien, Rebellenorganisationen, Milizen, Gruppen, Splitter- und Untergruppen. Diese Registrierung der Ereignisse – eine bemerkenswerte Fleißarbeit des Autors – nimmt den größten Teil des Buches ein.
Sichtweisen?
Ökonomische Interessen wie die Ausbeutung der Rohstoffe spielten und spielen nach Meinung Johnsons keine wichtige Rolle im – bis heute andauernden – Kampf um die Vorherrschaft in der Krisenregion Ost-Kongo. Bei der Frage um Ruandas Präsenz in dieser Region folgt er ganz der ruandischen Argumentation, nach der es sich ausschließlich um die Bekämpfung der Hutu-Milizen handeln soll, die für den Völkermord in Ruanda 1994 verantwortlich waren und die vom Ost-Kongo aus angriffen.
Auch der wertvolle Rohstoff Coltan – und die Boykottveranstaltungen gegen die Coltanausbeutung zu Kriegszwecken – sei, so der Autor, kein wichtiges Thema, die Empörung der Öffentlichkeit einseitig und auf uninformierter Grundlage stehend. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Interessanterweise stellt Thomas Scheen, Afrikakorrespondent der FAZ, die Bedeutung der Rohstoffkämpfe vollkommen anders dar, indem er unter anderem von der „systematisch betriebenen Plünderung der kongolesischen Bodenschätze“ durch Ruandas Armee spricht. (FAZ vom 19.02.1008) Ruandas Armee hat nicht nur lange Zeit militärisch im Kongo operiert, sondern auch Rebellengruppen unterstützt und sich unter anderem durch den illegalen Coltan-Handel finanziert. In einem „Spiegel“-Artikel von 2005 schrieb Thilo Thielke: „Seit Jahren profitiert die Regierung in Kigali (Ruandas Hauptstadt) vom Chaos im großen Kongo und beutet dort systematisch Bodenschätze aus …Deshalb hat Ruanda die Wirren immer wieder neu geschürt.“
In einem Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen von 2001 heißt es dazu: „Der Konflikt in der DRC (Demokratischen Republik Kongo) dreht sich hauptsächlich um Zugang zu, Kontrolle von und Handel mit fünf mineralischen Ressourcen. … Die Folgen der illegalen Ausbeutung führen zu massiver Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen für Ruandas Armee.“
Nach dem Völkermord in Ruanda flohen Millionen Hutu vor der anrückenden Tutsi-Armee in die Republik Kongo. Bei den Rachefeldzügen gegen die Völkermörder verloren laut Berichten der Hilfsorganisation „Médecins sans frontières“ in einem „Ausrottungskrieg“ zwischen 190.000 und anderen Schätzungen zufolge 220.000 Hutu ihr Leben. Dieser so genannte zweite Genozid von 1997, fand laut Johnson so nicht statt. Die Opferzahlen der Hutu-Flüchtlinge seien nicht dem Morden der ruandischen Armee geschuldet, sondern: „Das war die geschätzte Zahl der Menschen, die Hilfswerke danach nicht mehr finden konnten.“ Auch das ist eher bemerkenswert.
Ähnlich verhält es sich bei den Opferzahlen der Kriege im Kongo. Thomas Scheen schrieb in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 24.02.2008 über „… die beiden ruandischen Angriffskriege auf Kongo, bei denen direkt und indirekt fünf Millionen Menschen ums Leben kamen; fünfmal mehr als beim ruandischen Genozid.“ Das „International Rescue Commitee“ schätzt die Zahl der Opfer der Kongokriege auf 5,4 Millionen Menschen. Johnson spricht dagegen von Fehlern bei der statistischen Auswertung mit propagandistischem Schlagzeileneffekt. Bemerkenswert auch das.
Und lediglich Sichtweisen? Auch die zwischenstaatlichen Beziehungen wurden offenbar nicht von Ruandas nach innen repressiver und nach außen expansiver Politik beeinträchtigt. Bundeskanzlerin Merkel erklärte zum Empfang von Ruandas Präsident Kagame am 23.04.2008 in Berlin der Presse: „Wir haben ein sehr, sehr gutes Fundament für unsere Kooperation … Wir wollen diese Beziehungen intensivieren.“
Licht ins Dunkel?
Johnsons Buch liefert akribisch Innenansichten, die äußeren Einflüsse kommen dagegen viel zu kurz. Von einer Verantwortung Ruandas an den Unruhen im Kongo ist keine Rede. Offensichtlich sind sowohl die französische als auch die spanische Justiz anderer Meinung. Schon 2006 hat der französische Antiterror-Richter Bruguière Haftbefehl gegen einige ruandische Militärs erlassen. Vor kurzem hat auch Spanien wegen „Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Terrorismus“ Haftbefehle gegen fast alle ehemaligen hochrangigen militärischen Führer der ruandischen Tutsi-Rebellenarmee (FPR) erlassen. Ausgenommen hiervon wurde Paul Kagame, der nur aufgrund seines Präsidentenstatus Immunität besitzt.
Kommt jetzt also Licht in das Dunkel der verwirrenden Geschichte und ihrer öffentlichen Darstellung? Oder ist die Geschichte des Kongo – und deren Rezeption in den deutschen Medien – auch eine Chronik enttäuschter Hoffnungen? Wer beansprucht die Deutungshoheit – und wer hat Recht?
Auf einer Expertenrunde, organisiert vom „Ökumenischen Netz Zentralafrika“, zum Einfluss der Wahlen in Ruanda auf die Region der Großen Seen, die am 8. September in Berlin stattfand, waren auch keine klaren Worte zum Einfluss des autokratischen Regimes in Ruanda auf die Krisenregion Ost-Kongo zu hören. Trotzdem wurde jedes Wort mitgeschrieben – von zwei Herren von der ruandischen Regierung. Sie waren (bis auf einen international renommierten Laienprediger) die einzigen Vertreter Ruandas bei dieser Gesprächsrunde. Niemand sonst hat es gewagt, sich öffentlich zu äußern, erläuterte die Veranstalterin in schon fast rührender Offenheit, das war allen zu gefährlich.
Pressefreiheit, so ließ Dominic Johnson auf dieser Veranstaltung verlauten, sei nicht so wichtig. Die Leute läsen sowieso keine Zeitung. Er meinte das im Hinblick auf Ruanda. Nicht gemünzt auf die Deutschen, die Zeitungen lesen. Oder etwa doch?
Lena Blaudez
Dominic Johnson: Kongo: Kriege, Korruption und die Kunst des Überlebens.
Verlag Brandes und Apsel. Frankfurt am Main 2008. 212 Seiten. 20,00 Euro.
Lena Blaudez im Unionsverlag











