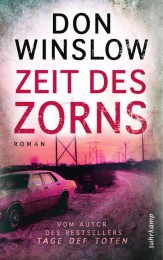 ¡Vamos a matar!
¡Vamos a matar!
Don Winslows neuer Roman „Zeit des Zorns“ erzählt eine kleine Geschichte. Wie er sie erzählt, das ist ganz groß. Ein Plädoyer für gute Romane von Thomas Wörtche.
Nach dem Riesenpanorama „Tage der Toten“ hat [[Don Winslow]] jetzt mit „Zeit des Zorns“ ein Detail aus demselben Themenkreis ausgekoppelt – ein Genre-Bildchen, im malerischen Sinn. Eine kleine, schmutzige Geschichte, ein B-Movie mit allen Vorzügen eines bescheidenen production designs. Subversiv, abseits des Mainstreams, eine Geschichte aus unseren Tagen eben. Stilisiert und somit verdichtet. Keine Kolportage, keine fiktionalisierte Reportage, sondern Genre pur, im literarischen Sinn.
Es geht, wie in „Tage der Toten“, um die mexikanischen Drogenkartelle, vor allem in Grenznähe zu den USA, deren Wirken schon längst nach Kalifornien hineinreicht. Besonders das Baja-Kartell (so genannt nach der Baja de California, mit [[Tijuana]] und [[San Diego]] als Achse diesseits und jenseits der Grenze) hat gerade mit internen Machtkämpfen zu tun und muss sich gegen Politik und humorlose Rivalen, die Leute gerne in Säurefässer stopfen, durchsetzen. „Das Kartell“ ist ein kleiner Euphemismus, denn die Organisation wird von Elena Lauter gnadenlos macchiavellistisch geführt, zumal sie sich mit Los Zetas, einer besonders brutalen mexikanischen Polizei-Einheit verbündet hat, die ihrerseits auf den ersten Fehler lauert. La jefe muss aufpassen, nach außen, aber erst recht nach innen. Gnade, Milde, Fairness, Kompromissbereitschaft, all die dämpfenden, einhegenden und deeskalierenden Techniken sind zwar taktisch willkommen, strategisch aber ausgeschlossen. Sie gelten als Weichheit, als Schwäche, als Achillesferse. Necare necesse est …
Eine Expansion, vielleicht sogar eine Verlagerung des Geschäfts in die USA wäre in diesen harten Zeiten gar nicht schlecht, zumal mit dem dortigen Markt für Designer-Dope eine Menge Kohle zu machen ist.
Gute Drogen …
Also erhalten Ben, Chon & O, die eine kleine, aber feine Herstellungs- und Distributionsfirma für Top-Quality-Hydro-Gras betreiben, eines Tages Geschäftspost: Das Baja-Kartell möchte verhandeln und schickt als Eröffnungsangebot ein Video, das sieben mit der Motorsäge geköpfte Menschen zeigt, die die Verhandlungsziele des Kartells nicht wohlwollend in Betrachtung gezogen hatten.
Unser Trio, das aus Überzeugung und Begeisterung im Narco-Business ist, muss sich etwas einfallen lassen. Ben ist ein Öko-Nerd, der sein Geld in allerlei gutmenschhafte Projekte in der Dritten Welt investiert; Chon, ein durchgeknallter, schwer traumatisierter Ex-Marine mit Freude an seinem notfalls totbringenden Job, ist der Mann fürs Grobe. Und Ophelia, genannt O, ist eine flippige Millionärstochter, mit einer völlig durchgedrehten Althippiebraut als Mutter, und an nichts so sehr interessiert wie an lauthals herausgebrüllten multiplen Gigaorgasmen und Powershopping, hochintelligent, witzig und von blendender Schönheit. Gut und edel sind sie alle drei bei weitem nicht, auf gar keinen Fall. Aber charmant ….
Sie unterhalten eine glückliche menage à trois, ein vages Echo an „Jules & Jim“, so wie das ganze Buch eine zeitgenössische Variante von „Butch Cassidy & Sundance Kid“ ist und eine sehr liebevolle Hommage dazu.
Es kommt wie es kommen muss, das Kartell schnappt sich O, baut Videokamera und Kettensäge auf und stellt Ultimaten. Die Jungs versuchen mit List und Tücke aus der Falle zu kommen und ihre geliebte O herauszuholen, koste es, was es wolle. Sie sind kreativ, genial, unkonventionell, gewalttätig, skrupellos und durchtrieben. Sie würden sogar notfalls ehrlich spielen. Aber ach, Verhandlungen, siehe oben, sind systemisch eigentlich und bis zum bitteren Ende nicht vorgesehen.
Kein Epos, bloß nicht …
Winslow inszeniert seine bewusst einfache Geschichte mit raffinierten literarischen Mitteln: Alles, was an episches, gar psychologisierendes Erzählen erinnern könnte, löst er auf. Anakoluthe, eingestreute Textsorten wie imaginäre Drehbuchsequenzen, Protokolle, alberne Auflistungen, typographischer Scherz und Frohsinn und viele kleine Gemmen der Erzählkunst mehr. Alles sehr intelligent eingesetzt, von Conny Lösch entsprechend intelligent übersetzt, nie selbstzweckhaft, nie manieriert. So entsteht nebenbei ein Kriminalroman, der sich über literarische Krimis und „mehr-als-ein-Krimi“-Krimis lustig macht und natürlich ein hochartifizieller Roman mit erheblichem „Literarizitätsfaktor“ ist – und damit auch die große Klasse von Winslow belegt. Denn seine stilistische und formale Virtuosität kommt heiter und leichtfüßig rüber (die Figur O ist, neben vielen anderen Dingen mehr, eine nahe Verwandte der „Flapper“ aus Hawks- und Capra-Komödien, in ihren Dialoge hallen Echos von Ben Hecht wider), dazu gesellen sich satirische, zynische, schnoddrige, lyrische, sentimentale und poetische Passagen. Verschiedene Fallhöhen, Nuancen und Schattierungen aller Art sorgen dafür, dass der Roman nirgends eindeutig wird, nicht dominiert wird von einer dogmatischen Perspektive. Der deutsche Titel „Zeit des Zorns“ hat einen pathetisch-aufgeregten Akzent, der das Buch viel zu sehr verengt. Die „kleine“ Geschichte birgt große ästhetische Möglichkeiten, ohne sich aufzublasen.
Sex & drugs & violence
„Zeit des Zorns“ ist auch ein erfreulich deutliches Manifest wider den puritanischen Zeitgeist. Es feiert guten Sex auch außerhalb der family values, die amour fou, die Liebe an und für sich, gute Drogen und den Spaß am Leben und das Recht, all das notfalls mit großkalibrigen Waffen gegen die gierigen Bestien, die auf Macht und Profit aus sind, zu verteidigen. Auch wenn die Realität eher anders aussieht und das Ende allzu düster zu sein scheint. Was aber auch immer unserem Trio zustößt, es passiert nicht aus implizit moralischen Gründen, als Strafe für anti-amerikanisches oder libertinäres Verhalten (so wie die sexuell aktiven Frauen im Horrorfilm und im deutschen Fernsehgrimmi meistens dran glauben müssen). Ganz am Ende hat sowieso die Liebe gesiegt, zumindest transzendent gesehen.

Don Winslow
… contra gentiles
Die realen Bestien, also die Savages aus dem Originaltitel, sind allerdings auch deswegen nicht mit anderen Mitteln als mit Gewalt zu stoppen, weil sie konstitutiver Teil der Gesellschaften geworden sind. Der mexikanischen, dem handelsüblichen Klischee zufolge, sowieso. Aber eben auch der US-amerikanischen Gesellschaft, die hinter den Werten des Neokonservativismus und des christlichen Fundamentalismus völlig korrupt, also dem Gesetz der Profitmaximierung ohne Limits erlegen ist.
Aus dieser Analyse heraus einen fast heiteren Roman und keine düstere Anklageschrift aus dem Geiste des kitsch-noir machen zu können, ist eine der ganz entscheidenden Qualitäten von Don Winslow.
Thomas Wörtche
Don Winslow: Zeit des Zorns. (Savages, 2010). Roman. Deutsch von Conny Lösch. Berlin: Suhrkamp 2011. 338 Seiten, 14,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. „Tage der Toten“ bei cultmag.











