Joachim Feldmann hatte im Urlaub eine Reisetasche voller Bücher dabei und kam sogar zum Lesen. Ein kleiner Streifzug quer durchs Rosenbeet.
 England im Juli: Kaum sind die Schlagzeilen über eine bedrohliche Hitzewelle, die nicht einmal eine Woche währte, vergessen, weiß Britanniens Presse von neuen Bedrohungen des friedlichen Zusammenlebens auf der Insel zu berichten. Wildgewordene Seemöwen attackieren Hunde, Schildkröten und Menschen, während sich an Flüssen und Seen der Große Bärenklau, ein unerwünschter Einwanderer aus dem Kaukasus, vor dessen Rückkehr die Band Genesis bereits 1971 („The Return of the Giant Hogweed“) warnte, in seiner ganzen Giftigkeit breitmacht.
England im Juli: Kaum sind die Schlagzeilen über eine bedrohliche Hitzewelle, die nicht einmal eine Woche währte, vergessen, weiß Britanniens Presse von neuen Bedrohungen des friedlichen Zusammenlebens auf der Insel zu berichten. Wildgewordene Seemöwen attackieren Hunde, Schildkröten und Menschen, während sich an Flüssen und Seen der Große Bärenklau, ein unerwünschter Einwanderer aus dem Kaukasus, vor dessen Rückkehr die Band Genesis bereits 1971 („The Return of the Giant Hogweed“) warnte, in seiner ganzen Giftigkeit breitmacht.
Dieser Tage ist es allerdings selbst für harmlose Touristen wie unsereinen nicht so leicht, ins Vereinigte Königreich zu gelangen. Die Anreise über Calais wurde von streikenden französischen Arbeitern verhindert und im erheblich kleineren Ausweichhafen von Dünkirchen stauten sich die Fahrzeuge. So dauerte es fast zwei Tage, bis wir endlich unser Ferienhäuschen im malerischen Küstenstädtchen Lyme Regis in Dorset beziehen durften. Kiloschwere Büchertaschen mit Urlaubslektüre wurden geleert und der Lektürevorrat für vierzehn Tage auf der Schlafzimmerkommode gestapelt, darunter jede Menge Kriminalromane, von denen nun die Rede sein wird.
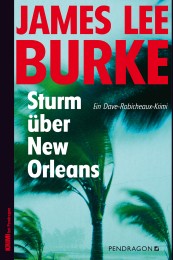 James Lee Burke und Dave Robicheaux
James Lee Burke und Dave Robicheaux
Endlich konnte ich mich in aller Ruhe den fast 600 Seiten von James Lee Burkes monumentalem Roman „Sturm über New Orleans“ widmen, der acht Jahre nach dem Original („The Tin Roof Blowdown“, 2007) endlich auf Deutsch erschienen ist. Und das mit großem und, wie ich nach der Lektüre gerne bestätige, berechtigtem Erfolg. Burke zeichnet das eindringliche Sittenbild einer Stadt, die von einer Naturkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes heimgesucht wird. Dass es so schlimm kam, lag allerdings nicht allein in der Verantwortung des Wirbelsturms Katrina, der eine meterhohe Flutwelle durch New Orleans schickte, sondern war auch Menschenwerk in seinen übelsten Ausprägungen: Nachlässigkeit, Ignoranz und Profitgier. Das ist das eigentliche Thema dieses Buches.
Dave Robicheaux allerdings, Burkes Serienermittler in mittlerweile zwanzig Romanen, muss sich anderen Verbrechen widmen. Wie er sie aufklärt, wird spannend und komplex erzählt. Dass sich an der grundsätzlichen Lage wenig ändert, versteht sich von selbst. Wenn „Sturm über New Orleans“ überhaupt eine Schwäche zu attestieren ist, könnte man auf die Figur eines psychopathischen Mörders hinweisen, wie sie in Burkes Werk nicht selten zu finden ist. Darüber wird vielleicht noch im Herbst zu reden sein, wenn bei Heyne ein weiterer Roman um Sheriff Hackberry Holland erscheint, der zum zweiten Mal von seiner Nemesis, Preacher Jack Collins, heimgesucht wird. (Siehe dazu James Lee Burke himself in dieser CM-September-Ausgabe.)
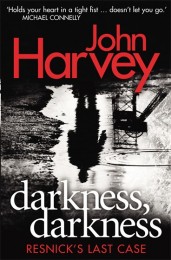 John Harvey und Charlie Resnick
John Harvey und Charlie Resnick
Genialisch-verrückte Verbrecher tragen nicht immer zur Qualität von Kriminalromanen bei, wie auch die Leser des englischen Autors John Harvey wissen, dessen beste Bücher Klassiker der Spannungsliteratur sind. (Auch er ist in dieser CM-Ausgabe vertreten – als Westernautor.) Kaum war sein Ermittler Charlie Resnick, der melancholische Sandwich- und Jazz-Experte aus Nottingham mit einem irren Killer konfrontiert, fühlte man sich ein wenig düpiert. Zum Glück ist dies in „darkness, darkness“, dem zwölften Band der Reihe, in dem Resnick seinen Abschied nimmt, nicht der Fall.
Der pensionierte Kriminalist widmet sich in offiziellem Auftrag dem Schicksal einer jungen Frau, die dreißig Jahre zuvor während des großen Bergarbeiterstreiks verschwunden ist und, wie sich herausstellt, als bei Bauarbeiten ein Skelett gefunden wird, gewaltsam zu Tode gebracht wurde. „darkness, darkness“ verzichtet auf jeden Sensationalismus, ist aber dennoch hochdramatisch. Auch nach Jahrzehnten sind die Spuren des erbittert geführten und letztendlich gescheiterten Arbeitskampfes noch erkennbar, was Resnick bei jedem Zeugengespräch spürt. Die Auflösung des Falles zeigt wieder einmal die schäbige Seite des menschlichen Zusammenlebens. Am Ende ist Charlie Resnick allein und überlegt, ob er sich neu erschienene Live-Aufnahmen seines Lieblingsmusikers Thelonious Monk mit bislang unbekannten Versionen bekannter Stücke zulegen soll. Wie er sich entscheidet, bleibt offen. Und wir nehmen gerührt Abschied von einer großartigen Detektivfigur.
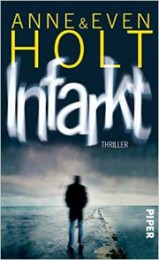 Holt & Holt und Kerr: No sports
Holt & Holt und Kerr: No sports
Dieses Buch befand sich übrigens nicht im Gepäck. Ich war froh, es in einer Buchhandlung im benachbarten Dorchester zu finden, nachdem mir Philip Kerrs erster Fußballkrimi, „Der Wintertransfer“ („January Window“, 2014), nur bescheidenes Vergnügen bereitet hatte. Als der streitbare Trainer eines Londoner Fußballclubs ermordet wird, ist die Zahl der Verdächtigen hoch. In fast klassischer „Wer hat’s getan“-Manier geht Co-Trainer Scott Manson an die Ermittlungsarbeit, um schließlich eine ausgesprochen banale Auflösung zu präsentieren. Interessierte ich mich wirklich für Fußball, wäre mir all das, was man über die Zustände im internationalen Geschäft mit den hochbezahlten Rasenkünstlern erfährt, bekannt gewesen.
So konnte ich gelegentlich staunen, was aber nicht ausreichte, um mich mit diesem dilettantisch geplotteten Krimi, den ich von einem geschätzten Autor wie Philip Kerr nicht erwartet hätte, zu versöhnen. Als ein klein wenig spannender, wenn auch recht vorhersehbar, erwies sich „Infarkt“ (Sudden Death, 2014), ein ebenfalls, zumindest vordergründig, im Milieu des englischen Profifußballs angesiedelter Medical Thriller aus der Werkstatt des norwegischen Autorenduos Holt & Holt, dessen Heldin, die Kardiologin Sarah Zuckerman, mich auf ungute Weise an Patricia Cornwells Pathologin Kay Scarpetta erinnert. Natürlich geht es hier nicht nur um Sport, sondern vor allem um Wirtschaft, Politik und internationale Verschwörungen incl. israelischer Geheimdienstmachenschaften. Ich kann mir viele begeisterte Leserinnen dieses erzählökomisch ausgesprochen effizienten Schmökers vorstellen.
Ich selbst halte es lieber mit einem Berichterstatter, dessen Leidenschaft für Kaffee und Zigaretten es in jeder Hinsicht mit seinem Ermittlerinstinkt aufnehmen kann. Effizienz ist nämlich nicht gerade der zweite Vorname des Istanbuler Privatdetektivs Remzi Ümal, der in seinem fünften auf Deutsch vorliegenden Abenteuer „Lass mich leben, Istanbul“ (Ates Etme, Istanbul. 2013) in einen komplizierten Fall stolpert, dessen Verwicklungen schon aufgrund einer Vielzahl hübscher Krankenschwestern für Verwirrung sorgen. Doch das war wohl auch schon bei den amerikanischen Vätern dieses unverwüstlichen Genres so. Celil Oker allerdings stattet seinen Protagonisten mit einer gehörigen Portion Selbstironie und entsprechendem Wortwitz aus, dass es die pure Freude ist. Schlagfertig ist der Mann übrigens auch, und dies nicht nur im metaphorischen Sinne.
 Ruth Rendell: Chief Inspector Wexford
Ruth Rendell: Chief Inspector Wexford
Nach so viel Lesevergnügen war der Weg zum Genuss ohne Reue bestens bereitet. Schon zu Beginn unsers Aufenthalts war mit ein formidables Antiquariat incl. Frühstückspension aufgefallen, in dessen höhlenartigen Räumlichkeiten Unmengen an bedrucktem Papier auf Käufer warten. Etliche Meter abgewetzte Paperbacks aus den letzten fünfzig Jahren füllen die Krimiregale, darunter (geschätzt) mehrere hundert Agatha Christies. Nach denen stand mir nicht der Sinn, stattdessen entschied ich mich für Ruth Rendell. Drei schmale Bändchen, erstmals zwischen 1971 und 1978 erschienen, sollten mir die letzten Urlaubstage versüßen. Schließlich würden uns diese nach Sussex, wo Rendells Chief Inspector Wexford seine verzwickten Fälle löst, führen. Und was gibt es Schöneres, als an einem Teich im Garten des Charleston Farmhouse, dem ländlichen Zentrum des Bloomsbury Sets um Dancan Grant und Vanessa Bell, zu sitzen und von Verbrechen zu lesen, die sich mit Hilfe eines Wörterbuchs der englischen Sprache aufklären lassen.
Wexford kommt einem raffinierten (angeblichen) Gattenmord auf die Spur, löst das Rätsel einer Doppelexistenz und muss sich mit einer klandestinen Sekte herumschlagen. Und immer wieder verschlägt es ihn vom ländlichen Kingsmarkham in die Metropole London, wo er sich mit schöner Regelmäßigkeit verirrt. Ruth Rendell, eine Virtuosin des auktorialen Erzählens, spart in der Beschreibung ihres Ermittlers nicht an mildem Spott. Zudem ist sie eine wache Beobachterin gesellschaftlicher Zustände. Wer also in irgendeiner Grabbelkiste Ullstein- oder Goldmann-Taschenbücher mit Titeln wie „Die Tote im falschen Grab“ oder „Leben mit doppeltem Boden“ findet, sollte nicht zögern, sie zu erwerben.
Für uns ging der Urlaub leider dem Ende entgegen. Während wir die Koffer packten, wurde in den Nachrichten von der tödlich endenden Begegnung zweier Autofahrer ganz in der Nähe berichtet. Ein 79-jähriger pensionierter Rechtsanwalt hatte das Fahrzeug eines 34-jährigen Gärtners gestreift, woraufhin dieser zum Messer griff und den alten Mann erstach. „Road Rage“ heißt das Phänomen, und Ruth Rendell hat ihm 1997 einen Roman gewidmet. Unsere Rückreise nach Deutschland verlief ohne Zwischenfälle.
Joachim Feldmann
Literatur:
James Lee Burke: Sturm über New Orleans. (The Tin Roof Blowdown). 576 Seiten. Bielefeld: Pendragon 2015. € 17,99.
John Harvey: darkness, darkness. 419 Seiten. London: Arrow Books 2014. Ca. € 9,50.
Philip Kerr: Der Wintertransfer. (January Window. 2014). Aus dem Englischen von Axel Merz. 425 Seiten. Stuttgart: Tropen Verlag 2015. € 14,25.
Anne & Even Holt: Infarkt. (Sudden Death. 2014). Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. 440 Seiten. München: Piper 2015. € 19,99.
Celil Oker: Lass mich leben, Istanbul. Ein Fall für Remzi Ünal. (Ates Etme, Istanbul. 2013). 314 Seiten. Zürich: Unionsverlag 2015. € 19,95.
Die deutschen Übersetzungen von Ruth Rendells Romanen „Murder Being Once Done“ (Die Tote im falschen Grab), „Shake Hands Forever” (Der Kuss der Schlange) und „A Sleeping Life” (Leben mit doppeltem Boden) sind in unterschiedlichen Ausgaben antiquarisch erhältlich.












