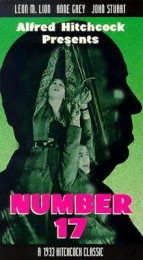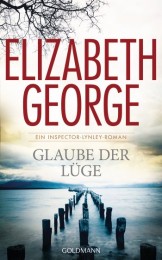 Der 17te Lynley
Der 17te Lynley
– Literaturkritik kann müde machen. Aber notwendig ist sie doch. Henrike Heiland über den neuen Roman von Elizabeth George.
Welche Aufgabe die Literaturkritik hat, darüber kann man nächtelang diskutieren. Und ob sie nicht mittlerweile obsolet ist, wo doch die Kaufempfehlungen von privat und die Endverbrauchermeinungen so sehr an Einfluss gewonnen haben, steht als Frage immer wieder im Raum. Umgekehrt wird nach übergeordnetem Orientierungswissen gerufen.
Die Kritikerin
Ein Literaturkritiker geht anders an ein zu rezensierendes Werk heran als der Endverbraucher. Letzterem ist der Kritiker zu sehr auf einem hohen Ross unterwegs, Ersterem ist der Endverbraucher zu beliebig, zu emotional, zu wenig vom Fach. Stellt sich in der Tat die Frage, welchen Sinn es hat, in eine Buchbesprechung zu schreiben: „Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen.“ Oder: „Vor lauter Begeisterung über das Buch blieb ich aus Versehen drei Stunden in der Badewanne, und jetzt bin ich erkältet.“ Auch gerne: „Wegen dieses spannenden Buchs habe ich tatsächlich schon mehrfach meine Haltestelle verpasst.“ Und ein Evergreen: „Mein Mann musste sich selbst was zu essen machen, weil ich nicht aufhören konnte zu lesen.“ Da sagt der Kritiker: Firlefanz, das sagt mir nichts übers Buch, nur was über den Zustand des Lesers, dabei will ich doch wissen, warum das Buch spannend ist – sind die Figuren so fesselnd, ist es der geschickt verwobene Plot, oder packt einen das Thema, liegt es vielleicht am besonders prägnanten Stil des Autors? Den größten Teil der Endverbraucher, die nun mal einfach lesen, um unterhalten zu werden, interessieren möglicherweise diese Tiefenanalysen gar nicht. Die wollen nur wissen: War’s denn nun spannend oder nicht? Und dass man da einer emotional getroffenen Aussage eines Gleichgesinnten eher folgt als einer diskurstheoretischen Analyse, die am Ende möglicherweise noch ein unentschiedenes Fazit liefert, liegt auf der Hand. Trotzdem haben diese emotional getroffenen Aussagen nichts in einer Besprechung zu suchen, die ernst genommen werden möchte.
Ehrlich gesagt ist mir das gerade vollkommen egal. Und da es der Rezensentin (das bin ich) gerade in den Fingern juckt: Wissen Sie eigentlich, wie ich mich beim Lesen von „Glaube der Lüge“ gefühlt habe? Ich sag es Ihnen. Ich bin mehr als einmal mit dem Kopf ins Buch gekippt. Aus verschiedenen Gründen. Aus Müdigkeit. Aus Verzweiflung. Aus Enttäuschung. Sicherlich auch aus Fassungslosigkeit. Ja, ich konnte das Buch sehr gut aus der Hand legen, und es fiel mir schwer, es wieder in die Hand zu nehmen. Der ziegelsteinartige Umfang half dabei nicht wirklich. Jetzt liegt das Buch auf meinem Schreibtisch und starrt mich vorwurfsvoll an. Ich versuche, nicht hinzusehen, um nicht weiter daran erinnert zu werden. Ich werde es in eine ganz dunkle Ecke räumen müssen. Von dem Buch habe ich mich ganz, ganz schlecht gefühlt, und dass mich an jeder Ecke gerade riesige Plakate mit dem Slogan „George ist spannender“ anspringen, macht es nicht besser.
Die Serie
Und jetzt zum Wesentlichen: dem Buch, der Autorin, der Serie.
„Glaube der Lüge“ ist der 17. Lynley-Roman, und eigentlich könnte man jetzt einen Punkt machen und schweigen. Nämlich: der Fluch der Serie. Dass Elizabeth George irgendwann nichts Vernünftiges mit ihren Figuren mehr einfallen würde, war klar. Das liegt nicht allein in der Natur der Seriensache, sondern vor allem in der Natur der Lynley-Serie. Aber der Reihe nach. Serienfiguren, die mitwachsen, älter werden und sich verändern, sind eine Pest. Agatha Christie würde nicht wissen, was gemeint ist, weil sie ihre Figuren vielleicht etwas altern ließ, aber sie blieben gleich. Sie würde heute noch Miss Marple und Hercule Poirot exakt so beschreiben, wie sie es damals getan hat. Die beiden wären jetzt vermutlich 162 Jahre alt, aber Miss Marple würde ihren Tee trinken und sagen, dass X sie an Y aus ihrem Dorf erinnert, und eine kleine Anekdote auf Lager haben, die dann den Fall lösen hilft. Poirot würde seine kleinen grauen Zellen loben und auf den letzten zehn Seiten herumschwadronieren, warum was wie war. Und bei aller Kritik, die man an Christie üben kann – für ihre Serienfiguren hat sie da genau das Richtige gemacht. Man kennt es aus Fernsehserien: Nachdem die Nanny den Broadwayproduzenten geheiratet hatte, lief es nicht mehr so gut. Kaum ist das Binnenverhältnis der Hauptfiguren, das eine zusätzliche (schwebende) Spannung zu den einzelnen Episoden ausmacht, verändert, verändert sich zwangsläufig alles andere auch. Das gilt auch für das Interesse der Zuschauer. Gleiches gilt für Romanserien. Allerdings wird es auf Dauer auch wieder fad, die immer gleichen Figuren mit den immer gleichen Problemen ohne Entwicklung herumzuschieben. Und möchten die Leser nicht doch etwas mehr wissen? Über dunkle Flecken aus der Vergangenheit? Über aktuelle Liebesaffären? Was auch immer? Ruth Rendell zum Beispiel löste dieses Problem bei ihrer Wexford-Reihe recht gut: Während Wexford zwar älter wird und sich um ihn herum einiges verändert, im Team wie auch zu Hause, ist doch Wexford immer Wexford. Viele andere Kriminalschriftsteller haben diesen Spagat ebenfalls hinbekommen: einerseits die verlässlichen Eigenschaften der Protagonisten beibehalten (man kennt die Figur), andererseits interessante Änderungen in deren Umfeld einführen (man lernt etwas Neues über sie).
Elizabeth George wollte mehr. Sie führte von Anfang an ein kompliziertes Geflecht aus fünf starken Figuren ein, dazu noch das erweiterte Ermittlungsteam. Sie öffnete den Kriminalroman in Richtung Soap/Telenovela/Familiensaga. Die schwierigen, emotional dauerbelasteten Beziehungen der Figuren zueinander nahmen im Laufe der Zeit immer mehr Platz ein. Die Figuren begannen außerdem, sich wesentlich zu verändern. Lynley ist seit sehr vielen Büchern nicht mehr der, der er anfangs noch war, und das nicht nur, weil seine Frau ermordet worden ist. Und Barbara Havers wurde von einer Hoffnungsträgerin zu einem Trauerspiel. Statt eine starke Frauenfigur aus der Arbeiterklasse zu zeigen, statt echte Probleme einer Frau in diesem Beruf abzubilden, wird die Leserschaft mit im Grunde antifeministischem Quark genervt: Havers ist zu dick, zu hässlich, zu schlecht angezogen. Und dann noch die unerfüllte Liebe. Verschenkt.
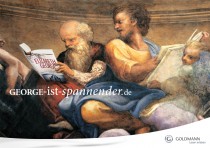 Der 17te
Der 17te
Nun sitzt man also mit Band 17 (der sich anfühlt wie Band 217) ratlos da und wird nicht nur damit belästigt, dass die Serienfiguren völlig verwaschen und blutleer (geworden) sind. Nein, man muss noch einem Fall folgen, der keiner ist. Was nicht heißen soll, dass ein Krimi nur spannend ist, wenn es einen echten Mordfall gibt. In „Glaube der Lüge“ gibt es aber kein wirklich interessantes Rätsel. Das Verhalten von Lynley und seinem Freund St. James und wer noch alles mit hineingezogen wird, ist ungefähr auf dem Level von TKKG – amateurhaft. Am schlimmsten: Ihnen allen fehlt eine echte Aufgabe, ein Abenteuer, das gemeinsam zu bestehen wäre. Vielleicht deshalb die Überfrachtung mit privatem Kram, der die Figuren um sich selbst kreisen lässt.
Und die anderen Beteiligten? Wo soll man da anfangen. Jede dieser Figuren wird ausführlich und ohne Maß vorgestellt, bis hin zum letzten langweiligen, dramaturgisch überflüssigsten Detail. Wir stoßen auf eine peinliche Mischung aus Überzeichnung und Blutarmut. Überfrachtet wird auch hier wieder, und auch hier wohl aufgrund der allgemeinen Ideenlosigkeit des Nicht-Plots. Vermeintlich brisante Themen, von Pädophilie bis künstliche Befruchtung, von Homosexualität bis jüdisches Leben, von Alkoholmissbrauch bis ungesunde Liebesbeziehungen erhalten Einzug, man verliert tatsächlich den Überblick, und damit das Interesse, so es je aufgekommen ist.
George hat einst richtig gute Bücher geschrieben. Doch, die ersten waren spannend, und man hoffte auf eine zunehmend kritische Auseinandersetzung mit dem britischen Klassensystem, mit feministischen Themen, mit Gesellschaftspolitik. George baute sehr gute Szenen, konnte Figuren wunderbar einführen, war handwerklich sehr klar mit Beschreibungen, Perspektiven und Dialogen, schaffte erstaunliche Wendungen. Und entschied sich offenbar eines Tages dafür, nur noch Seiten zu füllen. „Glaube der Lüge“ ist in Wirklichkeit Folge 17 der Telenovela „Tommy und die Frauen“, aber nicht mal als Gesellschaftsdrama, nicht mal als Liebesreigen, nicht mal als genreübergreifende oder -unabhängige Geschichte funktioniert dieses Buch.
Henrike Heiland
Elizabeth George: Glaube der Lüge (Believing the Lie, 2012). Deutsch von Norbert Möllemann und Charlotte Breuer. Goldmann: München 2012. 704 Seiten. 24,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Offizielle Website der Autorin. George bei Kaliber38. Homepage von Henrike Heiland.