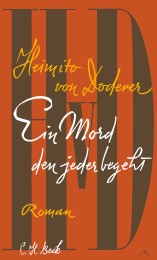 Die Peinigung der Begriffe – Ein Mord den jeder begeht
Die Peinigung der Begriffe – Ein Mord den jeder begeht
Gerade hat Eva Menasse in einem dringenden Appell zur neuerlichen Lektüre Heimito von Doderers aufgerufen. Topisch ist inzwischen allerdings auch die Einschätzung seines Romans „Der Mord den jeder begeht“ als Kriminalroman, als Mehr-als-ein-Kriminalroman, als literarischer Kriminalroman – auf jeden Fall als irgendetwas Nobles, Nicht-Triviales. Könnte es aber auch sein, dass es sich dabei lediglich um einen hilflosen Versuch handelte, schlicht einen Kriminalroman zu schreiben? Thomas Wörtche hat sich Heimito von Doderers Text noch einmal genauer angesehen.
Die Vorstellung, dass ich irgendetwas Neues über den “Ein Mord den jeder begeht” erzählen könnte, ist ziemlich abenteuerlich.
Mir, ehrlich gesagt, zu abenteuerlich!
Besonders nachdem ich die stupende und brillante Monographie von Martin Loew-Cadonna, “Zug um Zug”1, sorgfältig studiert habe, war ich sogar regelrecht mutlos: Was sollte ich, ein dilettierender, Noch-nicht-einmal-Amateur-Heimitist, danach noch über unseren Roman zu sagen haben? Martin Loew-Cadonna hat schließlich den ganzen MORD in seine feinsten Einzelteile zerlegt, diese aufs Subtilste beschrieben, ausgelegt, hin- und her gewogen und zu einem komplexen Interpretationsangebot über den Roman wieder zusammengesetzt. Da ist nichts unbedacht geblieben, nichts übersehen, kein loses Ende übrig.
Und das Schlimmste für mich dabei ist: Ich stimme fast jedem seiner Einzelbefunde zu!
Auf diese fatale Situation kann ich eigentlich nur auf eine Art reagieren: Gestützt auf die vielen, klugen Ergebnisse von Loew-Cadonna, die ich als gesichert betrachten möchte, kann ich versuchen, den MORD mit den Augen desjenigen anzugucken, der ein paar Jahrzehnte mit dem Nachdenken über das Wesen und Treiben von Kriminalliteratur en gros und en détail verbracht hat. Denn wenn wir den MORD in seiner Eigenschaft als Kriminalroman betrachten wollen, liegen da vielleicht meine Chancen, etwas Kernhaftes beizutragen.
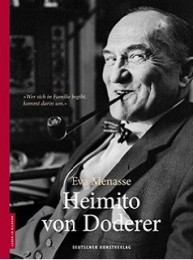 Denn dass der MORD überhaupt irgendetwas mit Kriminalliteratur zu tun hat, scheint ja beinahe Konsens zu sein. Ob er tatsächlich ein Kriminalroman ist oder ein Edel-Krimi oder ein Beinahe-Krimi oder überhaupt ein Krimi, ein Psychothriller avant la lettre, die Parodie eines Kriminalromans, oder ob er eher der merkwürdigen Textsorte der “Verbrechensdichtung” angehören mag – das alles lohnt sich ja nur zu bedenken, wenn es etwas Spezifisches bedeuten könnte, dass er ein Kriminalroman ist – oder eben nicht.
Denn dass der MORD überhaupt irgendetwas mit Kriminalliteratur zu tun hat, scheint ja beinahe Konsens zu sein. Ob er tatsächlich ein Kriminalroman ist oder ein Edel-Krimi oder ein Beinahe-Krimi oder überhaupt ein Krimi, ein Psychothriller avant la lettre, die Parodie eines Kriminalromans, oder ob er eher der merkwürdigen Textsorte der “Verbrechensdichtung” angehören mag – das alles lohnt sich ja nur zu bedenken, wenn es etwas Spezifisches bedeuten könnte, dass er ein Kriminalroman ist – oder eben nicht.
Und was dieses Spezifische dann wiederum sein könnte, ist schon gar nicht ausgemacht.
Schauen wir uns den Text ganz einfach an: Ein junger Mensch, Kokosch genannt, begeht während einer Zugfahrt aus einer Gruppe anderer junger Menschen heraus einen üblen Streich, als dessen Folge ein anderer Mensch zu Tode kommt. Er selbst hat von diesem letalen Ausgang nicht die geringste Ahnung, bis er zufällig in die Familie des Opfers einheiratet, eine seltsame, fast spirituelle “Beziehung” zur Toten entwickelt und sich, ominös getrieben, auf die Suche nach den wirklichen Umständen ihres Todes macht und peu à peu herausfindet, dass er selbst diesen Tod fahrlässig verschuldet hat. Nachdem er diese Erkenntnis gewonnen hat, fällt er einem bedauerlichen häuslichen Unfall zum Opfer. Finis novelae.
Kriminalroman?
Die Handlung des Romans so auf ihr Skelett reduziert, ist von Genre-Verdacht eigentlich recht weit entfernt. Es passiert kein Mord – höchstens fahrlässige Tötung, die jeder einigermaßen gewiefte Anwalt auf “Unfall mit Todesfolge” herunterhandeln könnte; wir werden nicht oder nur sehr marginal Zeuge einer professionellen, d.h. polizeilichen Untersuchung; die Ermittlung der wahren Todesursache des Opfers Louison Veik hat keine unmittelbaren juristischen Folgen für den Verursacher. Selbst eine etwaige Gewissensqual des Täters bleibt außen vor; und die Möglichkeit, dass sein Unfallende so etwas wie “poetische Gerechtigkeit” sein könnte, ist im Text nirgends ernsthaft angelegt.
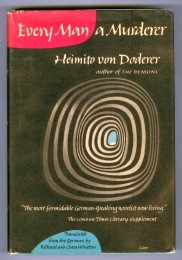 Die “Detection” schließlich ist nur der Bezeichnung nach eine. Zwar recherchiert Kokosch, verrennt sich red herring-artig in den falschen Täter, kann kaum triftige Beweise zusammentragen und ist am Ende auf den Zufall, auf das freiwillige Geständnis des Mittäters Botulitzky angewiesen. Man kann darin, wie hin und wieder in der Forschung vorgeschlagen, in der Tat gutwillig milde parodierende Züge auf den omnipotenten amateur sleuth à la Hercule Poirot sehen, aber zwingend ist das keineswegs.
Die “Detection” schließlich ist nur der Bezeichnung nach eine. Zwar recherchiert Kokosch, verrennt sich red herring-artig in den falschen Täter, kann kaum triftige Beweise zusammentragen und ist am Ende auf den Zufall, auf das freiwillige Geständnis des Mittäters Botulitzky angewiesen. Man kann darin, wie hin und wieder in der Forschung vorgeschlagen, in der Tat gutwillig milde parodierende Züge auf den omnipotenten amateur sleuth à la Hercule Poirot sehen, aber zwingend ist das keineswegs.
Auch das Milieu des MORD ist gut-bürgerlich, mit kleinen Ausfransungen. Gut-bürgerlich die Familie Castiletz, der untertänige und ordnungsliebende Kokosch gar der zeitgeistig aufsteigende Kleinbürger par excellence, Textilfabrikanten, höhere Beamte, Provinzadel, Angestellte – zum sexuellen Zeitvertreib von Castiletz fils eine kleine Näherin, (eine fast topische Grisette) und eine “Tippse” für père & fils gemeinsam; am Rande und in der großen, bösen Stadt Berlin ein paar Kleinganoven und Gelegenheits- resp. Elendsprostitution.
Bis auf den räsonierenden Polizisten Inkrat gibt es kein kriminalliterarisch typisches Personal.
Ein “Mordrätsel” im klassischen Sinn ist zugegebenermassen vorhanden – wie überhaupt konnte Louison Veik im verschlossenen Zugabteil zu Tode kommen? Aber diese Variation des locked-room mystery ist beileibe keine Dominante des Textes und seine Auflösung schließlich ist, naja, ein wenig arg konstruiert.
Gewalt-Aufkommen der physischen Art? Abseits des bösen Streichs im Zug, den Tobsuchtsanfällen von Castiletz senior und Tierquälerei: Null. Intrigen und Machinationen, finstere Ranküne, verbrecherisches mastermind oder ein master plot – Fehlanzeige.
Psychische Gewalt zwischen den Geschlechtern – Kokosch an Grisette Ida Plangl, Gattin Marianne an Kokosch, Vater Castiletz an Mutter & Sohn Castiletz usw. und so fort: Jede Menge, aber nicht im strafrechtlichen Bereich – höchstens im moralischen, aber so etwas gibt es von Shakespeare bis Dostojewski und ist kaum ein taugliches Differenzkriterium für Kriminalromane sui generis.
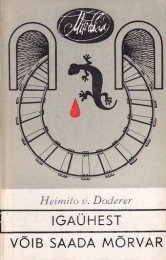 Thrill Factor im situativen Sinne – was wird genau jetzt passieren, wenn Protagonist A dieses oder jenes tut? – Null.
Thrill Factor im situativen Sinne – was wird genau jetzt passieren, wenn Protagonist A dieses oder jenes tut? – Null.
Suspense-Factor: Auf was läuft die Geschichte hinaus? Der wird allerdings zu diskutieren sein!
Bis jetzt, bei erster, oberflächlicher Betrachtung bleibt also festzustellen, dass Doderers Roman nur wenige, schwache Plot/Setting-Signale ausstrahlt, die man mit den landläufigen Vorstellungen von Kriminalroman assoziiert.
Und da ist natürlich noch der Titel des Romans: “Ein Mord den jeder begeht”. Aber Titel reichen schon gar nicht aus, um eine gattungsmäßig verlässliche Einschätzung vorzunehmen: Das taten sie bei “Schuld & Sühne” nicht, bei “In der Strafkolonie” nicht und beim “Prozeß” erst recht nicht …
Noch nicht einmal der Kontext des Dodererschen Œuvres, in dem der MORD nach Ansicht der Forschung singulär steht (wieso eigentlich, müssten wir uns nachher fragen) lässt einen zwingenden Schluss auf einen Kriminalroman zu. Höchstens ein paar verstreute Notizen des Autors im Vorfeld der Niederschrift gibt es und knappe Reflexe auf Leo Perutz und Otto Soyka (der nicht gerade zu den big names des Genres zählt), wogegen eine einlässliche Beschäftigung Doderers mit den aktuellen Ausprägungen des Genres in seiner Zeit zumindest mir verborgen geblieben sind. Im Text gibt es magere Bezüge zu dem damals historisch gewordenen Sherlock Holmes von Conan Doyle – wir schreiben die Jahre 1929-1938, von der ersten Konzeption bis zur Drucklegung des MORD -, aber auffallend nicht zu den zeitgenössischen, gar avancierten Namen des Genres: Nicht zu Friedrich Glauser, nicht zu Georges Simenon, nicht einmal zur damals gerade notorisch werdenden Agatha Christie, schon gar nicht zu Dashiell Hammett. Die großen Essays von Kracauer (1925) und Brecht (1934) zum Krimi liegen ebenfalls außerhalb von Doderers Wahrnehmung.
Bleibt also der Rekurs aufs Formale: Loew-Cadonna hat eindrucksvoll nachgewiesen, wie funktional dicht Doderer diesen Roman im Gegensatz zu seinen anders gewebten Texten, erzählt.
Trivial?
Ein jedes Element – egal auf welcher Stufe des “Bedeutungsaufbaus des literarischen Werks” (nach Miroslaw Červenka)2 wir uns befinden – ist funktional determiniert: Was auch immer uns die narration verrät, der gewählte Ausschnitt der Realität(sfiktion), das, was wir über das Innenleben der Figuren wissen müssen (oder sollen), die erzählerische Vorgriffe, die Andeutungen – all das ist am Ende des Romans aufgelöst, jedes einzelne Bausteinchen wohl verfugt – manchmal geschickt, manchmal weniger geschickt, wie das Detail des elektrotechnisch betrüblichen Zustands der Klingel im Hause Hohenlocher, die schon bei ihrem ersten Auftreten die anstehende Katastrophe herausschreit. Selbst Kokosch, der fatale Held der Geschichte, ist zum Schluss rest-los entsorgt.
Dieses radikal-funktionale (oder pan-funktionale) Erzählen als Verfahren kennen wir in der Tat aus einschlägigen Texten: Aus Kriminalromanen des sog. “Häkelmusters”, also aus “Krimis” à la Agatha Christie, in denen das Arrangement von Personal, Zeit, Raum und Situation sozusagen apriorisch (oder a posteriori, als „Motivation von hinten“, nach Clemens Lugowski) auf ihre jeweilige Funktion bei der Auflösung des Skandalons, also des Mordes (meistens an irgendeinem Onkel Archie in der Bibliothek von irgendeinem Ffolkes Manor) angelegt ist.
 Dieses kompositorische Apriori erlaubt den einzelnen Elementen nur ein Funktionieren innerhalb des Textes, sie haben keine Haken oder Verbindungen zu einer irgendwie text-externen Realität – auf welcher Ebene auch die wiederum angesiedelt werden könnte. Old Lady Agathas Orientexpress könnte auch ein Nildampfer sein (das war ja dann auch so), er könnte aber auch ein Zug von Stuttgart nach Erfurt sein und der Nildampfer ein Rheinschiff der Weißen Linie zwischen Rotterdam und Basel. Für das Funktionieren des Sujets, selbst für das Agieren und Interagieren des Figurenensembles bedeutet das keinen Unterschied.
Dieses kompositorische Apriori erlaubt den einzelnen Elementen nur ein Funktionieren innerhalb des Textes, sie haben keine Haken oder Verbindungen zu einer irgendwie text-externen Realität – auf welcher Ebene auch die wiederum angesiedelt werden könnte. Old Lady Agathas Orientexpress könnte auch ein Nildampfer sein (das war ja dann auch so), er könnte aber auch ein Zug von Stuttgart nach Erfurt sein und der Nildampfer ein Rheinschiff der Weißen Linie zwischen Rotterdam und Basel. Für das Funktionieren des Sujets, selbst für das Agieren und Interagieren des Figurenensembles bedeutet das keinen Unterschied.
Nicht umsonst kann man dieses kompositorische Apriori entweder beschreiben als Ausdruck eines gewissen Autonomie-Konzeptes von Literatur, das sich um kontextuelle Bezüge programmatisch nicht scheren möchte. Oder aber als Trivialitätsausweis, weil der Mechanismus als solcher spätestens nach der 300sten Durchführung doch arg klappricht und ausgeleiert ist und nur durch intellektuellen Masochismus als besonderes Vergnügen am “Miträtseln” umgebucht werden kann. “Who cares who killed Roger Ackroyd?” spottete bekanntlich der amerikanische Literaturkritiker Edmund Wilson3 über diesen Typus des Kriminalromans.
Erschwerend hinzu kommt, dass man dieses kompositorische Apriori methodisch ganz einfach an das binden kann, was Boris A. Uspenskij in seiner “Poetik der Komposition” den “Standpunkt auf der Ebene der Ideologie”4 nennt. Also eine vor dem Text liegende (wenn auch nur anhand des Textes & seiner werkgeschichtlichen Kontexte) rekonstruierbare Entscheidung des Autors, wie er “die von ihm dargestellte Welt ideologisch wahrnimmt und bewertet”5.
Bei Agatha Christie & Co. würde dies etwa so aussehen: Das Skandalon Mord ist grundsätzlich und immer aufklärbar, die dafür legitimierten und damit befassten Institutionen versagen, deswegen muss ein privat agierendes Genie diese Aufgabe übernehmen, der Täter wird aus der Gesellschaft entfernt, die daraufhin wieder ruhig und geordnet ihren Gang geht.
Ich muss diese dubiose Ideologiehaltigkeit im Hinblick auf das industrialisierte Morden des Ersten Weltkriegs und anderer unschöner Gräuel der Zeit nicht weiter kommentieren.
Der Trivialität der Komposition korrespondiert also ein prekäres kompositorisches Apriori, dem wiederum ein womöglich noch prekärerer “Standpunkt” des Autors korrespondiert.
Und ausgerechnet das soll der Punkt sein, an dem Heimito von Doderer der Erfüllung eines kriminalliterarischen Musters am nächsten kommt? Welch bizarre Ironie, welch hoher Preis, den man da für die Verortung des MORD in der Reihe der Kriminalliteratur zu entrichten hätte.
Welcher Code?
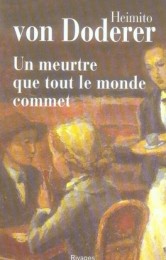 Glücklicherweise: Hätte! Diese streng formalistische Betrachtung geht nicht auf. Denn im Unterschied zum semantisch leeren Erzählen des klassischen britischen mystery ist Doderers pan-funktionales Erzählen sozusagen “gefüllt”. Die Handlung des MORD sitzt von Anfang an in einem keineswegs beliebigen Kontext. Die Lebenszeit Kokoschs, die ersterbende Weimarer Republik bis 1930, ist präzise (wenn auch manchmal eher angedeutet denn expliziert) in Soziologie, Ökonomie und Politik dargestellt, psycho-historisch sozusagen stimmig. Und diese Faktoren wirken auf Kokoschs Biographie, auf sein Psychogramm konstitutiv ein. Gestalten wie Botulitzky, Ligharts, die Kartell-Leute oder Inkrat sind klar und deutlich als konkrete Zeittypen zu lesen.
Glücklicherweise: Hätte! Diese streng formalistische Betrachtung geht nicht auf. Denn im Unterschied zum semantisch leeren Erzählen des klassischen britischen mystery ist Doderers pan-funktionales Erzählen sozusagen “gefüllt”. Die Handlung des MORD sitzt von Anfang an in einem keineswegs beliebigen Kontext. Die Lebenszeit Kokoschs, die ersterbende Weimarer Republik bis 1930, ist präzise (wenn auch manchmal eher angedeutet denn expliziert) in Soziologie, Ökonomie und Politik dargestellt, psycho-historisch sozusagen stimmig. Und diese Faktoren wirken auf Kokoschs Biographie, auf sein Psychogramm konstitutiv ein. Gestalten wie Botulitzky, Ligharts, die Kartell-Leute oder Inkrat sind klar und deutlich als konkrete Zeittypen zu lesen.
Dito hindert das funktionale Erzählen Doderer keinesfalls, eigene Theoreme, eigene Sinnstiftungen, eigene Interpretamente von Welt in seine narration einzubauen bzw. in den Erzähloperationen auszufalten: Ich denke da natürlich vor allem an die Doderer´sche “Fatalogie” oder an sein Reiben am Problem der “Kontingenz”, mit allen geschichtsphilosophischen, theologischen und zeitkritischen Implikationen. All das ist der “Normal-Ausprägung” des mysteries fremd.
Analog “gefüllte”, aufgeladene Texte finden sich ausgerechnet in den “Gegenprogrammen” zum britischen Häkelkrimi-Typ. Diese “Gegenprogramme” sind “offener”, ihre Erzählelemente sind nicht ausschließlich funktional definiert, sondern können auch für sich stehen.
Das ist entschieden so bei Dashiell Hammett in den USA, dessen für die Geschichte der Kriminalliteratur essentieller Roman “Red Harvest” schon 1929 das Genre aus jedem Bezug von Formel und Schema-Literatur heraus-schoss (wenn die Metapher hier erlaubt ist). Er inszenierte die moralische Indifferenz der Hauptfiguren im kausalen Zusammenhang der präzisen sozioökonomischen Situierung der Handlung und zerrieb damit die Gewissheiten der Gut/Böse-Dichothomie in einer als “real” geschilderten Welt. (Der weitaus berühmtere “Malteser Falke” ist im Gesamtwerk von Hammett eher untypisch.)
Das ist auch entschieden so bei Georges Simenon, dessen “Maigret”-Romane keinesfalls vom Fall/Aufklärungs-Schema dominiert werden, sondern eine ganze Palette von anderen Dominanzen aufweisen: Soziogramme, Psychogramme, Bearbeitung von Obsessionen, und die – besonders wichtig – durch Kontingenz und timing eine metaphysische Unbehaustheit resp. transzendente Eiseskälte artikulieren, die dem intellektuellen Konzept und dem theologischen Unterfutter von Doderer zu dieser Zeit konträr entgegengesetzt sind. Wodurch eine analoge “Versuchsanordnung” in Simenons Roman “Maigret et les Caves du Majestic” (auch wenn der erst aus dem Jahr 1942 stammt), wo ein banal geplatzter Fahrradreifen zu ähnlichen tödlichen Konsequenzen führt wie ein banaler juveniler Ulk im MORD, besonders paradox-parallel wirkt.
Beider, sowohl Hammetts als auch Simenons “ideologischer Standpunkt” könnte etwa (grob vereinfacht) so lauten: Verbrechen und Gewalt sind keineswegs ein einzelnes Skandalon, sie sind nicht durch ordnungspolitische Kräfte oder deren Stellvertreter zu entsorgen und die Welt ist nach Erledigung des “Falles” keineswegs wieder in Ordnung.
 Es sind also, wie wir´s drehen oder wenden, zwei verschiedene Konzepte von Kriminalliteratur im MORD am Werk. Wenn Martin Loew-Cadonna meint: “In jedem Fall garantiert der detektivische Kode als solcher den einheits- und zielstiftenden Umgang mit der beschlossenen Geschichte”6, dann ist das einerseits sehr zutreffend, lässt aber andererseits die Frage offen: Welcher detektivische bzw. welcher kriminalliterarische Code? Der über die pure Erzählstruktur garantierte “Mystery”-Code (wie wir ihn mal verständigungshalber nennen wollen) oder der durch Erzählinhalte und Sujetfügung garantierte offene Code der “Crime fiction” (wie ich das Hammett/Simenonsche Konzept taufen will). Beider “meaning of structure” scheinen sich auszuschließen, beider “ideologische Standpunkte” nach Uspenskji sind allerhöchstens antagonistisch zu denken.
Es sind also, wie wir´s drehen oder wenden, zwei verschiedene Konzepte von Kriminalliteratur im MORD am Werk. Wenn Martin Loew-Cadonna meint: “In jedem Fall garantiert der detektivische Kode als solcher den einheits- und zielstiftenden Umgang mit der beschlossenen Geschichte”6, dann ist das einerseits sehr zutreffend, lässt aber andererseits die Frage offen: Welcher detektivische bzw. welcher kriminalliterarische Code? Der über die pure Erzählstruktur garantierte “Mystery”-Code (wie wir ihn mal verständigungshalber nennen wollen) oder der durch Erzählinhalte und Sujetfügung garantierte offene Code der “Crime fiction” (wie ich das Hammett/Simenonsche Konzept taufen will). Beider “meaning of structure” scheinen sich auszuschließen, beider “ideologische Standpunkte” nach Uspenskji sind allerhöchstens antagonistisch zu denken.
Lassen wir uns von dieser Aporie aber erst einmal nicht schrecken, sondern versuchen wir, ihr etwas Positives abzugewinnen: Demnach hätte Heimito von Doderer zwei existierende (wenn auch stets als “idealtypisch” gedachte) Sorten von Kriminalliteratur kombiniert, indem er der formalen Struktur des einen Typs die inhaltlichen Komponenten des anderen Typs aufgepfropft hätte. Logischerweise müsste diese Operation, diese neue Struktur eine neue meaning of structure ergeben – sozusagen einen “Dritten Weg”.
Tatsächlich lassen sich in der Geschichte der Kriminalliteratur solche “Hybride” in Hülle und Fülle beobachten, allerdings zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt. Patricia Highsmith etwa hat das geringe Aufkommen von kriminalliterarischen Anteilen auf der einen Seite (also: kein deutlicher Mord, keine Polizei- oder sonst irgendwie plausible Aufklärungsarbeit, keine Gut/Böse-Problematik) kombiniert mit einem deutlichen Plus an “Komplexion” (also: Psychogramme, Gesellschaftsanalyse etc.) und textinternem hochfunktionalen Erzählen auf der anderen Seite, etwa in den Romanen “Das Zittern des Fälschers” oder “Ediths Tagebuch”. Damit hat sie dem Begriff “Kriminalroman” eine erhebliche Peinigung zugefügt, bis man sich auf den terminologischen Notnagel “Psycho-Thriller” geeinigt hatte. Wenn Loew-Cadonna also einmal den MORD beschreibt als ein “fiktionales Psychogramm”, in das ein “genaues Soziogramm”7 der Zeit eingelagert ist, könnte man unseren Roman immerhin als eine Frühform des Psychothrillers zu bestimmen versucht sein.
Was nun?
Doch ach, auch im Falle Doderer komme ich um eine Peinigung der Begriffe nicht herum.
Denn welche Lesarten ließe der Roman zu, die sowohl dem “Sockel des äußerst elastischen, extrem anreicherbaren Krimi-Genres”8 als auch der oben besprochenen Komplexionsaufladung gerecht werden, also dem vagen Konzept eines frühen Psychothrillers avant la lettre? Und brauchen wir diese dann arg gepeinigten Begriffe überhaupt?
Unser Problem hat, davon bin ich überzeugt, letztendlich damit zu tun, dass wir alle fröhlich über “den Kriminalroman”, über “den Detektivroman”, über “den Psychothriller”, “ den Krimi” und sonst dergleichen reden, ohne uns darüber im Klaren zu sein, was zuallerst ein Kriminalroman ist und wo er sich im “literarischen Feld” befindet.
Natürlich ist pan-funktionales Erzählen ein Spezifikum des klassischen mystery. Aber eben nicht nur: Pan-funktionales Erzählen findet sich in allen möglichen Genres wieder – im Liebesroman, im Arztroman, im Schauerroman – also grundsätzlich da, wo ein gewisser Trivialitätsverdacht nicht ganz unbegründet ist (ohne dass ich die Diskussion um Trivialität hier aufnehmen will). Oder aber im avancierten nouveau roman eines Robbe-Grillet.
Und genauso ist die Komplexionsaufladung, für die ich Hammett, Simenon oder Highsmith ins Feld geführt habe, kein Spezifikum von Kriminalliteratur, sondern findet in jeder Art von Roman der nicht-trivialen Sorte statt.
Unser Problem ist also eine Ableitung der grundsätzlichen Problematik der gattungs- oder genre-theoretischen Definition von Kriminalliteratur. “Einen konsensfähigen Begriff des Kriminalromans gibt es nicht”, stellt das “Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft”9 fest. Alle bisherigen, tradierten und de facto vorliegenden Definitionsansätze befassen sich lediglich mit der Ebene der Sujetfügung, mit der unterschiedlichen Anordnung von Handlungspartikeln und Erzählinhalten – alles eben auf der Ebene der Handlungsparaphrase. Über eine etwaige Tiefenstruktur, die eine Gattungstheorie nun einmal, nicht nur laut Klaus Hempfer10 und laut einer argumentierenden Literaturwissenschaft, zu leisten hat, ist damit noch gar nichts ausgesagt – und es steht zu befürchten, dass die herkömmliche Gattungstheorie an diesem Punkt auch nicht weiterkommt.
 Auf den MORD bezogen heißt das aber: Die Lesarten, die Loew-Cadonna und andere Exegeten anzubieten haben – sei es als allegorischer Text für eine gewisse “Innere Emigration” Doderers, sei es, seiner Lebenssituation entsprechend, als dem NS-Staat leicht unentschlossen gegenüberstehender Roman mit “schollig(en)”11 Zügen – haben, so gesehen, mit dem Status des MORD als Kriminalroman oder Nicht-Kriminalroman (oder Psychothriller oder Nicht-Psychothriller) recht eigentlich gar nichts zu tun.
Auf den MORD bezogen heißt das aber: Die Lesarten, die Loew-Cadonna und andere Exegeten anzubieten haben – sei es als allegorischer Text für eine gewisse “Innere Emigration” Doderers, sei es, seiner Lebenssituation entsprechend, als dem NS-Staat leicht unentschlossen gegenüberstehender Roman mit “schollig(en)”11 Zügen – haben, so gesehen, mit dem Status des MORD als Kriminalroman oder Nicht-Kriminalroman (oder Psychothriller oder Nicht-Psychothriller) recht eigentlich gar nichts zu tun.
Dass im MORD selbst Elemente, die auch in Kriminalromanen vorkommen können, isolierbar sind (der Titel, ein wesentliches Erzählsujet, quasi-detektivische Bemühungen usw.), sagt über den Status des Textes immer noch nichts aus – wir können die gesamte Hochliteratur vom “Nibelungenlied” bis zum “Prozeß” durchforsten und werden immer auf solche Sujetpartikel stossen. Auch dass Heimito von Doderer bei diesem Roman “unterhaltsam” schreiben wollte, gar auf einen kommerziellen Aufmerker angesichts von Titel und production design schielte, also schlichtweg das kommunikative und ökonomische Potential abschöpfen wollte, das die Assoziation mit “Krimi” aufrufen kann – unbestrittten und nicht zu kritisieren.
Unbestreitbar aber auch, dass dem MORD diejenigen Eigenschaften fehlen, die man in eine Gattungs-/Genre-Theorie des Kriminalromans erst noch einarbeiten müsste, wenn sie es denn zuließe: Der MORD entstammt nicht einem Milieu der subliteratura, einer Literatur von unten , er zielt auf ein zwar breiteres Publikum als die anderen Romane von Doderer, aber keinesfalls auf das breite Publikum, seine Herstellungs- und Distributionsbedingungen sind die der Hochliteratur (und die Absatzzahlen bestätigen das) und es fehlt ihm an genau jener Qualität von Kriminalliteratur, die sie im besten Fall so widerborstig macht: Die Subversion, und sei´s die gegen den guten Geschmack . Der MORD ist ein Roman, der all das zwar anreißt, es aber nicht ernst damit meint – und der nebenbei durch die Assoziation seines Entstehungsortes Dachau mit dem Wort MORD eine gewisse bittere Pointe hat. Er ist, wenn er in der Geschichte der Kriminalliteratur einen Platz haben sollte, höchstens die Frühform eines Trends, den wir heute massiv beobachten: “Hoch-Autoren” wenden sich niedereren Formen zu, wobei sie sich sehr eigene, meist sehr seltsam uninformierte Bilder von einer Form machen, die es so einfach gar nicht gibt.
Das sagt einiges über die Qualität des MORD als Kriminalroman. Es sagt glücklicherweise nichts über seine Qualitäten als Roman. Und für die bin ich, als Nicht-Heimitist, dann doch nicht zuständig.
© 09.2006/08.2016 Thomas Wörtche
Dieser Text basiert auf einem Vortrag, gehalten auf einer Tagung der Heimito-von-Doderer-Gesellschaft im September 2006 und auf dessen Druckfassung in: „Doderer, das Kriminelle und der literarische Kriminalroman: Zu Heimito von Doderers Ein Mord den jeder begeht hg. von Gerald Sommer und Robert Walter. Würzburg, 2011. Beide Fassungen wurden hier leicht überarbeitet.
Anmerkungen:
1 Martin Loew-Cadonna: Zug um Zug. Studien zu Heimito von Doderers Roman “Ein Mord den jeder begeht”. Wien 1991
2 Miroslav Červenka: Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks. Hg. von Frank Boldt und Wolf-Dieter Stempel. München, 1978. Cf besonders S. 10 – S. 33
3 Edmund Wilson: “Who cares who killed Roger Ackroyd: A Second Report on Detective Fiction”. In: The New York Times, 20 Juni 1945
4 Boris A. Uspenskij: Poetik der Komposition. Struktur des künstlerischen Textes und Typologie der Kompositionsform. Hg. und nach einer revidierten Fassung des Originals bearbeitet von Karl Eimermacher. Aus dem Russischen übersetzt von Georg Mayer. Frankfurt am Main, 1975. Cf S. 17 – S. 22
5 Ebd. S. 17
6 Loew-Cadonna, S. 151
7 Loew-Cadonna S. 232
8 Ebd. S. 283
9 Thomas Wörtche: Artikel “Kriminalroman”. In: Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft. Hg. von Harald Fricke, Band II, S. 342 – S. 345. Berlin/New York 2000. Hier S. 343
10 Klaus W. Hempfer: Gattungstheorie. Information und Synthese. München 1973
Cf besonders S. 128ff
11 Loew-Cadonna, S. 309
Kulinarischer Hinweis: Etwa 25 Personen fasst das Heimito v. Doderer-Stüberl im Blauensteiner-Lokal „Zur Stadt Paris“ in der Josefstadt, direkt hinter dem österreichischen Parlament und dem Wiener Rathaus. Die unprätentiöse Gastwirtschaft mit wunderbar günstigen Preisen, ordentlichsten Portionen und einer Speisenqualität zum Niederknien – jüngst von CrimeMag-Redakteur Alf Mayer wieder einmal gestestet – ist Wiener Beisl-Kultur vom schäbig Feinsten und ein gutes Antidotum für schwere Theorie. Kein Wunder, dass Doderer sich hier wohlgefühlt hat.











