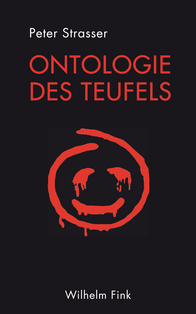 I’m a man of wealth and taste …
I’m a man of wealth and taste …
Was machen wir mit den Schlächtern, den Kopfabschlägern, den Genozideuren, den Serialkillern, den Scheusalen und Monstern, die unsere reale Welt bevölkern und die wir fürchten? Haben wir das Böse unterschätzt? Geht der Teufel wieder um? Peter Strasser diskutiert in seiner „Ontologie des Teufels“ Menschheitsfragen. Spannend, findet Thomas Wörtche.
„Das Böse“ hat Konjunktur. Also nicht nur das, was wir am menschlichen Handeln als „böse“ bezeichnen, das hat, recht eigentlich betrachtet, immer Konjunktur. Aber man denkt wieder öfters über das Böse nach. Nach Kurt Flaschs fulminantem Buch „Der Teufel und seine Engel: Die neue Biographie“ und Bettina Stangneths brillanten Essays „Böses Denken“ jetzt also gar eine „Ontologie des Teufels“ des Philosophen Peter Strasser. Von dem großen Wort „Ontologie“ braucht man sich zunächst einmal nicht abschrecken zu lassen. Strasser geht es um das sehr lebensweltlich berechtigte Problem, mit der wir alle zu tun haben, wenn wir uns nicht eines bewussten Reduktionismus bedienen wollen, nämlich, „dass wir mit den üblichen Begriffen der Wissenschaft und des sogenannt rational-philosophischen Diskurses an die Realität des Bösen nicht herankommen“. Die üblichen biologischen, sozialen und psychologischen Versuche, zu verstehen, was Menschen dazu treibt, in vollem Bewusstsein „Böses“ zu tun, also das, was
Kant 1793 im Ersten Stück seiner „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ das „radical Böse“ oder „das böse Herz“ des Menschen nennt, lassen, wie wir´s auch drehen und wenden, unbehagliche Reste übrig. Nicht unbedingt in den jeweiligen Bezugsrahmen der jeweils damit befassten Disziplinen, sondern ganz vorbegrifflich, beinahe instinktiv. Zumindest, wenn man auf irgendeine Art von (befriedigender) Konsistenz der Erklärung oder des Verständnisses aus ist. Nachdem Strasser alle möglichen Ansätze diskutiert und als nicht ausreichend verworfen hat (was er dabei zu den Themen Dämonisierung, Banalisierung, Hysterisierung, Infantilisierung, auch in den Bereichen der populären Kultur, der Medien und der Tagespolitik, zu sagen hat, ist absolut treffend und so sarkastisch, dass es oft wehtut) kommt er zu dem Schluss, dass „das wahrhaft Böse – im Unterschied zu all dem, was im Laufe der Zeiten als böse ausgegeben wird, bloß, weil es einer zeitbedingten Konvention widerspricht – ist, wie auch das Wahrhaft Gute, im Metaphysischen verankert“ sein muss. Deswegen revitalisiert er, der „Bildhaftigkeit meines begrifflichen und narrativen Instrumentariums“ eingedenk, eben den alten monotheistischen „Teufel“. Den wir bitte nicht mit dem rhetorischen Kleingeld verwechseln sollen, mit dem in Zeiten krisenhafter Weltlagen allerlei metaphorische, politische und mediale Hochrüstung betrieben wird.
Das Gute
Aber da liegt auch der Pferdefuß (sorry für den Kalauer an der Stelle) seiner Argumentation: Wenn er „das Böse“ (nicht das „sogenannte Böse“, das er letztendlich für eine böse Entsubstantialisierung des grimmigen Ernstes des Faktums hält) ins Metaphysische lagert, dann muss er – und er tut es auch – auch das Gute, besonders in seiner Manifestation der Misericordia, der Barmherzigkeit, dorthin

Pieter Brueghel d. Ä.: Sturz der gefallenen Engel (1562)
verlagern. Dass er dabei Barmherzigkeit dringend abgrenzen möchte vom pausenlosen Getös und Gedöns um die eigene Güte und Menschenliebe (besonders störend zur Zeit auf Facebook und anderen sozialen Medien als PR-Tool zur Feier der eigenen Eminenz, zu beobachten,), ist verständlich und sogar sehr sinnvoll. Pointiert gesagt: „Ja, es ist die menschliche Anmaßung, radikal gut zu sein, die uns böse werden lässt.“ So richtig diese Dialektik für die weltliche Immanenz beobachtet ist, so steril wird sie, wenn sie in der immanenten Systematik transzendenten Denkens isoliert wird. Zumal, nebenbei bemerkt, diese Art transzendenten Denkens monotheistisch sein muss. Seine Zeichenoperationen sind dann eben nicht universell, außer Atheisten wären ihrerseits per se Teil des Bösen. Gewichtiger scheint mir aber, dass bei dieser Art des begrifflichen Manövrierens das Handeln außer Acht bleibt. Und im Handeln materialisiert sich das, was wir als Böses bezeichnen, nun einmal. Wo denn sonst? In der Seele, würde Strasser vermutlich sagen, aber da kann es ja, sofern es sich nicht materialisiert, ruhig vor sich hin wesen.
An einer Stelle des extrem klugen Buches dachte ich beinahe, Strasser gelänge eine Art Wittgenstein´scher Wende. Da nämlich, wo er ausführt, keine „metaphysische Dramatisierung“ betreiben zu wollen, „sprachlich (zu) demobilisieren“, weswegen er auch größere Teile seines Buches autobiographisch, gar anekdotisch, subjektiv anlegt. Also in der ersten Person, prononciert als „Ich“ spricht. Das korrespondiert aufs Schönste mit Wittgenstein, der in seinem „Vortrag über Ethik“ darauf besteht, über das Ethische (und das Religiöse) sinnvoll zu sprechen, sei a priori unmöglich, alleine der Versuch ein „Anrennen gegen die Grenzen der Sprache“, wie es in einem Gespräch Wittgensteins mit Friedrich Waismann heißt. Was auch bedeutet: Das „Gute“ und das „Böse“ als ethische Parameter verstanden, sind dann für den Menschen – wenn auch oft extrem schwierig – lebbar, gerade wenn man sie aus ihren begrifflichen Gefängnissen systematischen Denkens und Sprechens herausholt.
Anyway, Strassers schmales Bändchen, ob das man sicher noch viel mehr sagen könnte und müsste, ist wegen seiner Thesenhaltigkeit, seiner Humanität und nicht zuletzt seiner Skepsis gegenüber Gewissheiten über ein ungeheuer komplexes Thema eine notwendige und erhellende Lektüre.
Thomas Wörtche
Peter Strasser: Ontologie des Teufels. Mit einem Anhang: Über das Radikalgute. Essays. München: Wilhelm Fink 2016, 128 Seiten, € 17, 90












