 Überflieger, Tiefenschürfer, Entertainer
Überflieger, Tiefenschürfer, Entertainer
Er war der jüngste britische RAF-Kampfpilot, Journalist bei einem Provinzblatt und wurde mit dem Bestseller „Der Schakal“ weltberühmter Autor: Frederick Forsyth, 77, wirft in seinen Memoiren „Outsider“ einen Blick zurück auf abenteuerliche Recherche-Trips für seine Polit-Thriller, Kurierfahrten für den Geheimdienst und komische Episoden und hat nun entschieden: „Dies ist mein letztes Buch!“ Peter Münder hat sich mit ihm getroffen.
Seinen großen Traum, der ihn so stark prägte, hatte der fünfjährige Freddie im Sommer 1944 auf dem kleinen Flugfeld von Hawkinge, wo ihm sein Vater während der deutschen „Blitz“-Attacken die fliegenden Helden und die legendäre Spitfire zeigen wollte. Sein Vater war zwar Kürschner, aber während der deutschen Fliegerangriffe zum Schutzbeauftragten und Feuerwehr-Experten im Rang eines Majors ernannt worden. Während der Vater den Stützpunkt inspizierte und mit dem Kommandanten sprach, wurde der Junge den Piloten übergeben. „Sie machten ein großes Tamtam um mich“, schreibt Frederick Forsyth jetzt in seiner Autobiographie und man merkt an den akribisch beschriebenen Details, welch ein intensiver, emotionaler Moment dies für ihn war. „Einer hob mich hoch, schwang mich in die Luft und ließ mich in das Cockpit einer Mark 9 plumpsen. Ich saß auf dem Fallschirmpaket, überwältigt, sprachlos. Ich atmete den Geruch von Treibstoff, Öl, Gurten, Leder, Schweiß und Angst ein. Ich betrachtete die Instrumente, den Feuerknopf, umklammerte den Steuerknüppel. Ich schaute über die endlose Motorhaube…und auf die Art kleiner Jungs leistete ich einen Kleine-Jungen Schwur. Als ich wieder aus dem Cockpit gehoben wurde, hatte ich beschlossen, was ich werden würde… Ich würde Kampfpilot und eines Tages würde ich eine Spitfire fliegen.“
Der jüngste RAF-Pilot, den es je gab
Worauf Forsyth in diesem Anfangskapitel seiner faszinierenden Memoiren hinaus will, ist nicht „das große Tamtam“ um ihn selbst, sondern die Tatsache, dass er sich trotz aller entmutigender Erfahrungen in der Schule, trotz Spott und Zweifel nie irritieren ließ: Sein Entschluß stand fest, sein Plan wurde realisiert – basta. Tatsächlich begann er schon als 17Jähriger seine Ausbildung und war dann als 19-Jähriger der jüngste RAF-Pilot, den es jemals gab.
Diese wahnsinnige Energie, die man auch als Starrsinn bezeichnen könnte, ist sein Markenzeichen und prägte seine spätere journalistische Laufbahn: So verbissen, so intensiv und mit so einer radikalen Tiefenbohrung haben wahrlich nur wenige Enthüllungsjournalisten recherchiert.
Über die Rotary-Club Connections des Vaters konnte Forsyth mehrmals seine Sommerferien bei französischen Club-Freunden verbringen und dabei so perfekt Französisch lernen, dass er dann als Einheimischer durchging – ähnlich verlief es später in Halle, Westfalen, wo er bei einem Lehrer zu Gast war: Der sprachbegabte Junge aus Kent lernte extrem schnell und schnappte so begierig nach allen interessanten Slang-Häppchen, dass er bald ziemlich perfekt Deutsch sprach.
Sprachtalent mit enormem Erkenntnisinteresse
Den Blick über den Tellerrand übernahm er vom Vater, dessen Kürschner-Laden er nicht übernehmen wollte. Nach zweijähriger Fliegerei bei der RAF wollte der junge Forsyth die Welt erobern – möglichst als Auslandsreporter. Er macht zwar meistens glückliche Zufälle dafür verantwortlich, dass er schnell den idealen Job fand – aber es waren wohl eher seine Sprachtalente, der herrliche Sinn für Humor und sein enormes Erkenntnisinteresse, das ihm überall die Türen öffnete. Beim Provinzblatt Eastern Daily Press lernte er das journalistische Handwerk, siedelte nach London über, wo er sofort bei der Agentur Reuters anheuern und 1962 nach Paris wechseln konnte. Und das Paris zur Zeit von de Gaulle, dem Ende des Algerienkriegs und den Attentatsversuchen der nationalistischen OAS-Fanatiker war für Forsyth spannender als jeder Krimi. Er war immer nah dran am Geschehen, registrierte beeindruckt die Kaltblütigkeit des Generals mit der langen Nase, der sich auch im massiven Kugelhagel (120 Schüsse ! ) der Attentäter nicht auf dem Rücksitz des Citroen DS 21 zusammenrollte, sondern kerzengrade sitzen blieb. Und er hatte damit auch schnell sein Rohmaterial für den Polit-Thriller „Der Schakal“ zusammen. In „Outsider“ beschreibt er mit seiner wunderbaren selbstironischen Attitüde, wie sein Manuskript von mehreren Londoner Verlagen zuerst abgelehnt wurde, weil de Gaulle ja alle Attentate überlebt hätte… Bis Hutchinson den Thriller veröffentlichte, der sein erster gigantischer Bestseller wurde.
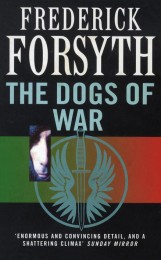 Wissbegierige Spürnase, die sich dumm stellen kann
Wissbegierige Spürnase, die sich dumm stellen kann
Forsyth beschreibt weitere spannende und hochbrisante Episoden aus seiner einjährigen Ostberliner Zeit als Reuters-Korrespondent, aus Nigeria während des Biafra-Krieges und von den Recherchen für die „Akte Odessa“ und die „Hunde des Krieges“. Sie alle illustrieren, dass er nicht nur den richtigen Riecher für brisante Themen hatte, sondern meistens auch antizipierte, welche politischen Konflikte von besonderer gesellschaftlicher Relevanz werden könnten. Die Gefahren, die mit seinen Recherche-Trips verbunden waren, stellten für die wissbegierige Spürnase meistens noch einen prickelnden, angenehmen Nervenkitzel dar: Etwa, wenn er in Nigeria direkt in den Biafra-Krieg hineinschlittert und mehrmals beschossen wird und sich obendrein noch von BBC-Altvorderen anhören muß, dass die ganze Biafra-Chose höchstens zehn Tage andauern würde. Oder wenn er in Guinea-Bissau während seiner Recherchen zum globalen Drogenhandel („Cobra“) in die Scharmützel rivalisierender Clans geriet – für Forsyth sind diese Detonationen und MG-Salven in den Kulissen faszinierende Hintergrundgeräusche einer guten Story, die er in den Romanen detailliert ausmalen kann.
Schrill und komisch sind seine speziellen „Bertie Wooster“-Einlagen: Wie der tumbe PG Wodehouse-Held gab sich Forsyth gern als debile Dumpfbacke aus, wenn es in brenzligen Situationen – etwa mit Vopos oder Stasi-Typen – zur Sache ging und er kurz vor der Verhaftung stand: Dann stammelte er nur noch sinnloses Zeug, war der unbeholfene Depp, der sich von den ach so klugen deutschen Techno- und Bürokraten gerne helfen ließ. Und dann trifft er während seiner Reuters-Zeit in der DDR in einer Kneipe einen rassistischen Ex-Nazi und ehemaligen KZ-Wächter, der inzwischen glühender SED-Anhänger geworden ist. Und er fragt sich während der Absonderung dieser faschistoiden Tiraden, wie es überhaupt möglich ist, dass sich ein ehemals unschuldiges Kind in so ein Monster verwandeln kann, das fähig ist, „einen festgebundenen Mann zu Tode zu peitschen, ein lebendes Kind in einen Verbrennungsofen zu werfen oder ganze Familien in die Gaskammern zu treiben? Welche satanische Metamorphose kann das bewirken?“
 Aversion gegen das Establishment
Aversion gegen das Establishment
Solche tiefer bohrenden Fragen und Passagen gibt es häufiger im „Outsider“. Sie offenbaren den radikalen Skeptiker und Analytiker hinter den gefälligen, amüsanten Entertainer-Episoden. Der war ja auch schon während des Biafra-Gemetzels als Einzelgänger in Erscheinung getreten, als die BBC die etablierten Weisheiten des Foreign Office übernommen hatte und eisern an der Version einer harmlosen afrikanischen Übergangs-Periode festhielt, die man am besten nur ignoriert. Da hatte sich Forsyth auf eigene Faust im Land umgesehen und als Freelancer seine Impressionen vom Hungertod der Kinder und von den Massakern im Land verbreitet.
Aber trotz der Hinweise auf seine Aversion gegenüber dem selbstgefälligen, saturierten britischen Establishment – vor allem gegenüber der blasierten BBC-Hierarchie – bleibt ein Widerspruch ungeklärt: Warum übernahm Forsyth immer wieder Jobs für den Geheimdienst, der ja so lange von den Cambridge-Maulwürfen unterwandert war ? Wurde er damit nicht doch ein hilfsbereiter Handlanger des kritisierten Establishments ? Wie konnte er sicher sein, nicht an die Gegenseite verraten zu werden, als er als Reuters-Korrespondent noch zu DDR-Zeiten als Kurier für den MI6 nach Dresden fuhr, um Päckchen für einen russischen, für den MI6 spionierenden General – versteckt unter der Batterie seines Autos – abzuliefern? Nach jahrelangem Leugnen seiner früheren Agententätigkeit hat Forsyth jetzt im „Outsider“ offen bekannt, von Zeit zu Zeit für den Dienst gearbeitet zu haben, was einige britische Medien dann doch überraschte.
Zeit für eine Befragung
Den Autor von 13 Bestsellern mit einer Auflage von über siebzig Millionen konnte ich dazu in einem bekannten Hamburger Nobelhotel mit Blick auf die Binnenalster befragen. Hamburg war für ihn übrigens ein ziemlich aufregender Schauplatz gewesen, an dem er für seinen Söldner- und Waffenhändler-Thriller „Hunde des Krieges“ recherchiert hatte und Otto X, den weltweit führenden „Händler des Todes“ unter dem Pseudonym des Südafrikaners Frederick van der Merve getroffen hatte, um Waffen für einen angeblichen afrikanischen Putsch zu kaufen und die wichtigsten brisanten Details über solche geheimen Deals zu erfahren. Damals flog seine Tarnung auf und er musste die Stadt innerhalb weniger Minuten verlassen, um sich vor den Schergen des Waffenhändlers zu retten.
Wie Forsyth sofort klarstellt, sieht er das Establishment als heterogenen Block mit unterschiedlichen Segmenten. Er sortiert sie säuberlich in ganz unterschiedliche Schubladen: „Damals in Nigeria war ich natürlich extrem wütend über die BBC-Idioten, die mir weismachen wollten, der Biafra-Krieg würde nur zehn Tage dauern und der ganze Spuk wäre eigentlich auch kaum einen Bericht wert“, erklärt er. „Das Foreign Office wimmelt immer noch von blasierten blinden Ignoranten, die fest an ihre heilige Einfältigkeit glauben. Aber neben diesen Negativbeispielen gibt es ja auch noch die Queen und die Monarchie, die ich verehre, das Militär, das ich für enorm wichtig, solide und zuverlässig halte und den Geheimdienst, der genauso bedeutend und lebenswichtig ist. Die ganze Philby-Maulwurfs-Epoche mit den „Cambridge Five“, das war ja noch zur Blütezeit des Kalten Krieges; das alles war noch eine Generation vor mir passiert; damit hatte ich nichts mehr am Hut“.
Die Fehler einer interventionistischen Politik
Und für die MI6- und SIS-Spione hätte er eben immer wieder Aufträge übernommen: „Denn wenn Dein Land Dich braucht und Dich um Hilfe bittet – dann kannst Du doch nicht ablehnen“, konstatiert er. Und außerdem ginge es heute auch nicht mehr darum, den Kalten Kriegern hinterm Eisernen Vorhang ein Bein zu stellen, sondern um den Kampf gegen den heimtückischen Terrorismus. Da seien die Fehler der USA, und vor allem auch von Tony Blair, der immer nur der nette, gehorsame Kumpel von Bush sein wollte, völlig offensichtlich – „aber man muss die Islamisten-Szenerie natürlich im Blick haben und diese Selbstmordattentäter eliminieren“. Einen klaren analytischen Blick hat Forsyth auch für die Fehler einer interventionistischen Politik, die mit Bomben und Soldaten im Irak einmarschierte, einen Diktator stürzte und dann vergeblich auf Karamellbonbons und Blumengrüße der Bevölkerung wartet: „Natürlich waren die Amerikaner nach dem Sturz Saddams sehr enttäuscht – aber die ohnehin gespaltene Bevölkerung war eben der Meinung, es wäre „ihr“ Diktator gewesen und ihre Probleme sollten nicht von imperialistischen ausländischen Truppen oder ignoranten Politikern gelöst werden.“
Leider ein Abschied
Wir streifen noch so interessante Themen wie das Schreiben in Zeiten des Internet und seine alte Nakamisha-Schreibmaschine, das Verwischen von Realität und Fiktion in seinen Thrillern, was ja in „Odessa“ oder dem „Schwarzen Manifest“, dieser Vorwegnahme chaotischer russischer Verhältnisse, so offensichtlich war und sich in dem schönen Satz widerspiegelte: „Die Realität ist so verrückt, dass es keinen Sinn machte, einen Plot zu erfinden.“
Außerdem: Die desolate EU und ihre Bürokraten werden mit vernichtendem Verdikt bedacht („Juncker ist ein Idiot“), den Brexit hält Forsyth schon lange für überfällig, Übersetzungen des „Outsider“ gebe es inzwischen in rund zwanzig Sprachen, darunter auch Chinesisch, was beruhigend sei.
Dann zieht der Großmeister des Polit-Thrillers schließlich den Vorhang und erklärt: „Dies ist mein letztes Buch, weil mir das Schreiben inzwischen doch zur Last fällt und es noch so viel zu erleben gibt: Ich möchte nämlich noch möglichst oft und intensiv Tauchen, Hochseefischen und mit den Enkeln spielen!“
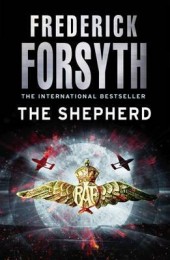 Frederick Forsyth: Outsider. Die Autobiografie (Outsider. My Life in Intrigue). Deutsch von Susanne Aeckerle. Bertelsmann, München 2015. 384 Seiten, 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier, zum Autor hier und hier.
Frederick Forsyth: Outsider. Die Autobiografie (Outsider. My Life in Intrigue). Deutsch von Susanne Aeckerle. Bertelsmann, München 2015. 384 Seiten, 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier, zum Autor hier und hier.
Zur Spionagetätigkeit von Romanautoren:
Anthony Masters: Literary Agents- The Novelist as Spy. Basil Blackwell, Oxford 1987, 271 Seiten. (Über zwölf Autoren, darunter E. Childers, John Buchan, Graham Greene, Ian Fleming bis zu John le Carré u.a.)
Foto Spitfire (c) Wiki Commons













