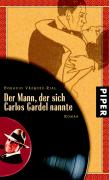 Denkmal für einen armen Teufel
Denkmal für einen armen Teufel
Carlos Gardel war ein Star. Jedenfalls lassen sein strahlendes Zahnpastalächeln unter der breiten Hutkrempe und der seit über siebzig Jahren anhaltende Kult um seine Person dies vermuten. Doch wer verbarg sich wirklich hinter der „kreolischen Drossel“?Von Eva Karnofsky
Toulouse oder Tacuarembó? Kam er in Frankreich als Charles Romuald Gardés oder in Uruguay als Carlos Escayola zur Welt? Wer war seine leibliche Mutter? Berthe oder María Lelia? Und wer der Vater? Irgendein Freier? Oder hatte der grausame Colonel Escayola Berthe geschwängert? Berthe, die verschlagene Hure, oder Berthe, die ehrbare Wäscherin? Oder hatte der Oberst seine vierzehnjährige Schwägerin María Lelia vergewaltigt, die obendrein die Tochter seiner Geliebten war? Nur soviel ist sicher: Er nannte sich Carlos Gardel, und er wurde in Argentinien zum Mythos.
Carlos Gardel stieg in den Himmel der argentinischen Legenden auf, weil er Tangos sang, unvergessene Tangos. Und den Tango reklamieren die Argentinier für sich. Doch da ist noch mehr, was Gardel zur argentinischen Ikone befähigt. In Argentinien liebt man Gestalten, die von ganz unten kommen und den Aufstieg schaffen, wie Evita, wie der Boxer José María Gatica oder Maradona. Und man liebt sie erst recht, wenn sie ein tragisches Ende nehmen.
Gardels tragisches Ende – er starb am 24. Juni 1935 bei einem bis heute rätselhaften Zusammenstoß zweier Maschinen auf dem Flughafen der kolumbianischen Stadt Medellín – ist der Ausgangspunkt für den Roman des in Barcelona lebenden Argentiniers Horacio Vázquez-Rial. Der spanische Journalist Paulino Losada wurde damals zufällig Zeuge des Unglücks. 61 Jahre später gibt er die damaligen Beobachtungen sowie seine späteren Nachforschungen über Gardel dem jungen Argentinier Romeu zu Protokoll, dieser schneidet die Gespräche mit Losada auf 25 Bändern mit und schreibt sie nieder. In ihren Dialogen gehen Vázquez-Rials fiktive Gardel-Forscher den vielen Fragen nach, die die Biographen des Sängers offen gelassen haben, weil ihnen die gesicherten Daten fehlten.
Losada malt aus, wie Kindheit und Jugend Gardels vielleicht hätten verlaufen können, wenn er in Toulouse das Licht der Welt erblickt hätte, und wie sich sein Leben abgespielt haben könnte, wäre Tacuarembó sein Geburtsort gewesen. Für beide Varianten führt Losada Indizien und Zeugen an, interviewt von ihm selbst oder von einem – natürlich ebenfalls fiktiven – uruguayischen Journalisten.
Vázquez-Rial stürzt Gardel von den Denkmälern, die man ihm gesetzt hat – den Mythos wohlbemerkt, nicht den Sänger, denn um den geht es ihm nicht in seinem Roman. Er zeichnet Gardel nicht als Lichtgestalt, sondern als einen Mann, der sein Leben lang Frauen ausbeutete, als Zuhälter zunächst, und der sich schließlich seine Filme von einer viel älteren, reichen Geliebten finanzieren ließ. Er log und betrog, wenn es ihm nützte, schlug sich, war in Schießereien verwickelt und paktierte mit zwielichtigen Politikern. Mit anderen Worten: Er war der typische argentinische Vivo, der versucht, für sich das Beste herauszuschlagen, und sei es auf Kosten anderer. Schließlich war er ein Kind seiner Zeit, musste sich in einem Land durchschlagen, in dem das Recht das Stärkeren herrschte.
Den Argentiniern hält der Roman den Spiegel vor, wenn er schildert, wie sie Gardel kurz vor seinem Tode keineswegs gefeiert, sondern nach Europa vertrieben haben, um ihn getreu ihrer Vorliebe für das Tragische dann nach dem Flugzeugunglück zur Legende hochzustilisieren.
Die Suche nach den Spuren des Mannes, der sich Gardel nannte, liest sich wie ein spannender Kriminalroman. Ein Ergebnis von Losadas akribischer Recherche sei bereits vorweggenommen: Letztendlich war Carlos Gardel auch nur ein armer Teufel.
Eva Karnofsky
Horacio Vázquez-Rial: Der Mann, der sich Carlos Gardel nannte.
Aus dem argentinischen Spanisch von Petra Zickmann und Stine Lehmann.
Piper Verlag 2006. Gebunden. 384 Seiten. 22,90 Euro.











