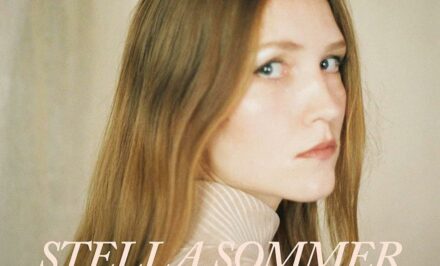Ohne Wenn und Aber ein Standardwerk
Ohne Wenn und Aber ein Standardwerk
Es gibt Bücher, die sind kompetent gemacht und nützlich. Lexika, zum Beispiel. Es gibt aber auch Bücher, die sind zudem noch unterhaltsam, witzig, an Kenntnissen reich und wichtig. Das Lexikon der Jazz-Standards gehört in diese Kategorie.
Jazz-Standards sind, wie der Name schon sagt, Musikstücke, die durch die Jazz-Geschichte in unendlicher Gestalt mäandern, manchmal verschwinden, irgendwann wieder und vermehrt auftauchen, Konjunktur haben, totgenudelt und plötzlich wieder ganz neu & frisch sind. Jazz-Standards sind nicht unbedingt Jazz-Kompositionen (wenn dies contradictio mal erlaubt ist), sondern können aus den unterschiedlichsten musikalischen Milieus stammen. Sie sind auch nicht deckungsgleich mit dem sog. Great American Songbook, gehören aber oft dahin. 320 dieser Standards stellen Schaal und seine dreizehn Ko-Autoren (allesamt wie der Herausgeber auch ausgewiesene Fachleute) vor. Wir kennen die Songs alle (naja, fast alle), auch wenn wir oft nicht genau wissen, was wir da mitsummen. Und sie haben alle ihre Geschichte. Ihre rein musikalische, die das Lexikon meist penibel analysiert und beschreibt (wer lässt in welcher Fassung was weg vom Original, wer fügt was hinzu, wer übernimmt nur bestimmte Teile) und ihre außermusikalische, das heißt „soziologische“. Und da wird`s dann oft ganz, ganz spannend.
Ein Beispiel: „Someday My Prince Will Come“ – eine grauenhafte Schnulze im Walzertakt, komponiert und getextet für den nicht minder grauenhaften Walt Disney Film „Schneewittchen“, ein „Verständigungsstück“ für alles, was man sich an mieser, amerikanischer weißer Ideologie plus family values nur albträumen mag. Sozusagen ein tönendes Ergänzungsstück zu Norman Rockwell. Das war 1936. Schnitt. Der Titel weste ruhig vor sich hin, bis 1957 Dave Brubeck, der Walzerfan kam, und den Kitsch bis auf den Kern abschnitt, und Paul Desmond die Reste zur saxofonischen Bearbeitung und emotionalen Abstrahierung hinwarf. Bill Evans ging zwei Jahre später zwar etwas schonender mit dem Material um, befreite es aber von seinem degoûtanten Kontext. Dann kamen Miles Davis und John Coltrane, die nun erst recht keine sentimentalen Gefühle für Ms. Snowhite hatten – schon gar nicht, Miles Davis, der eine ganze LP „Someday My Prince Will Come“ nannte und aufs Cover seine Prinzessin Frances Taylor platzierte: Eine schwarze Frau. Dann bekommt die Geschichte noch ein paar pikante Drehs (die ich hier nicht alle nacherzähle) – auf jeden Fall hielt sich der Song bis in unsere Tage und Cassandra Wilson.
Das alles lässt sich aus dem Lexikon lernen, wie gesagt, 320 mal. Gar nicht alle aufzählen kann man die Subtexte und roten Fäden, die klug durch das Buch gezogen sind. Stellvertretend sei die Rezeptionsgeschichte von Thelonious Monks „Gruselmusik“ (wie die sehr junge Mary Lou Williams sie einmal nannte, was ihr später peinlich war) erwähnt, bis das ganze strahlende Genie dieses Mannes wahrgenommen werden konnte.
Als kleine sympathische Asides brechen die Autoren die eine oder andere Lanze für die Substanz und wider das ganze modische Getüddel und Geschnüddel, das auch der Jazz erleiden muss, wenn er mal wieder in ist und Billie Holiday in der Whiskey-Werbung verdödelt wird. Deswegen finden wir so schöne und richtige Bemerkungen z.B. über Musiker wie Harold Land („unterschätzt“) oder Benny Golson, der im Artikel über „Stablemates“ endlich mal als bedeutender Komponist gewürdigt wird.
Jazz-Standards ist ohne Wenn und Aber ein Standardwerk, auch deshalb, weil die Autoren schreiben können.
Zur Homepage des Buchautors
Thomas Wörtche
Hans-Jürgen Schaal: Jazz-Standards. Das Lexikon. Bärenreiter Verlag 2001. 590 Seiten. 34,90 Euro. ISBN: 3-761-81414-3