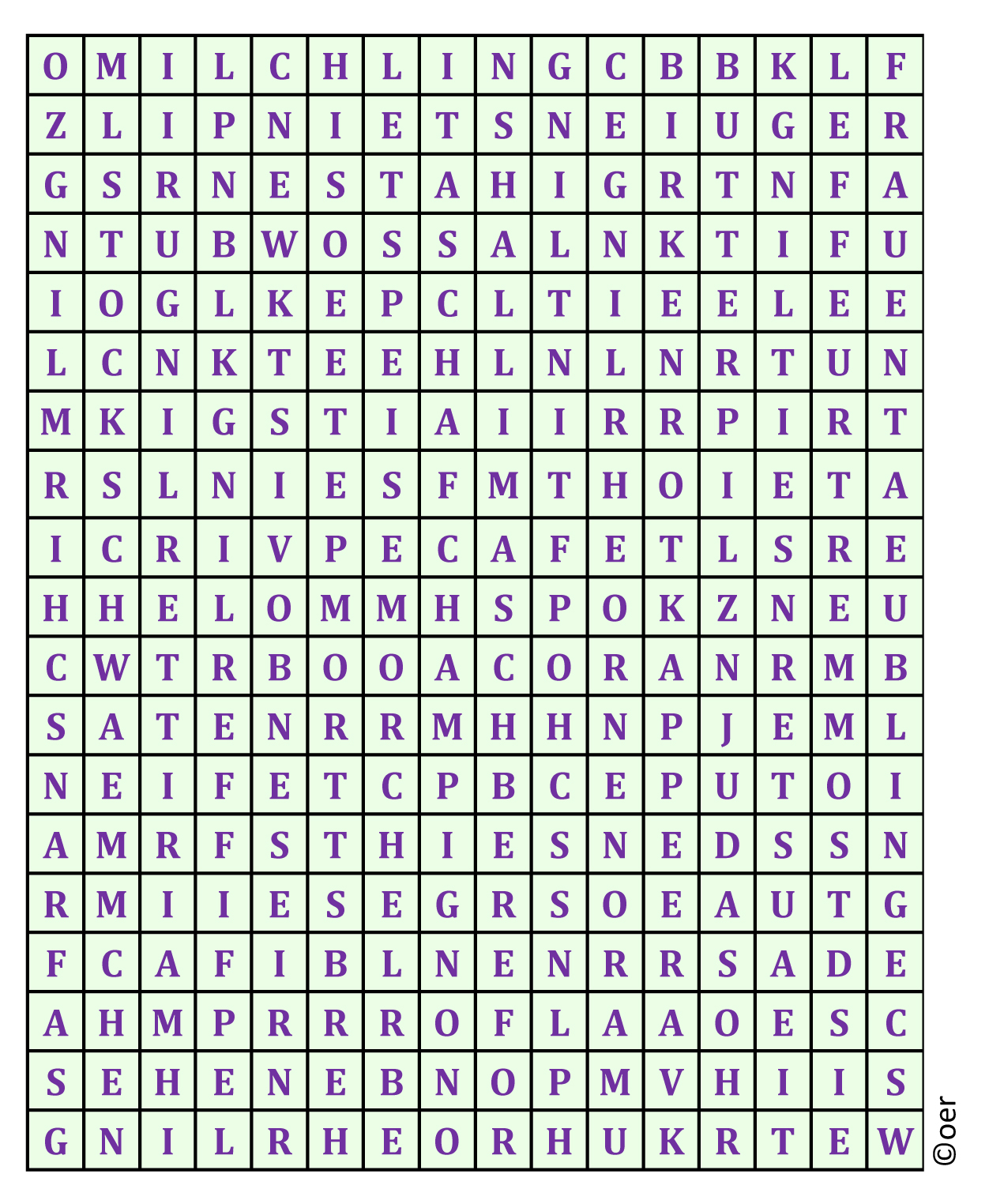Reden wir mal drüber
Reden wir mal drüber
Politische Peinlichkeiten von Schriftstellern aller Sortierung ist man ja grundsätzlich gewöhnt. Eigentlich sagt das nur, dass Intellektuelle per se keine moralischen und politischen Instanzen sind, auch wenn sie das gerne glauben möchten. Selten aber trifft politische Peinlichkeit (siehe die FREE GAZA-Nummer in türkischem Dienst und zu Gefallen der Hamas) und schriftstellerisches (Un-)Vermögen so deckungsgleich aufeinander wie bei Henning Mankell. Thomas Wörtche hat seinen angeblich letzten Wallander-Roman tatsächlich ganz durchgelesen …
Über Tote nur das Beste – dieser noble Grundsatz hätte vielleicht gelten können, wenn Henning Mankell in seinem neuen Roman Der Feind im Schatten seine Hauptfigur, den schonischen Kriminalkommissar Kurt Wallander, hätte sterben lassen. Von Schurkenhand etwa oder bei einer heroischen Rettungstat. Aber Mankell wählt leises Verdämmern – Alzheimer. Und behält damit die Option, dereinst doch noch einen Wallander-Roman nachzuschieben zu können, denn Nicht-Wallander verkaufen sich einfach nicht so rasend wie Wallander-Romane.
Das wäre aber als Vorwurf unfair, denn Serienfiguren umzubringen und bei Bedarf wieder auferstehen zu lassen hat, seit Sherlock Holmes’ Sturz in die Reichenbachfälle bis zur Wiederauferstehung des mexikanischen Privatdetektivs Héctor Belascoaran Shayne kraft des Willensaktes seines Schöpfers Paco Ignacio Taibo II, ist eine gute kriminalliterarische Tradition. Mankell wählt jedoch mit Alzheimer die Variante mit dem höchsten Betroffenheitsfaktor. Ein beliebter Held, der nicht mit Grandezza untergeht, sondern verlöscht – wie menschlich, wie wahr, wie rührend.
Anständige Menschen
Darin liegt vermutlich auch Mankells Erfolgsgeheimnis. Seine Bücher bis zum Rand mit echt menschlichen Qualitäten vollzupropfen, an denen anständige Leute nicht mäkeln können. Eine stahlharte Konsensklammer, bis Mankell versucht, sie realpolitisch zu füllen: Das geht dann, wie eben gerade auf dem Mittelmeer gründlich schief. Denn moralische Positionen für sich verbaliter zu reklamieren, ist einfach.
Literarisch auch nichts schlichter und billiger als das: Natürlich sollen Polizisten sich ihrem Beruf und den Opfern von Gewalt und Verbrechen gegenüber verantwortlich fühlen, natürlich sollen sie ihrem sozialen Umfeld gegenüber sensibel sein, natürlich sollen sie nicht ruhen, bevor Gerechtigkeit geschehen ist oder, wenn das nicht möglich ist, wenigstens dann der tiefen Melancholie anheimfallen. Und natürlich sollen sie alle Bezirke menschlicher Gemeinschaft als Tatorte entlarven, die tatsächlich welche sind: die Familie, den Staat, die Institutionen, die Politik, das Business und alle anderen Faktoren struktureller Gewalt. Und natürlich besteht Konsens darüber, dass auch solche Polizisten Menschen sind, zu viel trinken, trüben Sex haben, altern, übellaunig und Beziehungstölpel sind und andere Macken mehr haben, die allesamt lässlich sind, wenn wir nur mal darüber gesprochen haben.
Und genau das lässt Mankell seinen Kommissar in diesem letzten, arg zähen Roman pausenlos tun: Mal drüber reden.
Der Kriminalfall, in einem Kriminalroman günstigenfalls zentral, ist in Der Schatten des Feindes gekünstelt und gesucht: Die beiden Eltern des Vaters von Linda Wallanders Kind verschwinden spurlos. Ein pensionierter Marineoffizier und eine pensionierte Deutschlehrerin. Sie wird bald tot aufgefunden, er nicht. Alle Hinweise und Spuren führen zurück in die Zeiten des Kalten Krieges, in denen sich die block-neutralen schwedischen Hoheitsgewässer höchster Beliebtheit bei U-Booten fremder Mächte erfreuten. Menschen aus Wallanders Generation – er wird in diesem Buch sechzig Jahr alt – erinnern sich noch gut an die Fernsehbilder jener Tage, als es den Schweden nie wirklich gelang, solche U-Boote zum Auftauchen zu zwingen. Alte Schoten aus alten Zeiten. Die auch nicht frischer werden, wenn das Ratespiel, wer damals möglicherweise Spion für wen war oder nicht (im Hintergrund rumort die nun wirklich sehr gut abgehangene Diskussion um den ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme), im Jahr 2007 noch einmal aufgewärmt wird. Anscheinend morden Geheimdienste fröhlich weiter, aber warum bleibt unklar und ungelöst. Das Skandalon, das Mankell anprangernd andeuten möchte, ist die realpolitisch nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit, dass die USA auch Spione im schwedischen Militär hatten. Ach!
Nur peinlich …
Aber dieser Fall mit historischen Wurzeln und familiärer Verflechtung bietet Wallander die Möglichkeit, eine Art Rückschau zu halten. Über sein Leben, über seine Fälle, über die Geschichte Schwedens, über seine Frauen, über alles Leid und Weh. Das wäre ein episches Projekt, eine neue „Recherche“, ein Jahrhundertroman. Aber wenn in einem Kriminalroman der Held an jeder Ampel, an der er anhalten muss, an jedem sommerlichen Feld, an dem er vorbeifährt, an jedem Waldweg, den er betritt, von seinen Erinnerungen gepackt wird, die zufällig kleine Paraphrasen von und kleine Annoncen für seine älteren Bücher sind, dann wird die Angelegenheit schräg. Eigenwerbung ist immer peinlich. Und Peinlichkeiten zu transportieren kann ein Kriminalroman nicht leisten, wenn er gut sein soll.
Denn alle diese werkimmanenten Verweise, die Mankell mit breiten Pinselstrichen aufträgt, dienen ja nur dazu, einen höchst unplausiblen Plot zu übertünchen. Denn Der Feind im Schatten ist ein Pappkamerad, der keinen anderen Sinn hat, als alle Wallander’schen Untugenden sozusagen frei von der störenden Stringenz einer spannenden Geschichte ausbreiten zu können. Das Jammern und Wehklagen des Kommissars über Gott und die Welt tötet jeden thrill, die pausenlose Auseinandersetzung mit seinem Vater langweilt. Und die Begegnungen mit den zwei wichtigen Frauen seines Lebens – der Mutter seiner Tochter und seine lettische Geliebte –, die übrigens beide schlimme Schicksale eint: Die eine ist dem Alkohol verfallen, die andere, moribund von Krebs, fährt sich mit dem Auto zu Tode –, sind sehr schöne Anlässe für Wallanders Selbstbezichtigungsorgien. Nicht verschont werden wir von hypochondrischen Schüben – fällt Wallander eine Plombe aus dem Zahn, wähnen wir ihn von der Lepra in Teilchen zerlegt.
Komik? Fehlanzeige …
So etwas ohne den geringsten Anflug von ironischer oder komischer Brechung zu inszenieren, hat bei Mankell System: Denn im permanenten Betroffenheitsmodus haben literarische Formen der Ambiguisierung und Polyvalenz nichts zu suchen. Komik ist der systematische Feind der Gewissheiten – und bei aller Zauderei und Zögerei geht es Mankell um bleischwere Gewissheiten.
Das hat formale Konsequenzen, deswegen erwecken Wallander-Romane auch grundsätzlich den Eindruck alt-gediegenen Erzählens, im Ton eines 19.-Jahrhundert-Realismus, den es im 19. Jahrhundert bei Romanen von Belang so behaglich, so getragen und verstörungsfrei nie gegeben hat. Das einzige, in anderen Wallander-Romanen oft exzessiv genutzte Stilmittel, die Schaffung einer gewissen Fallhöhe durch ultrabrutale, auf den blanken Voyeurismus eines als senibel eingeschätzten Publimums setzende Szenen, fällt in diesem letzten Buch weg. Alles wird in einem milden Graulicht des Abenddämmers weichgezeichnet. Die Gediegenheit schlägt um in pure Langeweile, episches Mäandern erschöpft sich in der Aufzählung nicht-funktionaler Genre-Bildchen und Idyllen, in denen Kurt Wallander sein Hündchen abspritzt oder an seinem Haus werkelt. Literatur tut an solchen Stellen so, als sei sie selbst die echte, wirklich Wirklichkeit, die die ganzen form- und strukturkonservativen Standards eines Polizeiromans beglaubigen könnte. So literarisch flach und bieder haben selbst in den 1960er und 1970er Jahren Mankells große Inspiratoren, Maj Sjwöwall und PerWahlöö nicht geschrieben.
Und genau so kann man den neuen Roman einschätzen: Als ziemlich langweiligen, routiniert-misslungenen Standardkrimi, wie es ihn zu Tausenden und Abertausenden gibt. So, wie schon von Anfang an und selbst ihren allerbesten Momente alle Wallander-Krimis keine qualitativen Merkmale auswiesen, die sie von andern Serien der Preisklasse Peter Robinson, Ian Rankin oder John Harvey unterschieden hätten.
So gesehen sind es good news, wenn wir hiermit wirklich den letzten Roman mit Kurt Wallander überstanden hätten.
Jeweils abweichende Fassungen dieses Artikels finden Sie auch auf der Freitag und kaliber.38.
Thomas Wörtche
Henning Mankell: Der Feind im Schatten (Den orolige mannen, 2009). Roman.
Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt.
Wien: Zsolnay Verlag 2010. 590 Seiten. 26 Euro.