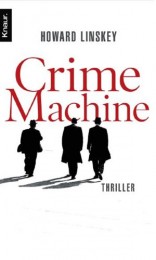 Die Freuden des organisierten Verbrechens
Die Freuden des organisierten Verbrechens
– Fresh blood im britischen Gangsterroman. Keine Posen und Albernheiten, keine fahle Romantik, kein umständliches Rumgeeiere, sondern Sarkasmus und Klarsicht, galore. „Crime Machine“ von Howard Linskey heißt ein sehr starkes Debüt … Thomas Wörtche nennt ein paar Gründe, warum das so ist.
Organisiertes Verbrechen hat gegenüber unorganisiertem viele Vorteile. Klare Strukturen, keine Kollateralschäden bei Auseinandersetzungen, eindeutig definierter Geldfluss, Preisstabilität, transparentes Preis-Leistungs-Verhältnis und andere ordnungspolitische Maßnahmen gegen die Anarchie ungeordneter Verhältnisse mehr. So sehen das im nordenglischen Newcastle-upon-Tyne nicht nur die örtlichen Gangster, sondern auch die Polizei, die gegen eine erhebliche Aufbesserung der schmalen staatlichen Bezüge gerne an der Aufrechterhaltung des status quo beteiligt ist. Sehr zufrieden ist auch die hohe Politik in London, die gerne gegen entsprechende Finanzierung mit Gesetzesvorhaben und anderen nützlichen Initiativen dem organisierten Verbrechen hilft, wo sie kann. So ist alles bestens geordnet, am Anfang von Howard Linskeys Debütroman „Crime Machine“.

Es knirscht
Die Maschinerie beginnt zu knirschen, als eine große Schmiergeldzahlung an einen Lobbyisten, der als Bindeglied zwischen Gangstern und Politik fungiert, ausbleibt. Verantwortlich für den Transfer ist die Hauptfigur unseres Romans, David Baker, der Berater des Big Boss von Newcastle. Bobby Mahoney und sein Knochenbrecher Finney, beide noch von altem Schrot und Korn, reagieren humorlos: Entweder schafft Baker das Problem aus der Welt oder er selbst hat ein finales Problem. Dieser Baker ist eher ein Intellektueller als ein Verbrecher mit Stallgeruch, physische Gewalt ist sein Ding nicht, deswegen halten ihn ein paar Typen aus der Verbrechensaristokratie von Newcastle für ein Weichei. Aber unter seiner Ägide blühen die Umsätze und gedeihen die Profitraten. Aus der Perspektive dieses Yuppies ist der Roman mit eher heiterem Sarkasmus erzählt. Ein eleganter Plauderton, den Conny Lösch sehr schön getroffen hat, zwischen derbem Slang und smartem Talk, stets flexibel, immer ein wenig ironisch, nie pathetisch, nie plump. Aber natürlich eine wunderbare Falle für den Leser, der meint, er weiß, wie die Dinge laufen.
 Komisch
Komisch
Richtig bösartig wird die Angelegenheit im weiteren Verlauf der Geschichte, als der clevere consigliere – Anspielungen und Zitate aus Mario Puzos/Coppolas „Der Pate“ geben dem Roman noch eine ironische Komponente mehr – plötzlich zu sehr robustem Handeln gezwungen wird. Das tut er dann auch – und wir stecken mitten in einem klassischen, brutalen britischen Gangsterroman in der Tradition eines Ted Lewis. Aber Achtung, in einer Tradition, die nicht in dem Ted Lewis von 1970, der mit „Get Carter“ eine ganze Tradition des BritNoir initiiert hatte, aufgeht. Der von fast allen Lewis-Exegeten heruntergespielte und schon als Zeugnis des alkoholischen Verfalls gewertete dritte Teil der Carter-Trilogie von 1977: „Jack Carter and the Mafia Pigeon“ (der schwachsinnige deutsche Titel lautete damals „Jack Carters Wut“ und nichts kann das Missverständnis deutlicher machen) hat nämlich deutlich komische Züge (und paraphrasiert grimmig Schnitzlers „Reigen“, aber das nur nebenbei) – und hier knüpft Linskeys Buch an, das bei aller Härte komisch ist, ohne lustisch oder witzisch zu sein. Und natürlich spukt im Hintergrund der maliziöse Blick von Bill James auf die Welt, die Korruption und die Ordnung der Dinge durch die Zeilen.
Clare et distincte
„Crime Machine“ überzeugt nicht nur wegen der politischen Klarsicht der Handlung – eine fünfseitige Lektion über die Kooperation von Politik und Verbrechen gehört zum Prägnantesten, was zum Thema je gesagt wurde, man sollte die Seiten 165 bis 169 obligatorisch für jeden Sozialkundeunterricht machen und auswendig lernen lassen –, der Roman erfreut zudem mit allen seinen Elementen: mit wunderbaren, trockenen Dialogen, mit präzisen Beschreibungen von Land und Leuten, mit trefflich charakterisierten Figuren und einer beinahe schon mustergültigen Spannungsdramaturgie, die erst langsam, dann aber stetig und rasant beschleunigt, ohne an Lakonie und Coolness zu verlieren.
Gangster scheitern nicht
Die roman-noir-hafte Romantik des scheiternden Gangsters ist Howard Linskeys Sache nicht. Scheiternde Gangster bestätigen höchstens die „poetische“ Ordnung der Dinge – aber selbst das wäre nicht mehr realitätstüchtig. Nur dumme oder selbstgefällige Gangster bleiben auf der Strecke. Auch eine Diskussion, ob das organisierte Verbrechen sich am Ende durchsetzen wird oder nicht, findet glücklicherweise bei Linskey nicht statt. Die Romantik des Outlaw ist einem vernünftigen ökonomischen Kalkül gewichen, das auch die jeweilige Eskalationsstufe der eingesetzten Gewalt regelt – was nicht heißt, dass es in dem Roman nett zugeht. Aber dieses vernünftige Kalkül gegen die üblichen Posen und Stilisierungen des Noir ist nicht etwa ein Verlust an düsterer Poesie, sondern radikalisiert den Roman eher noch, weil sich dadurch jede märchenhafte, also jede versöhnliche Lesart verbietet. Und Versöhnlichkeit ist eine Kategorie, die in diesen Kontexten nichts zu suchen hat.
All das macht „Crime Machine“ zu einem unbehaglichen, großartigen Buch.
Thomas Wörtche
Howard Linskey: Crime Machine (The Drop, 2011). Roman. Deutsch von Conny Lösch. München: Knaur TB 2012. 378 Seiten. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Homepage des Autors.











