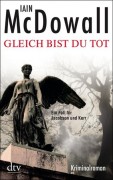 Von der Unfähigkeit des Autors, mit Kunst Kunst zu machen
Von der Unfähigkeit des Autors, mit Kunst Kunst zu machen
Manchmal haben Autoren ja richtig schöne Ideen. Sogar bei Krimiautoren soll das häufiger vorkommen. Iain McDowall zum Beispiel hatte ein paar richtig schöne Ideen, als er sich an seinen vierten Roman mit den Herren Jacobson und Kerr setzte: Identitätsklau. Im Namen der Kunst. Von Henrike Heiland
Vier Studenten wollen Kunst machen, auf die radikale Tour. Sie entführen junge Frauen, bringen sie dazu zu glauben, sie würden gleich sterben, und filmen die Todesangst. Die Videos schicken sie an die Medien. Großen Ruhm erhoffen sie sich durch dieses Projekt, danach, glauben sie, stehen ihnen alle Türen offen. Das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber irgendwie ist es eine reizvolle Idee. Kunst muss provozieren. Kunst tritt sowieso nur noch auf der Stelle, weil sie außer in Museen und Auktionshäusern nicht mehr recht stattfindet. Kunst braucht die visuellen Medien zur besseren Verbreitung und eine unerhörte Radikalität, um im Informationsdschungel wahrgenommen zu werden. Aber wie gesagt, so wirklich zu Ende gedacht ist das weder von den vier Studenten, noch vom Autor.
Die vier also finanzieren sich ihre kostspieligen Aktionen (sie brauchen dazu teure Mietswohnungen in exklusiven Lagen, teure Mietwagen, teure Klamotten und natürlich teures Equipment) durch Identitätsklau. Das haben sie gut drauf, weil sie vorher in einem Callcenter gearbeitet haben, und einer von ihnen, sie nennen ihn Adrian, kann sowieso alles, was man so mit Computern eben kann. Die anderen sind Brady, der sich in der Rolle des Anführers gefällt; Annabel, seine Geliebte, die sich ihm nur zu gerne unterwirft, zugleich aber auch durchaus sadistische Züge hat; und Maria, ebenfalls Sexgespielin Bradys, ebenfalls gerne in der Rolle der Untergebenen, und für die Gruppe dazu noch von Wert, weil sie sich als Maskenbildnerin gekonnt einbringt. So verändern die vier immer wieder ihr Aussehen, womit sie die in Großbritannien allgegenwärtige Kameraüberwachung austricksen wollen. Das ist auch wieder nur so halb durchdacht. Da bekommen zwei Figuren eine Funktion, damit die Pläne auch praktisch durchsetzbar sind, aber das Verhältnis untereinander verurteilt die Aktion noch vor ihrem Beginn zum Scheitern. Auch für den Leser. Wo es Sympathie für die Kunstrebellen gebraucht hätte, finden sich nur redundante Beschreibungen dieser Viererbeziehung. Die gerät zwar im Laufe der Geschichte aus den Fugen, aber wenn Charaktere, von denen man sowieso nichts gehalten hat, ihre Lage von sich aus noch verschlimmern, schaut man eher ein bisschen genervt zu, als dass es einen in den Bann zieht. Das hat also schon mal nicht so richtig geklappt.
Konstrukt mit Schlagseite
Ganz schön könnte die Geschichte mit den Ermittlern sein. Jacobson nervt zwar, weil er diese Marotte hat, jeden in der Übersetzung mit „alter Junge“ oder „alter Knabe“ anzuschwafeln, aber er ist ein angenehm zurückhaltender Vorgesetzter. Kerr hat so seine privaten Problemchen, die angerissen und nicht ganz zu Ende erzählt werden. Das ist alles recht hübsch, da weiß man, dass man mitten in einer Serie steckt, aber – es ist entsetzlich langweilig. Weil es irgendwie oberflächlich und zu nebenbei erzählt ist. Was nicht am Raum liegt, den die Geschichten bekommen, sondern eher an der Erzählqualität. Die hakt dann auch gleich noch bei den ermittlungsrelevanten Parts. Die sind derart ausführlich, da fragt man sich zwischendrin, ob man aus Versehen ein Handbuch für die praktische Polizeiarbeit erwischt hat. Als hätte der Autor in seinem Leben noch keinen Krimi geschrieben und wäre jetzt ganz aufgeregt darüber, dass er ganz viel Polizeiwissen hat, das er dringend weitergeben muss. Oh bitte. Und weil das alles viel Platz wegnimmt, fehlt der natürlich anderswo. Das Konstrukt hat Schlagseite.
Zurück zur Geschichte. Die vier Studenten also entführen junge Frauen, filmen ihre Todesangst, lassen sie dann wieder laufen bzw. sorgen dafür, dass sie gefunden werden. Bis eine abhaut und vor einen LKW läuft. Ab jetzt müsste die Spannungsschraube irgendwie angezogen werden, dramaturgisch gesehen. Passiert aber nicht. Stattdessen mischt sich eine neue Erzählperspektive ein, die einer jungen Rocksängerin, die zufällig die Tochter eines total bekannten alternden Ex-Rockstars ist, von der wird erzählt und erzählt und erzählt, da weiß der Autor nicht so recht, soll sie nun sympathisch sein oder nicht (der Leser weiß es auch nicht), er wird sich nicht einig (der Leser ebenso wenig), und dann lässt er (der Autor) sie (die Sängerin) kurzerhand von den Studenten entführen. Jetzt kommt der Polizeiapparat so richtig ins Rollen. Und vielleicht hätte das Buch erst hier anfangen sollen. Ab jetzt wird nämlich erst eine Geschichte erzählt. Na ja, es wird versucht. Es krankt daran, dass immer noch kein einziger Charakter die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln weiß, dass sich immer noch in Klischees und Details und Nebenstraßen verlaufen wird, und dann ist irgendwie, nach vielen langweiligen Seiten, das Buch zu Ende. Viele verschenkte Szenen lungern darin herum, viele Momente, denen man die gute Idee irgendwie angesehen hat, die aber an der Ausführung gescheitert sind. Ja, das Ende, bei dem man dann die echte, die wahre Motivation der Kunststudenten erfährt, das enttäuscht so sehr, dass man wirklich niemandem empfehlen mag, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Schade um die Zeit, die man damit verbracht hat. Schade um das, was man aus den Ideen hätte machen können. Schade um die Kunst, die keine war.
Henrike Heiland
Iain McDowall: Gleich bist du tot. (Cut Her Dead, 2007).
Deutsch von Werner Löcher-Lawrence. 400 Seiten.
München: dtv 2009. 8,95 Euro.











