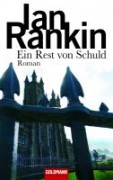 Das Rebus-Projekt
Das Rebus-Projekt
Bye, bye, Rebus! Aus dem Dienst geschieden nach 17 Romanen – ein wehmütiger und tapferer Rückblick, auch auf lose Enden von Tobias Gohlis
Exit Music – der englische Titel klingt nach mehr als Abschied. John Rebus, sechzigjährig und im 17. Roman, ist vor einem Jahr in Ruhestand gegangen. Die Schotten legten 2007 keineswegs, wie noch nach dem Dahinscheiden des ebenfalls einer Edinburgher Schottenfeder entsprungenen Sherlock Holmes, Trauerflor an. Sie feierten das Ende ihres local heros mit einer Extralage von Deuchars IPA.
Rankin, der im August zwanzigjähriges Dienstjubiläum feierte (Knots and Crosses, der erste Rebus-Roman, ist 1987 erschienen), bekam 20 Flaschen Highland Park Malt – eine Rebus-Sonderabfüllung, von der es noch ein Fässchen geben soll, das garantiert finanzkrisenfrei vor sich hin reift. Auch sonst verlief der biologisch bedingte Ausstieg des DI ohne Turbulenzen, sieht man einmal davon ab, dass der Vorschlag des bekennenden Rebus-Fans und Polizeipräsidenten, das Dienstalter auf 65 heraufzusetzen, Rankin, der damit gar nichts zu tun hatte, einen Korb Hass-Mails von Lothian and Borders einbrachte.
Der 17. Rebus
 Ein Rest von Schuld – der deutsche Titel des jetzt auch hier erschienenen 17. Rebus ist besser als die meisten anderen gewählt. (Obwohl er vielleicht etwas zu eindeutig auf einen entscheidenden Aspekt der Lösung hinweist und damit konservative Krimileser, die immer noch Whodunnit für die Existenzfrage halten, frustrieren könnte.) Ein Rest von Schuld – das spricht natürlich deutsche Grübler an, zu denen ich mich manchmal auch zu zählen neige, mittwochs und donnerstags. Und es verweist auf etwas Unaufgelöstes. Dem möchte ich einen Moment nachgehen.
Ein Rest von Schuld – der deutsche Titel des jetzt auch hier erschienenen 17. Rebus ist besser als die meisten anderen gewählt. (Obwohl er vielleicht etwas zu eindeutig auf einen entscheidenden Aspekt der Lösung hinweist und damit konservative Krimileser, die immer noch Whodunnit für die Existenzfrage halten, frustrieren könnte.) Ein Rest von Schuld – das spricht natürlich deutsche Grübler an, zu denen ich mich manchmal auch zu zählen neige, mittwochs und donnerstags. Und es verweist auf etwas Unaufgelöstes. Dem möchte ich einen Moment nachgehen.
Unaufgelöst ist zunächst einmal das zentrale Freund-Feindverhältnis. Ich weiß nicht genau, in welchem Rebus-Roman er erstmals auftaucht, aber seit langer, langer Zeit ist Big Ger Cafferty, Edinburghs Unterwelt-Boss, Rebus’ Erzfeind. John Skinner, der leider früh verstorbene Rankin-Prophet und Erfinder der Rebustours, die längst fester Bestandteil des Edinburgher Tourismus-Angebots sind, nahm Wetten an, von welcher der Brücken über den Water of Leith Rebus und Cafferty in tödlichem Zweikampf verkrallt stürzen würden. Jetzt ist es eine andere Brücke, die Leamington Lift Bridge, und Cafferty wird dort ganz allein erwischt und fast totgeschlagen – was einen verblüffenden, weil fast versöhnlichen Akkord in die Abschiedsmusik bringt.
Lose Enden
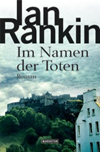 Unaufgelöst, weil unauflösbar offen, ist natürlich Rebus’ Verhältnis zu Siobhan Clarke. Weder erfahren wir, ob sie den verdienten Job als DI endlich kriegt – im konkreten Fall darf sie die Ermittlungen interimistisch führen, aber nur, bis er politisch zu brisant wird. Rebus ist derweil suspendiert, er hat wieder einmal seinen proletarischen Klassenstolz nicht zügeln können und den Polizeichef der Korruption und schlimmer noch! Ermittlungsbehinderung geziehen. Diese Konstellation – sie drinnen, er draußen – führt zu einer raffinierten Form von Telefonkontakt. (Überhaupt spielen Abhören, Videoüberwachung und Täuschung dieser im Vereinigten Königreich so hochgepriesenen Herrschaftstechniken eine subtile Nebenrolle). Unaufgelöst, aber bis auf die Spitze getrieben, ist die Frage, die Rebus spätestens seit Im Namen der Toten umtreibt: Ob nicht die Oberwelt viel gefährlicher ist als die Unterwelt. Dies ist Kern des Plots. Ein russischer Dichter wird unterhalb der Burg erschlagen. Und je länger Rebus ermittelt – die Nachrichten vom parallelen Sterben Litwinenkos in London geben gewissermaßen den Totenwurm-Takt dazu – desto klarer fasst er die feiste Spinne im Netz aus Kinderprostitution, Drogenhandel, Ehebruch, Mord und Wirtschaftsförderung ins Auge: Es ist die First Albannach Bank (die ein schottischer Insider als Royal Bank of Scotland identifiziert hat, mit der Einschränkung allerdings, deren Manager seien weniger korrupt und kriminell als in der Fiktion, das war allerdings im September 2007). Rebus ermittelt und ermittelt ein scheußlicheres Detail nach dem anderen, inspiriert – er, der sonst auf Uralt-Rock abfährt – durch ein Gedicht des Russen, das wiederum den schottischen Nationaldichter Robert Burns zitierend die „Volksverräter“ anprangert. Schon glaubt er, das ökonomische Interessengeflecht zwischen Schottischen Nationalisten, dem Minister für Wirtschaftentwicklung, russischen Oligarchen auf der Flucht und – natürlich! – Big Ger Cafferty durchschaut zu haben, da drängt sich eine unerwartete Lösung auf.
Unaufgelöst, weil unauflösbar offen, ist natürlich Rebus’ Verhältnis zu Siobhan Clarke. Weder erfahren wir, ob sie den verdienten Job als DI endlich kriegt – im konkreten Fall darf sie die Ermittlungen interimistisch führen, aber nur, bis er politisch zu brisant wird. Rebus ist derweil suspendiert, er hat wieder einmal seinen proletarischen Klassenstolz nicht zügeln können und den Polizeichef der Korruption und schlimmer noch! Ermittlungsbehinderung geziehen. Diese Konstellation – sie drinnen, er draußen – führt zu einer raffinierten Form von Telefonkontakt. (Überhaupt spielen Abhören, Videoüberwachung und Täuschung dieser im Vereinigten Königreich so hochgepriesenen Herrschaftstechniken eine subtile Nebenrolle). Unaufgelöst, aber bis auf die Spitze getrieben, ist die Frage, die Rebus spätestens seit Im Namen der Toten umtreibt: Ob nicht die Oberwelt viel gefährlicher ist als die Unterwelt. Dies ist Kern des Plots. Ein russischer Dichter wird unterhalb der Burg erschlagen. Und je länger Rebus ermittelt – die Nachrichten vom parallelen Sterben Litwinenkos in London geben gewissermaßen den Totenwurm-Takt dazu – desto klarer fasst er die feiste Spinne im Netz aus Kinderprostitution, Drogenhandel, Ehebruch, Mord und Wirtschaftsförderung ins Auge: Es ist die First Albannach Bank (die ein schottischer Insider als Royal Bank of Scotland identifiziert hat, mit der Einschränkung allerdings, deren Manager seien weniger korrupt und kriminell als in der Fiktion, das war allerdings im September 2007). Rebus ermittelt und ermittelt ein scheußlicheres Detail nach dem anderen, inspiriert – er, der sonst auf Uralt-Rock abfährt – durch ein Gedicht des Russen, das wiederum den schottischen Nationaldichter Robert Burns zitierend die „Volksverräter“ anprangert. Schon glaubt er, das ökonomische Interessengeflecht zwischen Schottischen Nationalisten, dem Minister für Wirtschaftentwicklung, russischen Oligarchen auf der Flucht und – natürlich! – Big Ger Cafferty durchschaut zu haben, da drängt sich eine unerwartete Lösung auf.
Rankins Poetologie
 Und letztlich bleibt unaufgelöst, weil immer nur von Buch zu Buch neu einlösbar, der große Plan Rankins, Edinburgh ein neues literarisches Gesicht zu geben. Er selbst nennt es „give sense to my town“. Aber was er auf diesem Weg getan hat, reiht ihn, da ist Allan Massie vom New Scotsman recht zu geben, unter die Autoren ein, die Weltliteratur als Literatur über ihre Stadt geschrieben haben. Massie vergleicht Rankin mit Dickens/London und Chandler/Los Angeles, andere wären zu ergänzen. Ausgangspunkt des Projekts (entstanden übrigens auf der Arbeitsflucht vor einer Dissertation über Muriel Spark – die überragende Autorin Edinburghs in den fünfziger und sechziger Jahren) war der Versuch, Stevensons Mr Jekyll & Dr Hyde modern zu erzählen. Unerfahren als Krimiautor (bis heute behauptet Rankin, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er in seinem ersten Roman crime geschrieben habe) ist er in den auf Knots and Crosses (Verborgene Muster) folgenden Bänden erst einmal auf der damals grassierenden Serienkiller-Welle gesurft, sozusagen trainingshalber. Bis Rankin mit Black and Blue 1997 (deutsch acht Jahre verspätet unter dem blödsinnigen Titel Das Souvenir des Mörders) nicht nur der Durchbruch gelang, sondern auch zwei neue Elemente in seiner Erzählung etablierte: das ironische Spiel mit der Edinburgher Topographie (seitdem frequentiert Rebus die Oxford-Bar, 8 Young Street) und die Nutzung der Real- und Stadtgeschichte als Nährstoff der Fiktion. Mit dieser Methode entstanden so großartige Bücher wie Das Puppernspiel, Die Seelen der Toten und Die Tore der Finsternis, in denen Rankin die schwarze Geschichte Edinburghs systematisch mythifiziert, ohne je die Realität der Stadt aus den Augen zu verlieren.
Und letztlich bleibt unaufgelöst, weil immer nur von Buch zu Buch neu einlösbar, der große Plan Rankins, Edinburgh ein neues literarisches Gesicht zu geben. Er selbst nennt es „give sense to my town“. Aber was er auf diesem Weg getan hat, reiht ihn, da ist Allan Massie vom New Scotsman recht zu geben, unter die Autoren ein, die Weltliteratur als Literatur über ihre Stadt geschrieben haben. Massie vergleicht Rankin mit Dickens/London und Chandler/Los Angeles, andere wären zu ergänzen. Ausgangspunkt des Projekts (entstanden übrigens auf der Arbeitsflucht vor einer Dissertation über Muriel Spark – die überragende Autorin Edinburghs in den fünfziger und sechziger Jahren) war der Versuch, Stevensons Mr Jekyll & Dr Hyde modern zu erzählen. Unerfahren als Krimiautor (bis heute behauptet Rankin, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er in seinem ersten Roman crime geschrieben habe) ist er in den auf Knots and Crosses (Verborgene Muster) folgenden Bänden erst einmal auf der damals grassierenden Serienkiller-Welle gesurft, sozusagen trainingshalber. Bis Rankin mit Black and Blue 1997 (deutsch acht Jahre verspätet unter dem blödsinnigen Titel Das Souvenir des Mörders) nicht nur der Durchbruch gelang, sondern auch zwei neue Elemente in seiner Erzählung etablierte: das ironische Spiel mit der Edinburgher Topographie (seitdem frequentiert Rebus die Oxford-Bar, 8 Young Street) und die Nutzung der Real- und Stadtgeschichte als Nährstoff der Fiktion. Mit dieser Methode entstanden so großartige Bücher wie Das Puppernspiel, Die Seelen der Toten und Die Tore der Finsternis, in denen Rankin die schwarze Geschichte Edinburghs systematisch mythifiziert, ohne je die Realität der Stadt aus den Augen zu verlieren.
Kurz bevor Rebus, den bedeutenden Moment bannig ironisierend, seinen Krempel packt, um sein letztes Büro zu verlassen, gehen ihm schwere Gedanken durch den Kopf. Es ist Rankins Poetologie: „Die Stadt war der Sauerstoff in seinem Blut, noch immer reich an Geheimnissen, die es zu lüften galt. Seit er Bulle war, hatte er hier gelebt, so dass Job und Stadt sich unentwirrbar miteinander verwoben hatten. Jedes neue Verbrechen hatte dazu beigetragen, die Welt ein wenig mehr zu verstehen. Blutbefleckte Vergangenheit vermischte sich mit blutbefleckter Gegenwart; Covenanters und Kommerz; eine Stadt der Banken und Bordelle, der Rechtschaffenheit und Rachsucht…Unterwelt und Oberwelt vereint…“
Tobias Gohlis
Ian Rankin: Ein Rest von Schuld (Exit Music, 2007). Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Goldmann: München 2008. 542 Seiten. 19,95 Euro.











