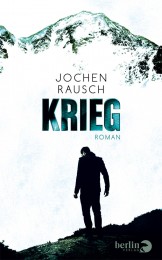 Vom Hindukusch in die österreichischen Alpen
Vom Hindukusch in die österreichischen Alpen
– Es war vorauszusehen, dass der Krieg der Bundeswehr in Afghanistan als Hintergrund oder als Thema auch in deutsche Kriminalliteratur eingehen würde. Jochen Rauschs Roman „Krieg“ ist so ein Fall. Thomas Pöttgen hat ihn gelesen.
In Afghanistan, wo eine Koalition der Willigen Krieg führte, wollte Deutschland gern mit einem humanitären Einsatz am Wiederaufbau mithelfen, ohne so richtig am Krieg beteiligt zu sein. Diese paradoxe Idee hat sich als unhaltbar herausgestellt.
Die Bundeswehr kam zunächst unzulänglich gerüstet für Kampfeinsätze und unzulänglich gewappnet für die Schrecken der asymmetrischen Kriegsführung (wie Hinterhalte, Sprengfallen, Scharfschützen, Selbstmordattentate). Im Jahr 2010 musste der deutsche Verteidigungsminister zwangsläufig ganz offiziell vom „Krieg“ sprechen. Schon 2009 hatte ein deutscher Offizier einen Luftangriff auf Tanklastzüge angeordnet, über 100 Menschen starben in den Explosionen, etliche Zivilisten, darunter Kinder. Auch im 21. Jahrhundert bleibt Krieg eine grauenhafte, schmutzige Angelegenheit. Am 6. Oktober dieses Jahres war der Verteidigungsminister vor Ort, um den Abzug der deutschen Armee nach zehn Jahren offiziell einzuordnen. De Maizière sagte: „Kundus, das ist für uns Deutsche der Ort, an dem die Bundeswehr zum ersten Mal gekämpft hat, lernen musste zu kämpfen.“
54 deutsche Soldaten sind in Afghanistan gestorben, 35 davon „durch Feindeinwirkung“, diese Zahlen umfassen nicht die Kriegsheimkehrer, die auf unbestimmte Zeit an den Traumata leiden werden, und nicht die vielen Angehörigen, die ihren Teil des Leides mittragen müssen. Der Minister sagte weiter: „Das war eine Zäsur, nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für die deutsche Gesellschaft.“
Im Wahlkampf aber schienen sich die Parteien zu bemühen, jegliche Diskussion um die Afghanistan-Politik der Vergangenheit und der Zukunft zu vermeiden. Und der Abzug aus Kundus verursachte nicht viel mehr als ein kurzes Achselzucken in der Medienlandschaft nach einem zehn Jahre dauernden Einsatz, von dem die meisten Menschen wohl nicht recht wissen, was davon zu halten ist.
Stoff und Gründe genug, um daraus spannungsreiche Literatur zu machen. Daran versucht sich „Krieg“ von Jochen Rausch. Der Roman nimmt ganz konkret Bezug auf die deutsch-afghanische Wirklichkeit, und um dies zu unterstreichen ist der „Buchtrailer“ unterlegt mit O-Tönen von Merkel und De Maizière, die sich zu deutschen Gefallenen äußern.
Action
Doch fangen wir vorn an: Anfangs hallen Schüsse und Schreie ‒ nicht ganz greifbar, vielleicht nur eingebildet ‒ durch die beiden Erzählstränge des Buches, und verbinden so, was zu verschiedenen Zeiten spielt und erst später wieder zusammenführt.
Im Hier und Jetzt will der ehemalige Lehrer Arnold Steins ein Stein sein. In knappen Sätzen, geradezu wortkarg erzählt die Geschichte von einem, der den Berg Berg und den Hund Hund nennt, und sich lieber nicht mehr an Namen erinnern will. Arnold versucht sich vor der Welt zurückzuziehen, in eine Berghütte irgendwo in den österreichischen Alpen.
Schon bald erschließt sich dem Leser aus einer Fülle von Rückblenden, dass sein Eremitendasein die Spätphase eines persönlichen und familiären Niedergangs ist, der damit seinen Anfang nahm, dass Sohn Chris ankündigte, in den Krieg ziehen zu wollen, an den Hindukusch. Es ist gut erzählt, wie dem Lehrerehepaar die Argumente fehlen, um ihrem draufgängerischen Sohn die Beteiligung am Kriegseinsatz auszureden. Der nämlich sagt: „Ich bin gegen den Krieg, wie Polizisten gegen Morde, Vergewaltigungen und Einbrüche sind.“
Ohnmacht
Zurückgenommen und diskret erzählt der Roman von der sich schleichend ausbreitenden Ohnmacht und Agonie der Daheimgebliebenen. In seinen stärksten wird in knappen Sätzen nachvollziehbar, wie die Auswirkungen der Kampfhandlungen immer weitere Kreise ziehen, wie über die unmittelbar Beteiligten hinaus Angehörige zu Opfern werden.
Die Eltern kranken am Krieg, es gibt keinen Seelenfrieden mit einem Sohn an der Front, das bürgerliche Glück in der Neubausiedlung mit ihren wohlgemähten Vorgärten gerät ins Rutschen, die heile Welt wird fad und banal.
Denn nachts kommen die Mails von Chris, herbeigesehnt und doch albtraumhaft. Diese Abschnitte in ihrer lapidaren Jugendsprache profitieren vom starken Kontrast zum sonstigen Stil des Romans. In ihrer Unzulänglichkeit stechen die Mails besonders grotesk hervor, Chris wählt schmerzhaft unangemessene Worte für die Agonie des Krieges zwischen gähnender Langeweile und Todesangst, übersteigertem Kameradschaftsgeist, „Jokes“ und Youtube-Videos. Und wenn er in seinem fast kindlichen Duktus von abgerissenen Gliedmaßen berichtet, bekommt die Fratze des Krieges über diesen erzählerischen Umweg eine besonders eindringliche, bizarre Gestalt.
Nur kurz wird ein erzählerischer Bogen zu derjenigen Generation geschlagen, die ganz wesentlich vom Krieg geprägt war, wenn auch nur angedeutet bleibt, wie die Verheerungen dieser Menschheitskatastrophe über Generationen nachwirken konnten. Arnolds Vater ist damals als verängstigter Mann aus dem Zweiten heimgekehrt, unfähig zur Freude und zur Spontaneität. Dieser Vater hat seine Verzagtheit wohl an seinen Sohn weitergegeben, so darf spekuliert werden. Der Enkel wiederholt in seinen Mails formelhaft die Aufforderung, der Mutter zu sagen, alles sei okay. Arnold setzt dies pflichtschuldig um, schwingt sich aus einer falsch verstandenen Beschützerrolle heraus zur hausinternen Zensurbehörde auf und enthält der Mutter alles vermeintlich Belastende ‒ wie fast alles ‒ vor, was neue unheilvolle Auswirkungen zeitigt. Die Steins entfremden sich von ihrem alten Leben und voneinander. Rausch zeigt gekonnt, wie brüchig die Einrichtung des bürgerlichen Lebens werden kann und wie eine scheinbar so abstrakte und ferne Katastrophe in die Mitte der Gesellschaft hineinwirkt. Und der Großteil der Bewohner dieser Mitte schaut eilig weg: Die Kollegen im Lehrerkollegium suchen das Weite, wenn die Rede auf den Krieg kommt.
Es kommt, wie es kommen muss, damit Arnold in der Einöde landet: Chris fällt im Kampfeinsatz. Doch etwa von da ab gibt der Roman jeglichen Wirklichkeitsbezug auf, Rausch lässt das Afghanistan-Thema plötzlich fallen.
Schlecht gemacht
Die Geschichte, die die Geschichte eines konkreten gesellschaftlichen und individuellen Traumas hätte werden können, wird gegen Ende beliebig und unglaubwürdig.
Die Brisanz der diskussionswürdigen Wirklichkeit weicht schlecht gemachter Spannung.
Auf der Erzählebene, die nach und nach die oben beschriebenen Ereignisse rekonstruiert, schreitet die Handlung eher behutsam und nachdenklich voran. Doch die Thriller-Handlung (laut Verlag ist das Buch vornehmlich „ein perfekter Psychothriller“) bleibt unmotiviert und verworren. Ausgerechnet in den Bergen, in denen Arnold Ruhe sucht, treibt ein (bis zuletzt) mysteriöser Schurke sein Unwesen und terrorisiert die Gegend, blindwütig und wahllos (seine Motive und seine Identität werden demonstrativ als unwichtig ignoriert). Arnold beginnt nun überraschend seinerseits, die Eskalation voranzutreiben und die Konfrontation mit dem Fremden zu suchen.
Diese „Thriller“-Ebene bleibt aufgesetzte Hilfskonstruktion, nichts wird aufgelöst, alles Unplausible bleibt unplausibel.
Man weiß nicht recht, ob der Autor den oben beschriebenen Qualitäten seines Buches schlicht misstraut und es als notwendig empfunden hat, dem langsamen Zersetzungsprozess einen schlichten Spannungsbogen bis hin zum direkten Duell entgegenzusetzen. Oder ob es ihm damit wirklich ernst war, dem verstockten, psychisch labilen Helden ausgerechnet in einem Akt der Gewalt zu einer kathartischen Selbstfindung zu verhelfen, die ihn wieder ans Leben anknüpfen lässt – und ihm noch dazu ein erzählerisch völlig unmotiviertes Happy End zu ermöglichen.
Auch der Stil trägt irgendwann nicht mehr. Die angestrengte sprachliche Reduktion – ist das der vermeintlich adäquate Stil für ADSgefährdete Leser der Twittergeneration? –, das Bemühen, nur zu zeigen und kaum etwas zu umschreiben oder zu kommentieren, ist ein probates Mittel, um den Niedergang der Steins ohne emotionales Pathos oder übertriebene Psychologisierung vorzuführen. Der Gefühlsstarre und bockigen Verweigerungshaltung Arnolds lässt sich so aber erzählerisch nur noch wenig abgewinnen, und wenn der wortkarge Mann und sein wehleidiger Hund immer wieder dieselben Verhaltensmuster vollziehen (winseln und tadeln, jaulen und maßregeln, etc.), dann nervt das. Die Poetik der Sparsamkeit wird zu erzählerischer Armut. Auch die unermüdliche Beschreibung der aufgewühlten Natur kontrastiert zwar über weite Strecken Arnolds Verweigerung jeglicher emotionaler Anteilnahme (und illustriert wohlmöglich doch seinen inneren „Sturm“), wird aber zunehmend redundant.
Ungerecht
Die Geschichte wird ihrem ursprünglichen Gegenstand letztlich nicht gerecht. Nein, sogar ungerecht: So lässt sie den Afghanistankrieg zu einem (fragwürdig gewählten) Aufhänger verkommen, um eine krude, spekulative Philosophie anzudeuten. Es drängt sich der Eindruck auf, der Roman versuche letztlich noch auf Biegen und Brechen so wohlfeile Thesen zu illustrieren wie die, das Gewalt nur wieder Gewalt hervorbringt. Oder dass in uns allen, in der conditio humana schicksalhaft verankert, irgendwo das wilde Raubtier schlummert. Es scheint, als streife der vormals diplomatische Lehrer seine kastriert-zivilisierte Existenz ab und entdecke seine Kriegernatur, provoziert den Showdown, um in der finalen Konfrontation sein Selbst aufs Spiel zu setzen und somit erst zu konstituieren, um, im Stahlgewitter wiedergeboren als ganzer Kerl, sofort mit einer austauschbaren Frauenfigur an seiner Seite belohnt zu werden.
Dieser „Krieg“ hat letztlich nichts mehr mit Afghanistan zu tun. Schade eigentlich.
Thomas Pöttgen
Jochen Rausch: Krieg. Roman. Berlin: Berlin Verlag 2013. 224 Seiten. 18,99 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und mehr zum Autor.











