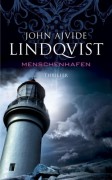 Gothic-Horror in Reinkultur
Gothic-Horror in Reinkultur
Genre-Kombinationen sind zurzeit besonders beliebt. Crime Fiction plus, sozusagen. Heute – plus Gothic … Henrike Heiland macht sich grundsätzliche Gedanken zu Etiketten- und Schwindel und zu John Ajvide Lindqvist.
Etikettierung ist doch ein schönes Thema. Lebensmittel zum Beispiel. Da wollen die Verbraucher alles wissen und die Hersteller nicht immer alles verraten. Gerade sehr im Trend sind Sachen, die gar nicht das sind, wofür sie gehalten werden. Käse und Schinken, allem voran. Es gibt zum Glück immer irgendeine Bundesbehörde oder Verbraucherdingszentrale, die sich darum kümmert. Für die Etikettierung von Büchern gibt’s so was noch nicht. Blöd? Manchmal.
Verlage überlegen sich ja ganz gerne, wie sie, sagen wir mal so als Platzhalter, einen Schinkenkrimi unter die Schinkenkrimiliebhaber bekommen, selbst wenn gar kein echter Schinken drin vorkommt. Aber weil sich Schinkenkrimis gut verkaufen, tun sie so, als hätten sie einen Schinkenkrimi mit – man will ja eine gewisse Wahrheitsnähe schaffen – Käseelementen. Dann hofft man einfach darauf, dass der Leser beim Lesen vor lauter Begeisterung über den Käse den Schinken vergisst. Das kann schon mal schief gehen.
Nicht richtig schief, aber auch nicht wahrhaft rund, lief es ja, als versucht wurde, den höhnischen, bluttriefenden Stuart MacBride als neuen Ian Rankin unters Volk zu streuen. MacBride ist toll, keine Frage, aber eben was ganz anderes als Rankin. Und wer nun mal das eine erwartet und in was ganz anderes reinbeißt …
Horror …
Sollte man den Etikettierungen auf Büchern weniger Glauben schenken? Ganz verzichten ist keine Lösung. Vielleicht mehr zwischen den Etikettenzeilen lesen? Versuchen wir’s. Auf Menschenhafen von John A. Lindqvist steht und klebt schon mal eine ganze Menge. Im Umschlag heißt es über den Autor: „Er schreibt Thriller mit Horrorelementen“, und dann, auf dem Buchrücken: „Auch wenn der Roman die Gestalt eines Schauerromans hat …“ Okay. Klingt ein bisschen nach einer Entschuldigung. Aber es gibt ja noch den Aufkleber vorne. Lindqvist hat mit diesem Buch nämlich den Selma-Lagerlöf-Literaturpreis gewonnen. Wir haben also: Thriller, Horror (Elemente!), Schauerroman (Gestalt!), und Selma Lagerlöf (Nils Holgersson! Nobelpreis!). Und das alles im schwedischen Krimiregal. Fein.
Wer Lindqvist schon kennt, weiß natürlich, wonach er da in Wirklichkeit greift. Der weiß von Vampiren in Stockholm, die mit einem eigentümlichen Selbstverständnis in der schwedischen Hauptstadt unterwegs sind. Blutsaugende Vampire gibt es in Menschenhafen nicht, aber genügend andere Untote, diesmal auf der erfundenen Insel Domarö, irgendwo zwischen den schwedischen Schären. Die Untoten mögen Elemente sein, der Horror hingegen ist ganz klar elementar.
Horror ist am Größten, wenn er in den Alltag eindringt, so oder so ähnlich findet das Stephen King ganz richtig. Die traditionellen gothic novels arbeiteten mit der Gruselkulisse abseits des Alltags. Ebenfalls ganz richtig. Alte Schlösser. Unwirtliche Landschaften. Unbekanntes Zeugs. Spooky. Aus der Taufe gehoben von Walpole, später weitergeführt von Radcliffe, Hoffmann, Poe. Vom erklärbaren Schauer über schlicht Unerklärliches aus der Zwischenwelt bis zu echten Vampiren gibt’s bis heute noch alles. Rice, King, Meyer. Lindqvist steht mitten in dieser sehr breiten und prächtigen Tradition, nutzt deren gut funktionierende Mechanismen und setzt sie in Reinkultur fort. Die gothic novel aber steht im Ansehen irgendwo neben dem Groschenroman. Meyer wird als ein Phänomen abgetan, keusche Vampirgeschichten für unzufriedene Teenager. Die Sparte heißt großzügig „Science Fiction, Fantasy & Horror“ und ist durchaus umsatzrelevant im Buchhandel, aber nicht gesellschaftsrelevant.
Die gothic novel ist nämlich irgendwann abgehängt worden. Weit abgeschlagen durch den mit Logik und Erklärbarkeit winkendem Kriminalroman. An dessen Ende hat jemand aufgeräumt, und alle Rätsel sind gelöst. Ach, und gesellschaftliche Relevanz cum literarischem Niveau hat der Krimi ja auch noch. Im Grunde aber, das wird gerne vergessen, kommt der Kriminalroman aus der gothic novel. Siehe Collins, Poe, Hoffmann. Ist man mal ehrlich, dann will der Mensch etwas über Tod und Entsetzen und Leid lesen. Und da verwundert es doch kaum, dass sich im aktuellen Kriminalroman, nachdem das 20. Jahrhundert eine recht ausgedehnte Blutarmut auf diesem Gebiet verzeichnen konnte, mittlerweile mehr Blut, Gedärm und Angst als auf jedem Schlachthof findet. Die Grenze zwischen Horror und Krimi kann längst nicht mehr bei der expliziten Gewaltdarstellung gezogen werden. Die Grenze ist das Erklärbare, das Greifbare, aber auch da weicht der Krimi die Grenzen auf. Cotterills Ermittler Dr. Siri sieht Geister, und er ist nicht der Einzige, der offene Kanäle in eine andere Welt hat, um Mordfälle zu klären.
… das Meer
Lindqvist hat nun keinen Ermittler, nur einen verzweifelten Vater. Keinen Mordfall, nur ein spurlos verschwundenes Kind. Und dazu jede Menge Unerklärliches. Die Bewohner der Insel Domarö haben ein sehr eigentümliches Verhältnis zum Meer. Oder das Meer hat ein eigentümliches Verhältnis zu den Bewohnern. Einen Pakt scheint es zu geben, in den nicht alle eingeweiht sind. Dabei ist es ein tödlicher Pakt, mit dem sich schon unzählige Generationen gewaltig was ans Bein gebunden haben.
Immer mal wieder verschwinden Menschen. Die Leute auf Domarö reden nicht so sehr drüber. Das Meer hat sie geholt, heißt es vage. Na gut, das passiert, wenn man dauernd auf dem Wasser herumschippert. Es waren sowieso nur die größten Nervensägen, die abgesoffen sind. Good riddance. Aber nun verschwindet die kleine Maja vom Eis. Ihre Fußspuren enden abrupt. Es gibt kein Eisloch, in das sie eingebrochen sein könnte. Dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, kann nicht mehr geleugnet werden, eine natürliche Erklärung, wie kompliziert und unwahrscheinlich sie auch sein mag, gibt es nicht. Ihre Eltern ziehen weg und trennen sich bald darauf. Ihr Vater Anders verfällt einsam dem Alkohol. Bis er nach zwei Jahren zurückkehrt, um mit Maja und diesem ganzen unerklärlichen Mist abzuschließen. Dass er stattdessen nach Maja suchen und mehr als einem Toten aus seiner Vergangenheit begegnen wird, ist erst der Anfang. Sein Stiefgroßvater, der ehemalige Zauberer Simon, spielt dabei die Rolle des Schwellenhüters und natürlich auch des Magiers, der Anders den Schlüssel zu seiner Tochter geben wird. Das Unerklärliche wird zu einem System mit festem Regelwerk, das man als Leser schnell begreift.
Lindqvist versteht den Kunstgriff, den gothic horror zu einem selbstverständlichen Teil dieser Geschichte zu machen, ohne dabei das eigentliche Thema zu banalisieren: den Versuch eines psychisch und bald auch physisch zerstörten Vaters, mit dem sicher scheinenden Tod seiner kleinen Tochter klarzukommen. Er macht daraus eine wirklich große Geschichte über Vaterliebe. Anders muss akzeptieren, dass seine Maja niemals der glückbringende Sonnenschein war, zu dem er sie in den vergangenen Jahren im Geiste gemacht hat. Und erst die Erkenntnis, dass die Kleine ein echtes Teufelchen war – vielleicht sogar ein böser Mensch von der Sorte, wie sie dauernd von Domarö verschwinden – lässt ihn sein wehleidiges Gejammer abschütteln und bereitet den Weg zu Maja auf mehreren Ebenen.
Strukturell ist das Buch manchmal anstrengend, wenn Lindqvist in den Zeiten springt, langwierig zu Gunsten der Atmosphäre und zu Lasten der Story ausholt, oder erzählerisch offen eingreift, indem er erklärt, warum er diese oder jene Szene nun ausführlich darlegen wird oder lieber einfach weglässt. Anstrengend, weil es milde gesagt, gegen die üblichen Lesegewohnheiten geht. Doch vor allem ist es als klares Bekenntnis zur ursprünglichen Form des Geschichtenerzählens zu verstehen: Hier ist der Erzähler der Meister. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers wie ein Zauberer die seiner Zuschauer. Lässt Nebel aufsteigen, zersägt die blonde Frau mit der Motorsäge und befreit sich am Meeresgrund von Ketten.
… und Schweden
Die Atmosphäre auf der Insel ist dabei ungemein reizvoll: Was im ersten Moment wie eine verschworene Jeder-kennt-jeden-Gemeinschaft aussieht, ist in Wahrheit ein kompliziertes Geflecht aus Allianzen, Geheimnissen und Lügen. Angst ist ein weiteres Element, das die Bewohner verbindet. Angst und Wasser. Keine der Figuren kann die volle Sympathie des Lesers auf Dauer behalten, durchaus aber wiedererlangen. Der Horror besteht nicht in herumfliegenden Leichenteilen. Der Horror ist das nicht zu leugnende Wissen, dass es da draußen etwas gibt, was sich nicht an die Gesetze unserer erfahrbaren Welt hält. Etwas, das sich über Leben und Tod und Physik hinwegsetzt. Gleichzeitig aber gibt es Wege, es zu beherrschen. Der Preis dafür ist natürlich hoch. Wer den Zauberstab hat, muss dafür bezahlen. Klassisches Horrorsetting, eigentlich. Und ein anrührendes, spannendes und ungemein unterhaltsames Buch noch dazu.
Und doch steht Menschenhafen einfach so zwischen den Schwedenkrimis. Das ist also der Dank: Erst bereitet die gothic novel dem Krimi einen nahrhaften und immens erfolgreichen Boden, und dann muss sie sich durch die Hintertür wieder reinstehlen, verkleidet und mit Aufklebern und Etiketten als Eintrittskarte. Na gut. Wenigstens findet man so das Buch gleich.
Henrike Heiland
John Ajvide Lindqvist: Menschenhafen (Människohamn, 2008). Roman.
Deutsch von Paul Berf.
Bergisch-Gladbach: Lübbe 2009. 560 Seiten. 14,95 Euro.











