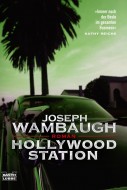 Dummie-Version seiner selbst
Dummie-Version seiner selbst
An jedem Samstag werden wir Sie in Zukunft mit Krimi-Empfehlungen oder -Warnungen versorgen. Heute bespricht Thomas Wörtche „Hollywood Station„ von Joseph Wambaugh.
Als Joseph Wambaugh irgendwann in den späteren 1990ern in einem Interview ankündigte, er wolle sich fortan nur noch dem Golfspielen widmen und keine Romane mehr schreiben, weil er nichts mehr zu sagen habe, konnte man ihn zu diesem Entschluss nur cordialst beglückwünschen. Zu grausam war der Niedergang eines eminent wichtigen amerikanischen Gegenwartsautors anzusehen gewesen; seine letzten beiden Romane Finnegan´s Week und Floaters (der erste auf Deutsch nie erschienen, obwohl aufwendig übersetzt, der letzte als „Wasserpatrouille“ ein peinlicher Flop) waren in dürftige Witzeleien gekleidete Vorurteile eines weißen Multimillionärs, der angesichts einer immer komplexeren Welt um seinen Besitzstand bangte. Ein literarischer Innovator war zum Großbelletristen geworden – ein schwache Prosa produzierendes Klischee, sorry to say.
Erinnern wir uns kurz: Mit The New Centurions („Nachtstreife“) stellte Wambaugh 1970 die cop novel sozusagen vom Ed McBainschen Kopf auf die Beine – das literarische Sujet Verbrechen als unendlichen work-in-progress und nicht mehr als Fall-und-Aufklärung, Polizeiarbeit nicht als detection, sondern als Kette von Frustration, Gewalt und emotionalen Exzess-Situationen; Polizei nicht notwendig als Freund und Helfer oder total korrupte Organisation, sondern als psychopathologische Veranstaltung mit sex `n violence, viel menschlichem Faktor, dialektisch und hochauflösend, verstörend und – in einer späteren Phase seines Werkes – bizarr-komisch. Die Bachtinsche Karnevalisierung war Wambaughs probates ästhetisches Mittel, um die City of Quartz (Mike Davis) oder um La-La-land (R. W. Campbell) und damit Megapolis überhaupt erzählbar zu machen. Wambaugh hatte unendlichen Einfluss auf die Bilder von Polizei und Polizeiarbeit, in allen Medien. Police Story stammt aus seiner Werkstatt, Hill Street Blues und NYPD Blue sind ohne Wambaugh nicht vorstellbar. James Ellroy hat alles von ihm gelernt und ihn noch lange als Rivalen beschimpft, Gary Philipps hat seine Methode explizit politisiert, Michael Connelly hat von Wambaugh gelernt, selbst aktuelle Fernsehserien wie The Shield wären ohne ihn nicht möglich. Nicht zu reden von den Legionen von Ausplünderern, Trittbrettfahrern und Light-version-Produzenten. Kurz: Der Einfluss und die Relevanz von Wambaugh für die cop novel sind überhaupt nicht zu überschätzen. Weil aber die cop novel das erzähltechnische und ästhetische Paradigma der Kriminalliteratur der letzten 35–40 Jahre war (Polyphonie, Multiperspektivismus, Großstadterfahrung, Gewaltdarstellung, ästhetische Montage von slang etc.) und weit über das Genre in Nachbargenres (Cyberpunk etc.) und Non-genre-Literatur (Paul Auster, Tom Wolfe etc.) gewandert ist, gehört Wambaugh zu den entscheidenden Literaten dieser Zeit. Seine starke Rolle als True-crime-Autor (The onion Field; „Tod im Zwiebelfeld“) ist dabei noch gar nicht erwähnt.
Wambaugh hatte seinen Platz in der Literaturgeschichte, im Pantheon oder wie immer man kanonische Begierden und Statuten beschreiben möchte. Es folgten noch ein paar überflüssige Unterhaltungsromane, s. o., 1996/97 dann das glückliche Verstummen.
Langweilige Nummernrevue des Ekligen
Und jetzt, nach über zehn Jahren plötzlich doch ein neuer Roman von ihm: Hollywood Station (ein Sequel: Hollywood Crows erscheint im März in den USA). Auf dem Cover der deutschen Ausgabe steht, „nach mehr als zwanzig Jahren ist dies sein neues Meisterwerk“, wobei ich kaum an die List der Vernunft glauben mag, dass ein Werbespruch so treffend irrt: Sein wirkliches letztes Meisterwerk, The Secrets of Harry Bright („Der Rolls-Royce-Tote“), stammt aus dem Jahr 1983.
Doch ach, Hollywood Station ist kein Meisterwerk, au contraire. Die Übersetzung ist schauderhaft, eine mehr oder weniger genaue 1:1-Übertragung des Wörtersinns, ohne Rhythmus, ohne Gestus, Ton oder Melodie, mit peinlichen Imperativ-Dialogen, als ob es die schlechte Synchronisation einer schlechten amerikanischen Sitcom wäre. Aber sapienti sat – der Verlag wollte einfach kein Geld für dieses Buch ausgeben.
Dennoch, die ganze Aufmachung, das schrecklich unpassende Cover, das alles passt deprimierenderweise zu dem Roman. Si tacuisses … möchte man schreien! Seit 1970 scheint sich wenig getan zu haben in der Ästhetik der cop novel. Wir folgen ein paar Crews der Hollywood Station – also einem Polizeirevier – durch ihren Arbeitsalltag. Streifenpolizisten und Kriminalpolizisten, die allesamt in den USA keine „Beamten“ sind, aber lassen wir das hier. Die Erzählperspektiven nach den Arbeitspartnerschaften der Cops zu strukturieren, war schon immer ein Kompositionsprinzip von Wambaughs Büchern. Wo früher allerdings auch bedenkliche Psychopathen, gewalttätige Irre und andere deviante Gestalten konstitutiv zu diesen Cop-Perspektiven dazugehörten, obwalten heute nur noch milde Exzentriker, durchaus gutartig und höchstens zu manch flegelhaftem Streich aufgelegt. Wo früher Gewalt, Blut, Ekel und andere böse Realitäten schockhaft inszeniert über die Leserschaft hereinbrachen, arbeitet Wambaugh hier deutlich seinen Zettelkasten mit übrig gebliebenen Anekdoten und alltäglichen Unappetitlichkeiten ab, die niemanden mehr schockieren. Nicht, weil man bei der Darstellung von Gewalt, Blut und Tod inzwischen gröbere Kaliber multimedial eintrainiert bekommen hat, sondern weil nach Fäkalien stinkende Obdachlose, siffige Junkies und andere Marginalisierte der Städte keinen großen Provokationswert als „komische“ Figuren mehr haben. Das Eklige ist banal schlimm und auch in L. A. nicht von unerhörter, sondern von globaler Qualität. Mit anderen Worten – Wambaugh langweilt und verdrießt uns, weil seiner Nummernrevue des Ekligen eine dramaturgische Idee, irgendeine erkenntnisfördernde Dimension fehlt. Günstig formuliert.
Perfide historische Revisionismen
Weniger günstig formuliert: Wambaughs andauernde rassistische, sexistische und rundherum reaktionäre Sottisen, die er – natürlich – in die Figurenrede seines Personals einbaut, fügen sich zu einem massiven Stimmungscluster, der durchaus auch die Intention des Autors spürbar werden lässt. Denn ganz ohne Zweifel möchte Wambaugh ein paar perfide historische Revisionismen vornehmen – unter dem abverkäuflichkeitsinduzierten Schlagwort, jetzt aber mal ganz tabulos die Wahrheit und nichts als die Wahrheit (so isses doch!) sagen zu wollen: Die Wahrheit according to Wambaugh ist, dass L. A. völlig „überfremdet“ ist und die am meisten diskriminierte Minderheit der heterosexuelle WASP-Mann. Die Wahrheit according to Wambaugh ist, dass der Rodney-King-Skandal (auf einem Videoband war zu sehen, wie weiße Cops den schwarzen Rodney King völlig unverhältnismäßig zusammenschlugen – ein Dokument des evidenten Rassismus, dessen skandalöse juristische Aufarbeitung zu den Gewaltausbrüchen 1992 führte, die die durch die Reagonomics verursachte, allgemeine gesellschaftspolitische Regression in den USA mit ein paar hundert Toten unübersehbar machten) eine Machination von übelgesinnten Minderheiten war, um die Operationsfähigkeit des L(os) A(ngeles) P(olice) D(epartments) einzuschränken. Wambaugh sieht effektive Polizeiarbeit durch political correctness und Qualitätskontrolle gegängelt und bedroht, ohne die Frage aufkommen zu lassen, ob das traditionellerweise korrupte und rassistische LAPD (als ob Rassismus nur ein Jim-Crow-Crow-Jim-Ding wäre und nicht ganz andere Fronten hätte im pazifischen-mittelamerikanischen Großraum) diese Art von Kontrolle und Führung nicht dringend bräuchte. Wer sich ein bisschen mit der Stadtgeschichte von L. A. (lesen Sie mal wieder Mike Davis!) und natürlich auch mit der Literatur- und Filmgeschichte, ach was, der ganzen Geistesgeschichte des californian noir auskennt, sieht deutlich, dass Wambaugh mit Hollywood Station ein neokonservatives, patriotisches (natürlich verlieren junge Helden ein Bein im Kampf gegen den Terror in Afghanistan, aber nicht die Gesinnung) Pamphlet geschrieben hat. Die am Ende unerträglich schluchzige Hymne auf den Esprit de Corps des LAPD und das Lob der Beglückungen von Polizeiarbeit in einer zwar irren und ekligen, aber im Grunde den Ordnungsprinzipien von Gut und Böse folgenden Welt, sind eine intellektuelle und künstlerische, gar tragische Bankrotterklärung.
Die in die Kette von Vignetten und Anekdoten eingelegte Geschichte von der gutherzigen Junkiebraut, die mit ein wenig Kohle davonkommt, während eine Menge russischer Klein- und Mittelgangster als Leichen enden, ist an Biedersinn kaum zu unterbieten und zudem so deutlich als narrative Krücke angelegt, dass sie den Text als ernstzunehmenden Roman völlig disqualifiziert.
Bleibt die fahle Erkenntnis, dass der späte Wambaugh heute das geworden ist, was man dem frühen und mittleren Wambaugh damals zu Unrecht vorgeworfen hat: A right wing creep. Bleibt weiterhin die fahle (und nicht sonderlich originelle) Erkenntnis, dass ein einst innovatives literarisches Verfahren so ausleiern kann, dass seine meaning of structure keinen Widerstand gegen die abwegigsten ideologischen Besetzungen mehr leistet. Und die noch fahlere Vermutung, dass hierzulande, wo Wambaugh zu seinen brillanten Zeiten ein Marktflop war, er jetzt, sozusagen als Dummie-Version seiner selbst, ein Erfolg werden könnte.
Thomas Wörtche
Joseph Wambaugh: Hollywood Station. (Hollywood Station, 2006) Roman. Ins Deutsche übertragen von Michael Kubiak. Bastei 2008. 431 Seiten. 7,95 Euro.











