
Bloody Chops – schnell, gemein, blutig, wooosh …
Heute am Beil Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW), auf dem Block Kristina Ohlsson: „Himmelschlüssel“, Johann Hari: „Chasing The Scream“ und Heinrich Wandt: „Erotik und Spionage in der Etappe Gent“.
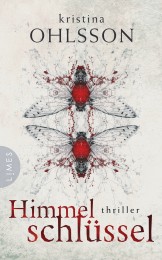 Weiblicher Blick
Weiblicher Blick
(AM) Hier werden wohl manche Fingernägel leiden, auch manikürte. Hat man sich eingerichtet in Kristina Ohlssons „Himmelschlüssel“, gerät man bald in die Lage jener 400 Passagiere, deren schwedisches Flugzeug entführt wurde und in den amerikanischen Kongress gesteuert werden soll, der Copilot, Sohn eines der Ermittler, aus dem Cockpit ausgesperrt, der Pilot keiner Ansprache zugänglich. „Die Geiseln werden sterben“, lautet der letzte Satz des Prologs, der der Handlung vorgreift. Sie währt so lange, wie ein Flieger von Europa nach Nordamerika braucht, so lange wie ein vollgetanktes Flugzeug in der Luft zu bleiben vermag. Denn in den USA landen darf Flug 573 nicht.
Ein in Schweden wegen Terrorverdacht einsitzender arabischer Gefangener soll freigelassen, das bis dahin geheim gehaltene „Tennyson Cottage“, eine „dark site“, ein Foltercamp der Amerikaner in Afghanistan, geschlossen werden, lauten die Forderungen auf dem Zettel, der 20 Minuten nach dem Start in der Bordtoilette gefunden wird. Es gibt die uns vertrauten Hardliner bei FBI und CIA, es gibt einen schwedischen Justizminister, der aus dem Libanon stammt, und an zentraler Stelle zwei schwedische Ermittlerinnen. Die eine, Fredrika Bergman, ist Ohlsson-Leserinnen und Lesern vertraut aus „Aschenputtel“, „Tausendschön“ und „Sterntaler“. Das waren Polizeiromane, dies hier ist ein Thriller – und das Interessante an ihm ist sein weithin weiblicher Blick.
Kristina Ohlsson, Jahrgang 1979, hat im schwedischen Außen- und Verteidigungsministerium, bei der schwedischen Polizeibehörde in Stockholm und als Terrorismusexpertin bei der OSZE in Wien gearbeitet, ist Expertin für Nahostfragen. Ihr Buch ist eine – wie sie betont, fiktionale – Auseinandersetzung mit dem (von uns längst schon wieder vergessenen) Selbstmordattentat in Stockholm vom 11. Dezember 2010. Die Erfahrungen, die die Autorin selbst machte, wollte sie ihrer Protagonistin Fredrika Bergman nicht vorenthalten, schreibt sie im Nachwort. „Die Schweden wussten nicht, was Angst bedeutet“, heißt es in dem in Schweden im Jahr 2012 erschienenen Roman. „Sie glaubten, Angst sei, was man verspüre, wenn das Reisegepäck auf dem Weg in die Kanaren verspätet ankam oder wenn die Strompreise zu steigen drohten.“
Mittlerweile sind wir alle da ein wenig weiter. „Himmelschlüssel“ ist konventionell erzählt, mit viel Blick auf Zusammenhänge und Beziehungen. Die männliche Perspektive sozusagen, ein Undercover-Agent der Amerikaner, liegt vom Copiloten niedergeschlagen im Flieger, während hauptsächlich Frauen den Fall zu lösen haben. Hübsche Variante. Auseinandersetzung mit Terrorismus geht auch so. Das Ende bleibt offen, Kristina Ohlsson hat uns vermutlich noch mehr zu erzählen.
Kristina Ohlsson: Himmelschlüssel (Paradisoffer, 2012). Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann. München: Limes-Verlag 2014. Hardcover. 480 Seiten. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autorin.

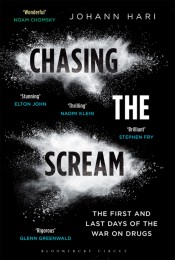 War on Drugs
War on Drugs
(TW) Dies ist eher ein Hinweis, denn eine Besprechung eines der Werke, die man selbst gerne geschrieben hätte und für die man dankbar ist, weil sie einen über Jahre hinweg mit ihrer Materialfülle, ihrem Wissen und ihren Perspektiven bereichern werden: Johann Haris Buch „Chaising the Scream“ – Sachbuch, Mega-Essay, Reportage, egal, wie man es nennen mag – nimmt den realpolitisch fatalen und fiktional sehr fruchtbaren (denken Sie an all die Prohibitionsnarrative von 1919 bis heute) Begriff des „War on Drugs“ auseinander. Er tut dies anhand von dessen Protagonisten, Kombattanten und Nicht-Kombattanten, Tätern und Opfern und Helden.
Wir treffen Harry Anslinger, einer der Köpfe hinter der Idee der „Prohibition“, die sich nicht nur auf den Genuss von Alkohol beschränkt(e). Wir begegnen Arnold Rothstein, „the genius of crime“, wie ihn Jerome Charyn nennt, der im organisierten Verbrechen schlicht eine Geschäftsform sah, egal, womit man handelt, Hauptsache, man tut es professionell. Ein Kernkapitel des Buches geht um Billie Holiday, die Userin par excellence, gehetzt, gejagt und kriminalisiert von Menschen, denen es wie Anslinger um die Durchsetzung ihres Rassismus ging, um die gesellschaftliche Kontrolle über Kreativität und die Durchsetzung rigid puritanischer Moral.
Wir begegnen am Ende einer tour de force durch hundert Jahre blutiger Ideologie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte einem Killer der Zetas (ein inzwischen eigenes mexikanisches Kartell, das sich aus eine legalen Armee-Einheit entwickelt hatte) und am Ende José Mujica, dem seit 2010 amtierenden Präsidenten von Uruguay, der den Anbau von Cannabis legalisiert hat – und mit dieser Entkriminalisierung dem kriminellen Profitstreben einen ersten zaghaften Schlag versetzt hat. Wer sich ein bisschen bei der Fiktionalisierung des Themas auskennt, also seinen Jerome Charyn gelesen hat, seinen Don Winslow, Dennis Lehane (im Gespräch mit AM), Charlie Stella, wer seinen Scorsese, seinen Coppola kennt und „Boardwalk Empire“ (hier auf CM) und … und …, der findet bei Johann Hari die jeweiligen Vorlagen und Fakten. Aber viel wichtiger: Haris Buch ist ein gigantisches Panorama bewusst falschen staatlichen Handelns, basierend auf Ideologie, gefühliger Moralvorstellungen und blankem Zynismus, der die Profite interessierter Kreise extrem ersprießlich hält. Ein sehr politisches, sehr wichtiges Buch.
Johann Hari: Chasing The Scream. The First And Last Days Of The War on Drugs. London/New Dehli/New York/Sydney: Bloomsbury Circus 2015. 389 Seiten. 14,95 Euro. Mehr Informationen zum Buch.

 Unzensiert
Unzensiert
(TW) Vermutlich Stoff für fünfzig historische Politthriller birgt ein Sammelband über das Wirken, Morden, Terrorisieren und Schänden deutscher „Etappenhengste“ im belgischen Gent während des Ersten Weltkriegs. Der von Jörg Schütrumpf kompilierte und kommentierte Band dokumentiert minutiös, wie sich die deutsche Elite verhalten hat – aufgeschrieben eben von einem Deutschen, dem später in die Mühlen der Justiz geratenen Heinrich Wandt, der seine bürgerliche Existenz darüber verloren hat. Ein früher Whistleblower, ein Opfer willfähriger Justiz. Der berühmte Jurist und Politiker Paul Levi (zum Kontext hier) machte den Skandal publik, genutzt hatte es nur in Maßen. In der Weimarer Republik waren die Gent-Papers Bestseller und politische Munition in den Kämpfen der Zeit – das hier benutzte Cover wurde von John Heartfield gestaltet und 1926 sofort verboten, was sich nach 1933 evidenterweise schnell änderte. Wandt konnte nur unter Decknamen weiter arbeiten. 1948 starb er „verarmt und vergessen“, wie die Formel so schön heißt. Ein spannendes Exempel zum Thema Verrat, Loyalität, Patriotismus, Verantwortung und Wahrheit.
Heinrich Wandt: Erotik und Spionage in der Etappe Gent. Deutsche Besatzungsherrschaft in Belgien während des Ersten Weltkrieges. Hrsg. Von Jörn Schütrumpf. Berlin: Karl Dietz Verlag 2014. 366 Seiten. 19,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.












