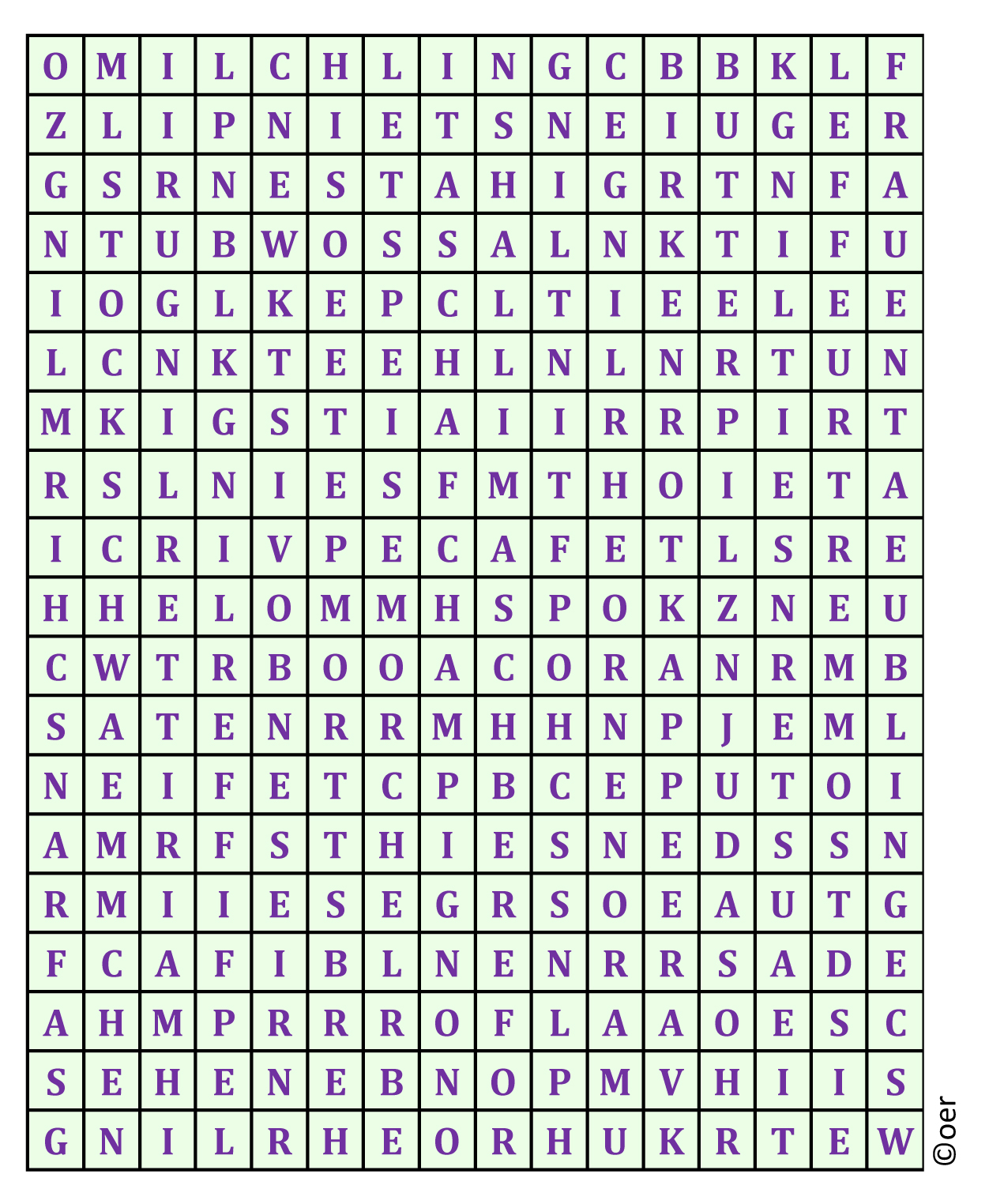Restlos glattgeschliffen
Restlos glattgeschliffen
Das spurlose Verschwinden zweier Schwestern im Jahr 1975 nimmt Laura Lippman zum Anlass, eine eigene Geschichte zu erdenken. Die lässt sich zunächst gut an, mit viel Ruhe und Raum für die Figuren. Doch am Ende versinkt alles in überbordender Harmonie. Kirsten Reimers ist enttäuscht.
Am Ostersamstag des Jahres 1975 verschwinden in einer Shoppingmall in Baltimore die Schwestern Sunny und Heather Bethany. Sie lösen sich regelrecht in Luft auf. Es gibt keinerlei Spuren, keinerlei Hinweise, nichts. 30 Jahre später taucht eine Frau auf, die behauptet Heather zu sein, die jüngere Schwester. Und in der Tat weiß sie Einzelheiten aus dem Leben der Mädchen, die nur einem Familienmitglied oder einer sehr engen Vertrauten bekannt sein können. Aber genauso offensichtlich ist, dass sie lügt und Informationen zurückhält. Sie verfolgt ganz offenbar einen bestimmten Plan.
Laura Lippman hat ihre Geschichte angelehnt an einen wahren Fall aus dem Jahr 1975. Damals verschwanden zwei Mädchen, Schwestern, in der Nähe eines Einkaufszentrums. Von ihnen wurde nie wieder etwas gehört. Damit aber enden die Ähnlichkeiten. Lippman greift diesen Fall auf, um etwas Eigenes daraus zu gestalten.
Viel Geduld mit den Figuren
Die Autorin lässt sich viel Zeit damit, ihre Geschichte zu erzählen – und das ist vielleicht das Beste an diesem Buch. Das eigentliche Geschehen in der Gegenwart umfasst nur wenige Tage und Buchseiten. Die übrigen der rund 400 Seiten sind gefüllt mit Rückblenden. So wird immer wieder ein neues Stück des Tages, an dem die Mädchen verschwanden, aufgerollt – und zwar aus Sicht jedes einzelnen Betroffenen: Je mit Blick auf Sunny, Heather, ihre Mutter Miriam und ihren Vater Dan wird berichtet, wie dieser Tag verlaufen ist.
Weitere Rückblenden berichten aus den vergangenen 30 Jahren, im Fokus jeweils wieder je eine Person. Die Eltern haben sich wenige Jahre nach dem Verschwinden ihrer Töchter getrennt. Dan, der Vater, existiert nur noch für die Erinnerung an seine Kinder. Er ist in Baltimore geblieben, im gleichen Haus, stets umgeben von den Fragmenten des zerstörten Lebens in der Hoffnung, eines Tages kämen Sunny und Heather zurück. Erstarrt in der Vergangenheit, ist er nur noch eine nach außen hin funktionierende Hülle. Miriam hingegen hat sich ein neues Leben aufgebaut, das sie schließlich bis nach Mexiko führt. Wenige Jahre nach dem Verschwinden ihrer Töchter ist sie zu der Überzeugung gelangt, dass beide tot sein müssen, sonst hätten sie sich gemeldet, sonst hätte es längst eine Spur gegeben.
Andere Rückblenden erhellen Teile der Vergangenheit jener Frau, die behauptet, Heather Bethany zu sein. Es sind Ausschnitte einer schrecklichen Jugend: Sie wächst nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, sondern unter falschem Namen in einer Familie, in der sie nur bedingt geduldet wird; Verachtung und sexueller Missbrauch prägen diese Zeit. Schließlich wird sie aus ihrem offenen Gefängnis hinausgestoßen und führt von da an ein Leben mit ebenso oft wechselnden Identitäten wie Jobs.
Wenig Geduld mit den Konflikten
Auf diese Weise steht der vielgestaltige Umgang mit Traumata stärker im Vordergrund als die Krimihandlung: die je unterschiedlichen Versuche Dans, Miriams und der vorgeblichen Heather, mit ihren Verletzungen und Verlusten zurechtzukommen, den Alltag irgendwie zu überleben. Lippmann zeichnet ihre Figuren mit viel Einfühlungsvermögen: Die Langzeitporträts lassen lebendige, sich entwickelnde Charaktere entstehen. Aber auch die Figuren, die nur in der Gegenwart agieren, erhalten eine deutliche Kontur. Von den Ermittlern, die prüfen, ob die Fremde tatsächlich Heather Bethany ist, erfährt man zum Beispiel gerade genug an Eigenheiten, um einen wesenhaften Eindruck zu gewinnen, ohne dass unnötig umständliche Ausflüge in deren Privatleben notwendig sind. Auch der Grund für das Verschwinden der Mädchen ist nachvollziehbar – warum es allerdings 30 Jahre lang keinerlei Spuren gab, ist schon etwas schwieriger zu schlucken.
Überhaupt bricht auf den letzten Metern alles in sich zusammen. Denn am Ende schwappt mit der Beantwortung aller offenen Fragen eine große Harmoniewelle über alles und jeden hinweg und lässt strahlend hell und glänzend eine heile Welt zurück. Alles, was stören könnte, wird in einem Schwung weggewaschen, so dass Figuren, deren Ecken und Kanten zuvor mit Sorgfalt herausgemeißelt worden waren, am Ende glattgeschliffen glücklich Happyend spielen können. Nichts, was nicht durch ein einfaches Gespräch und schlichte Liebe zu bereinigen wäre – dabei hat sich die Autorin zuvor so viel Mühe gegeben, zu zeigen, was permanente Gewalterfahrungen oder das stete Verbergen eines Teils der Persönlichkeit aus einem Menschen machen können. So spült die Harmoniewelle den sorgsam gebastelten Unterbau einfach weg und hinterlässt nichts als Kitsch.
Kirsten Reimers
Laura Lippman: Was die Toten wissen (What the Dead Know, 2007). Roman.
Deutsch von Mo Zuber.
München: Goldmann 2009. 410 Seiten. 8,95 Euro.