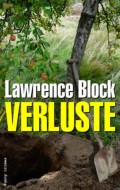 Lakonische Wort- und Blutschwalle
Lakonische Wort- und Blutschwalle
Mit zehnjähriger Verspätung bringt die nette, kleine Funny-Crimes-Edition im netten, kleinen Shayol Verlag einen weiteren Roman aus der Matt-Scudder-Serie von Lawrence Block. Von Thomas Wörtche
Nach zehn Jahren Markt-Abstinenz ist ein Autor in unseren schnelldrehenden Zeiten bei Buchhandel und Kritik vergessen. Nur bei ein paar treuen, unverdrossenen Fans nicht. Treue, unverdrossene Leser zu haben, ist für einen Schriftsteller eine wunderbare Erfahrung und, wenn er ein ernsthafter Schriftsteller ist, sozusagen die literarische Existenzbegründung.
Treuen, unverdrossenen Fans und ihrem zuweilen putzigen Treiben wohnt aber auch ein manchmal fatales dialektisches Moment inne: Sie können aus der Position der beleidigten Leberwurst um einen Autor herum eine Atmosphäre der Hermetik verbreiten. Eine ungute Aura des von der bösen Welt, den bösen Kritikern, den bösen Verlagen, den bösen, bösen anderen Lesern und dem ganz bösen Nicht-Fan Zu-Unrecht-Negierten – eine Loser-Aura, die ein größeres Publikum beinahe magisch abstößt. Vor allem, und dies ist Block widerfahren, wenn solch unbedarftes Fandom sich auch noch in einem Devotionalien-Band niederschlägt, der alles tut, um ein breites Publikum abzustoßen: dass heißt dem jede intellektuelle, argumentatorische und konzeptionelle Kapazität abgeht, um das Werk des geschändeten Lieblings lecker und begehrenswert zu machen. Das einschlägige Lawrence-Block-Fanbuch, das sich im Untertitel ohne jede Ironie „Werkschau“ nennt, gilt inzwischen als Lehrbeispiel dafür, wie man einem Autor mit prekären Verkaufszahlen endgültig den Garaus macht und wie man Sekundärliteratur zum Genre garantiert nie anlegen darf. Das nur nebenbei und auch angemessen relational gesehen – denn was in dieser „Werkschau“ steht, ist sowieso egal, denn höchstens drei oder vier Texte auf über 300 Seiten sind überhaupt brauchbar.
Eine große Gestalt der amerikanischen Gegenwartsliteratur
Anyway, die 15 Romane – auf Deutsch liegen sie bei weitem nicht alle vor, schon gar nicht in adäquater Form – um den Privatdetektiv Matt Scudder aus NYC, der einst Cop war, angetrunken versehentlich ein Kind im Dienst erschossen, dann einen Entzug hinter sich gebracht hat und heute mit seiner langen Liebe Elaine verheiratet zusammenlebt, den wir also seit seinem ersten Auftritt in The Sins of the Fathers (dt: Mord unter vier Augen) nunmehr seit über 30 Jahren kennen und verfolgen, sind nämlich alles andere als bleischwere Minderheiten-Literatur.
Im Gegenteil: Überall auf der Welt ist Lawrence Block als das bekannt, was er ist: Eine der großen Gestalten der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Neben anderen Serien (die um den Meisterdieb Bernie Rhodenbarr etwa oder die um Evan Tanner – irgendwo zwischen Abenteuerroman und Polit-Thriller angesiedelt – oder die um Keller, den netten Profi-Killer von nebenan) zeichnen sich die Scudder-Romane durch einen ganz bestimmten Gestus, durch einen Erzählton, durch einen Rhythmus aus. Dies alles korrespondiert präzise mit dem ästhetischen Grundentwurf, nämlich mit der ausschweifenden Rhetorik, die letztlich die blanke Lakonie kommuniziert.
Paradox? Ja! Genauso paradox und verwirrend wie alle Sujets und Themen, die vermittels dieser irren Rhetorik verhandelt werden. Hier in Everybody dies (der deutsche Titel Verluste ist mir viel zu metaphysisch, zu uncool) geht es um Scudders besten Freund Mick Ballou. Der ist ein irischer Gangster, mit Metzgerschürze, Hackebeilchen und einem abgeschlagenen Kopf in der Sporttasche ausgestattet, ein literarischer Verwandter des legendären Butcher Bill (den wir wiederum u. a. aus Martin Scorseses grandios-gescheiterten Gangs of New York kennen), weil er wie der historische Bill Poole ein benevolenter Virtuose des Verstümmelns ist, voll mit irisch-nationalen Ressentiments und rassistisch bis xenophob, aber dennoch ein netter Kerl. Dieser Kumpel auf jeden Fall gerät in eine Vendetta und Scudder mit hinein. Die ersten Toten fallen an, darunter auch ein alter Bekannter aus dem Scudder-Universum. Jetzt setzt die in langen Dialogen inszenierte Rhetorik der Problemfelder ein, mit allen noblen, hohen Dingen: Schuld und Sühne, Gerechtigkeit, Freundschaft und Loyalität, Verrat und Mord.
Alle Modalitäten der zwischenmenschlichen Beziehungen werden an- und ausdiskutiert, betont herrschaftsfrei, fast als Karikatur der politischen Korrektheit – schön, dass man mal darüber gesprochen hat. Dabei ist allen Beteiligten und auch dem Lesepublikum eines völlig klar: Scudder und Ballou müssen töten und ausrotten gehen, und mindestens einen Verräter gibt es auch. Also töten Scudder und Ballou inmitten der Wortschwalle, zielstrebig, entschlossen, effektiv, grausam, beiläufig. Ganz und gar lakonisch.
Komplex und unterhaltsam
Natürlich ist der Roman keineswegs auf eine solche billige Pointe hingeschrieben. Er und sämtliche Scudder-Romane machen nämlich etwas sehr viel Wirkungsvolleres – sie rücken die Bezugsparameter der Wirklichkeit, die wir alle kennen, einfach um ein paar Millimeter beiseite. Das wunderbar genau geschilderte NYC, das Matt Scudder in der guten, alten Flaneur-Tradition zu Fuß ergeht (wer will, darf jetzt Franz Hessel! oder Walter Benjamin! schreien) mit seinen konkreten „Realitäten“ aus Medien, Sport, Politik und anderen rekonstruierbaren Gegebenheiten, ist bei Block auch ein Ort erheblich differenter moralischer Positionen. Die werden nicht diskutiert. Die sind da. Nach ihnen wird gelebt und gehandelt. Sie sind jedoch keinesfalls mit offiziellen Werten und Positionen in Deckung zu bringen. Auch Prämissen werden bei Block nicht diskutiert, sie sind ihrerseits keineswegs an die offiziellen Wertungen und Einschätzungen gebunden: Ein Zuhälter kann (muss aber nicht) ein guter Mensch sein, desgleichen ein Dealer, ein Mörder und Räuber. Gerechtigkeit ist nicht gesellschaftlich herstellbar, ist noch nicht einmal ein absoluter Wert. Auf freundlich parlierende Weise schaffen Blocks Figuren die Universalie „Du sollst nicht töten“ zwar nicht ab, definieren sie aber jeweils neu, beinahe kasuistisch, und reagieren dabei im kleinen, zwischenmenschlichen Bereich auf ein Jahrhundert, dessen Leitsysteme (Ideologien) diese Universalie viel radikaler abgeschafft haben und täglich abschaffen, ohne sie auch nur ansatzweise kasuistisch zu diskutieren.
Nun, am Ende des Romans, der ein paar nette, schaurige Gewaltsausbrüche enthält, ist die Welt wieder bereinigt (nicht: ge-reinigt) – mit Blut gewaschen, könnte man sagen. Und darin sowie in dem Umgang mit den hohen Werten der offiziellen Zivilisation steckt eine stille Ironie, ein komischer Grimm oder eine grimmige Komik – auf jeden Fall ein bei aller Komplexion sehr unterhaltsamer und extrem vergnüglicher Roman.
Hoffen wir, dass Lawrence Block mit diesem Buch bei uns aus der Ecke des hermetischen Fandoms herauskommt. Vom Zuschnitt seiner Romane lässt er sowieso die notorischen Feuilleton-Lurche, die Austers & Co. unserer Tage hinter sich. Wir müssen uns nur allmählich daran gewöhnen, dass dergleichen in Kriminalromanen stattfindet.
Thomas Wörtche
Lawrence Block: Verluste (Everybody dies, 1998). Roman. Deutsch von Katrin Mrugalla. Funny Crimes bei Shayol 2008. 296 Seiten. 14,90 Euro.











