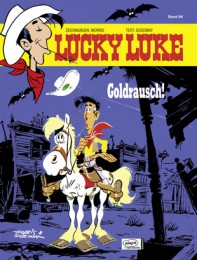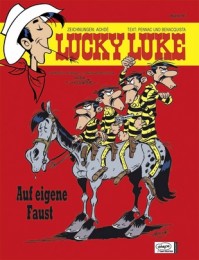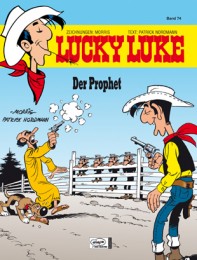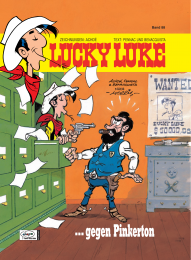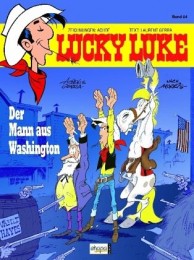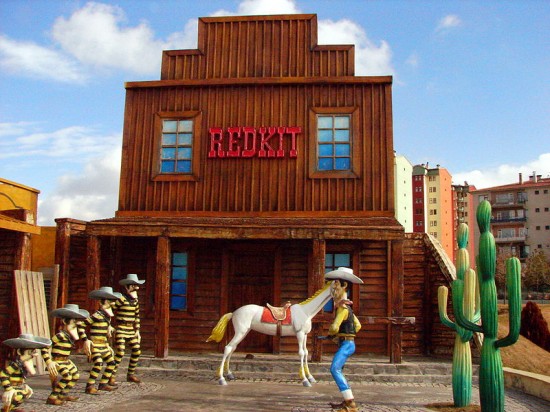
Lucky Luke
oder eine kleine Aufklärungslektüre in der Kunst des modernen Verbrechens
Von Markus Pohlmeyer
Die „Lucky Luke“-Reihe bietet humorvolle Einblicke in die Welt des Wilden Westens (weit entfernt vom realistischen Elend, von der nackten Gewalt, der blanken Gier und von einer bisweilen nur auf Fuck reduzierten Sprache der Western-Serie „Deadwood“). Manchmal erfahren wir Leser, wie bestimmte Mythen des Westens entstanden sind. Es wird eine Art popkulturelle Aitiologie (das sind Welterklärungsgeschichten: Wo kommen die Babies her? Also, da gibt es Blumen und Bienen … bzw. postmodern: Da war einmal ein Genlabor!) oder auch Mythenrelecture geboten. So sei beispielsweise aus den Ereignissen um eine Goldgräbergeisterstadt letztlich das heutige Gold Hill entstanden, prognostiziert auf der letzten Seite von Lucky Luke in „Goldrausch!“ (Band 64), und ein allwissenden Erzähler wird uns das auch bestätigen.
Jesse James, Billy the Kid, das Problem von Stacheldraht auf der Prärie, Indianer (welche die gängigen Vorurteilen widerlegend oft grammatikalisch perfekt die Sprache der Weißen beherrschen), Trapper, Saloonschlägereien, Greenhorns, Eisenbahn und Telegraphen – ein kleines Comic-Universum mit vielen humorvoll-ironisch gebrochenen Einblicken in die Geschichte der im Entstehen begriffenen USA.
Lucky Luke ist der letzte Held und Gentleman-Cowboy: arm, einsam, mit einem Lied auf den Lippen in den Sonnenuntergang reitend. Lucky Luke könnte im Sinne von Jorge Luis Borges durchaus episch genannt werden: „[… D]as Wichtigste am Epos [ist] ein Held […] – ein Mensch als Muster für alle Menschen. Der Kern der meisten Romane dagegen ist […] das Zerfallen eines Menschen, die Degeneration eines Charakters.“[1] Aber Lucky Luke scheint wie der Held einer untergehenden Ära zu sein. Der Wilde Westen war auch gleichzeitig das Goldene Zeitalter, so die idealisierende Fiktion. Der statische Held Lucky Luke durchläuft keine Entwicklung und bleibt im Grunde, obwohl er immer gegen die Bösen siegt, dem Bösen in seinen vielen genialen wie banal-lächerlichen Varianten unterlegen. Das Böse ist nämlich anpassungsfähig – und damit roman- und modernefähiger als ein epischer Held.
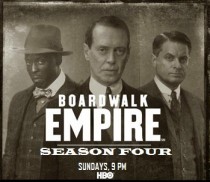 Die Daltons
Die Daltons
Lucky Lukes Gegenspieler: die Daltons, die ewig Unverbesserlichen, die grandiosen Verbrecherdilettanten, überfallen eine Bank, werden von Lucky Luke gefasst, brechen (bisweilen bombastisch) wieder aus dem Knast aus, werden von Lucky Luke wieder einkassiert usw. ad infinitum; eine ewige Wiederkehr des Gleichen (das wäre z. B. eine mögliche Definition von Mythos).
In Band 90 aber, mit dem Titel „Auf eigene Faust“ (2013), werden die vier Brüder modern. Auftakt des Dramas: Sie zerstreiten sich über die Führung der Bande, die Joe, der Kleinste, bisher innehatte, und splitten sich auf; wer eine Millionen Dollar als Erster zusammenbringe, so Joes Vorschlag, werde der neue Boss. Joe geht den traditionellen Weg, indem er eine Bank nach der anderen in solider Handarbeit überfällt.
William gewinnt ein Casino, das nun Tag und Nacht geöffnet sein soll, damit es mehr Profit abwerfe. Und der Whiskey müsse darum auch mit Wasser verdünnt werden (S. 18) – ein Vorausblick auf die Prohibition und die Serie „Boardwalk Empire“. Moralisch-religiöses Gutmenschtum als Katalysator, eine ganze Gesellschaft zu kriminalisieren: „Und so wächst die Alkoholindustrie allmählich zum drittgrößten Wirtschaftszweig der USA heran.“[2] Der Gangster mutiert zur Ikone der Popkultur;[3] hier scheint Borges’ Definition umgekehrt zu werden, denn Al Capone z. B. stilisierte sich als Muster (Mythos). Im Grunde hat sich ein Riss via Medialität etabliert: Es entsteht auf der einen Seite etwas Episches (Mythisches), realiter (historisch) bleibt aber auf der anderen Seite das Romanhafte: nämlich die Geschichte einer Degeneration. „Und es ist kein Zufall, dass der Mythos des Gangsters gerade zu einem Zeitpunkt aufblüht, als die Konsumgesellschaft ihre ersten Triumphe feiert; als Zeitschriften und Werbung, die Idee, man könne gelungenes Leben kaufen, verstärkt in die Köpfe hämmern […]. Wie niemand sonst verkörpern die Gangster die Aufstiegsfantasien des American dream – und die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, die nötig sind, sie wahr werden zu lassen.“[4]
Milliarden und Millionen
Jack entführt einen Milliardär; die Dialoge zwischen den beiden sind witzig bis zum Zynismus und für Jack ernüchternd zugleich. Auf seinen Erpressungsversuch reagiert der Reiche gelassen: „Sie spekulieren auf die falschen Werte: Mitleid und Erbarmen. Von meinen Aktionären macht keiner auch nur einen Cent für meine Wenigkeit locker.“ „Weder Panzerschränke noch Dollars! Alles an der Börse investiert.“[5] „Nur Aktionäre, die mich am liebsten tot sähen. […]“[6] Moral ist hier komplett durchökonomisiert: Mitleid und Erbarmen sind nun Werte, bei denen man sich verspekulieren kann. Der gute, alte Dollar mutiert zur Fiktionenwelt der Aktien und hebt sein irdisches, konkretes Dasein auf. Um aber an die Millionen zu kommen, schlägt nun der Milliardär vor, Jack möge in die Politik gehen. Die Wahl werde erfolgreich verlaufen: „Wir haben alle Wähler bestochen, der Opposition das Maul gestopft und unseren Gegner verleumdet … Das alles im Namen der Freiheit …“[7]
Und der neu gewählte Bürgermeister Jack erweist sich als erkenntlich – im Gegenzug für die Dollars: „Gut. Ich hab also die Steuerhöhung unterschrieben, den Erlass zum freien Waffenbesitz, die Bohrgenehmigung für ihre Erdölgesellschaft und die Erlaubnis, den Fluss umzuleiten.“[8] Rückübersetzt: Plünderung der Wähler, Förderung der Waffenindustrie und ökologischer Raubbau, alles legal. Das bedarf keines weiteren Kommentars. Lucky Luke will nun Jack festnehmen; aber dieser hat sich eine eigne (legale) Selbstbegnadigung ausgestellt, so dass nun Lucky Luke mit seinem Pferd Jolly vor der Justiz (grammatisch gut gemacht im Text:) der Daltons[9] fliehen muss. Dieser Genitivus possessivus signalisiert, dass Justiz immer jemandem gehört – und auch die Definitionsmacht, wer denn zu den Guten, wer zu den Bösen gehöre.
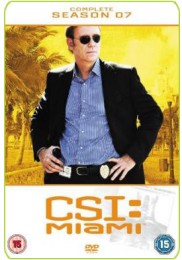 Die Gründung der Mafia
Die Gründung der Mafia
Und Averell, der Größte von den vieren, der immer Hungrige, der nie Satte, geht konsequent einem italienischen Koch zur Hilfe und entwickelt erfolgreich Pizza-Variationen, einen Schnellimbiss und Lieferservice (auch in den Knast) und wird somit zum Initiator der Mafia. Natürlich verliefen die historischen Entwicklungen anders. Aber eine solche ironische Brechung innerhalb eines bekannten Handlungsmuster (Lucky Luke schnappt entflohene Banditen usw.) als Versuch, die Genese verschiedener Phänomene des Bösen en miniature zu illustrieren, richtet die Scheinwerfer, besser die Aufmerksamkeit der Leser, auf die externen Kontexte, weil sie in den narrativen Duktus der immanenten Mikrowelt des Comics integriert sind:
Es existiert schon – oder ist im Werden begriffen – eine Gesellschaft, deren Strukturen, weiß man sie nur zu manipulieren, durch und durch korrumpierbar sind und deren kriminelles Potenzial immens ist. Der Comic mag zwar immanent und Leser beruhigend mit Gut-besiegt-Böse enden, aber es steht fest: Die Metaphysik des Textes sagt nämlich etwas anderes, und zwar spiegelverkehrt; der Comic signalisiert das Ideale, aber sein meta-physischer Überbau das Reale: Die Monster lauern da draußen, neben an,[10] auf uns. Und das Bittere, es lohnt sich; ein Beispiel aus den USA: „Einer Schätzung zufolge übersteigt das Gesamtvermögen des Mafia-Kartells in den 1950er Jahren bereits das der 500 erfolgreichsten Unternehmen des Landes zusammen.“[11]
Der maskierte Bandit
Der kleine Western-Cosmos – guter Cowboy vs. böse Jungs – bleibt für uns Alltagsmenschen überschaubar. Aber die bösen Jungs durlaufen eine Art Initiationsritus; für sie war früher eine Bank auszurauben eben solide Handarbeit, während sie erst von Aktionären, italienischen Pizzabäckern oder in einem Casino lernen müssen, wie die neuen Formen von Kriminalität in Wirtschaft (z. B. via Aktien) und Politik (z. B. via manipulierte Wahlen) funktionieren. Absurd, wie Lucky Luke vor dem Gesetz flieht, hinter dem sich nun die neuen Verbrecher verstecken. Absurd, wie er sich als maskierter Bandit verkleiden wird, um die Daltons unerkannt auszurauben und schließlich auszutricksen. Absurd, dass er Familienwerte wie Brüderlichkeit ins Spiel bringen muss, um die Daltons vor sich selbst zu retten, die wild auf einander losballern.
Das Böse ist nicht mehr ein Kampf da draußen, auf der Prärie; es wohnt, um die Evangelien zu paraphrasieren, schon längst mitten unter uns (und nicht das Reich Gottes – oder ähnlich naive Wahlversprechen). Während Dr. Narcisse in „Boardwalk Empire“ (Staffel 4) barock-verschlungen, unerträglich süßlich und hochmotiviert dämonisch-psychopathisch aus dem Neuen Testament zitiert, um sein narcisstisches Ego zu streicheln, baut er in seinem Territorium den Handel mit Heroin aus – und schickt seine farbigen Brüder, denen er das gelobte Land verheißt, in die Hölle der Abhängigkeit. Eine steile Karriere zu Gott eben über Leichen. Sein Gegenspieler, der farbige Mr. White, kommentiert lakonisch: Dr. Narcisse sei eben auch nur ein Nigger – mit Wörterbuch. Postmoderne Daltons hätten viel dazuzulernen: Drogen, Internetkriminalität und global agierende Netzwerke, sowohl real als auch virtuell.
Der normale Grusel
„Lucky Luke“ wurde mit der Zeit immer gesellschaftskritischer, bisweilen fast satirisch. Lucky Luke: „Der Prophet“ (Band 74) thematisiert explizit den Zusammenhang von religiösem Wahnsinn und Verbrechen. Lucky Luke: „… gegen Pinkerton“ (Band 88) zeichnet die Dystopie eines unkontrollierten Überwachungsstaates. Die Pinkertons benutzen moderne Methoden der Kriminalitätsbekämpfung. (Ein Vorfahre? von) Horatio Caine (aus „CSI: Miami“) ist z. B. bei einem Mitarbeiter mit Reagenzgläsern zu sehen (im Heft S. 12). Aber auch diese zunehmende Technisierung ist vor Missbrauch keinesfalls sicher – und was vor Verbrechern schützen soll, schlägt in Verbrechen um. Und in Lucky Luke: „Der Mann aus Washington“ (Band 84) versucht ein Präsidentschaftskandidat (der aussieht wie ein global bekannter Präsident) der jüngeren Gegenwart und dessen Vater im Ölgeschäft reich geworden sei), mit allen unlauteren Mitteln seinen Konkurrenten Hayes aus dem Weg zu räumen.
Es gibt Verbrechen und legalisierte Verbrechen – und geduldete: „Nein, wir müssen uns nicht über jeden dahergelaufenen Skandal wundern, wenn er gerade mal platzt – Konzerne und Staatskonzerne, die ihre Mitarbeiter abhören und bespitzeln oder so. Nein, wir gehen davon aus, dass Insidergeschäfte an der Börse, die Millionen von Existenzen ruinieren, systemisch normal sind. Nein, wir wissen schon, dass Rohstoffkriege uns als ‚Stammesfehden‘ in unseren Leitmedien verkauft werden.“[12] Also keine megabösen Aliens oder durchgeknallte, atommutierte Wissenschaftler oder Supercomputer, die uns abschalten möchten, sondern nur ein „Gruselkatalog des völlig normalen Lebens auf diesem Planeten“[13]. Lucky Luke lässt uns in dem alternativen Leben des Comics aufatmen, er fängt die Daltons wieder ein. Die kosmische Ordnung ist wieder aufgerichtet – aber Halt!, was die drei Ganoven (Joe ausgenommen) in Gang gesetzt haben oder vorfanden: es bleibt. Mir scheint, mit einem Hauch von Melancholie stellt Lucky Luke fest: „Im Grunde ist Joe eine ehrliche Haut!“ „Er ist der Ansicht, nur Geld zu verdienen, das er höchstpersönlich gestohlen hat.“[14]
Markus Pohlmeyer
Hinweise
Aufmacherbild: Harikalar Diyari RedKit 05983 nevit/wikimedia commons
Ein Überblick über die bisher erschienenen Lucky Lukes findet sich unter: www.ehapa-shop.de.
Sehr empfehlenswert: Boardwalk Empire. Die komplette vierte Staffel, © 2014 Home Box Office
- [1] J. L. Borges: Das Handwerk des Dichters, übers. v. G. Haefs, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2013, 40.
- [2] J.-U. Albig: Al Capone. Karriere eines Gangsters, in: GEO Epoche Nr. 48: Mafia. Die Geschichte des Organisierten Verbrechens, 32-45, hier 37.
- [3] Sehr gut dargestellt in Albig: Capone (s. Anm. 2).
- [4] Albig: Capone (s. Anm. 2), hier 35.
- [5] Beide Zitate S. 17. Der Schrifttyp des Originals wurde um einer besseren Lesbarkeit willen geändert.
- [6] S. 18.
- [7] S. 19.
- [8] S. 21.
- [9] Vgl. dazu S. 22.
- [10] Eine Variation des Buchtitels von T. Wörtche (s. Anm. 12).
- [11] R. Berhorst: Die Mord GmbH, in: GEO Epoche Nr. 48: Mafia. Die Geschichte des Organisierten Verbrechens, 58-68, hier 68.
- [12] T. Wörtche: Das Mörderische neben dem Leben. Ein Wegbegleiter durch die Welt der Kriminalliteratur, Libelle Verlag 2008, 15.
- [13] Wörtche, Leben (s. Anm. 12), 16.
- [14] S. 37.