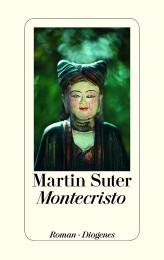 Viel Rauch um nichts
Viel Rauch um nichts
– Martin Suters Roman „Montecristo“ über Banken und Paranoia bleibt letztlich biss- und zahnlos. Eine Besprechung von Susanna Mende.
Ich beginne mit dem Buchtitel: „Montecristo“ ist, jedenfalls in dieser Schreibweise, eine kubanische Zigarre, und Zigarren sind ein männliches Statussymbol für Wohlstand und Genussfreude, die eine gewisse Kultiviertheit suggerieren. „Montecristo“ erinnert aber auch an den Abenteuerroman „Der Graf von Monte Christo“ von Alexandre Dumas.
In Suters Roman spielt der Abenteuerroman als Inspirationsquelle für einen Film eine Rolle, die Zigarre bleibt allerdings ungenannt, wenn auch das Milieu, in dem diese üblicherweise konsumiert wird, eine zentrale Rolle spielt. In Falle des Romans geht es, genau gesagt, um Banken. Und Banken werden natürlich dann besonders interessant, wenn, wie seit 2008 in Variation vorgeführt, große Gewinne oder Verluste gemacht werden.
Suter greift auch in „Montecristo“ zu seiner bevorzugten Strategie, einen eher biederen Helden durch völlig unerwartete Ereignisse aus der Normalität zu reißen und mit sezierendem Blick dessen wechselnde Befindlichkeiten bei seinem oft sinnlosen Kampf zu beschreiben. So viel sei vorweggenommen: Das Sezierende fehlt in diesem Roman größtenteils, was bei der komplexen Handlung vielleicht auch gar nicht zu meistern gewesen wäre und den spezifischen Suter-Sound leider ein wenig missen lässt.
Biederer Held ist also Jonas Brand, freischaffender Videojournalist, der eigentlich mit professioneller Routine agiert, als er nach dem kreischenden Halt eines Intercity nach Basel, der einem Toten auf dem Gleis geschuldet ist, die Situation filmt und Fahrgäste zu dem Vorgang befragt.
 Als er kurz darauf zufällig feststellt, dass zwei Hundertfrankenscheine in seinem Besitz die gleiche Seriennummer haben, ist kein Zusammenhang mit dem Vorfall im Zug erkennbar. Und auch das Rätsel der gleichen Seriennummern scheint sich in Wohlgefallen aufzulösen, als dieses nach Prüfung bei seiner Bankfiliale zum Kuriosum und die Geldscheine zu „Sammlerstücken“ erklärt werden.
Als er kurz darauf zufällig feststellt, dass zwei Hundertfrankenscheine in seinem Besitz die gleiche Seriennummer haben, ist kein Zusammenhang mit dem Vorfall im Zug erkennbar. Und auch das Rätsel der gleichen Seriennummern scheint sich in Wohlgefallen aufzulösen, als dieses nach Prüfung bei seiner Bankfiliale zum Kuriosum und die Geldscheine zu „Sammlerstücken“ erklärt werden.
Erst ein Einbruch in Brands Wohnung und wenig später ein nächtlicher Überfall auf der Straße legen nahe, dass irgendetwas Seltsames vor sich geht. Als Brand dann mit seinem übergewichtigen, depressiven Freund Max Gantmann, einem versierten Wirtschaftsjournalisten, über die Seriennummern spricht, wird klar, dass seine wohlverwahrten „Sammlerstücke“ womöglich größere Sprengkraft besitzen als angenommen.
Paranoia
Dieser Auftakt legt geradezu nahe, dass Brand bei weiteren Recherchen natürlich auf viel größere Zusammenhänge stößt, die sowohl seine Bank als auch eine Sicherheitsdruckerei, in der nicht nur die Schweiz, sondern auch andere Staaten ihr Geld drucken lassen, mit einschließt.
Suter schafft somit eine wunderbare Paranoia-Situation, bei der, aufgefächert in verschiedene Handlungsstränge, sein Protagonist jedes Mal in neue Bedrängnis gerät und sich der wachsenden Bedrohung bewusst wird, die mit dem auf den ersten Blick harmlosen Besitz zweier Banknoten mit identischer Seriennummer beginnt, jedoch einen riesigen Eisberg in Form finanzieller Machenschaften auf höchster Banken- und Staatsebene ahnen lässt.

Autor Martin Suter (Foto: © Alberto Venzago, Quelle: Diogenes Verlag)
Seifenblasen nicht zu verkaufen
Allerdings gelingt es Suter nicht, die Spannung, wie man es bei Paranoia eigentlich erwartet, aufrecht zu erhalten und zu steigern, weil ein Teil der seltsamen und bedrohlich wirkenden Vorfälle in manchmal fast naiver Weise zwischendurch aufgeklärt werden und der Eindruck einer gewissen erzählerischen Kurzatmigkeit entsteht. Suter gleicht das zwar scheinbar aus, indem er immer neue Figuren einführt und damit auch neue Handlungsstränge beginnt, die nach und nach zu den Strippenziehern hinführen, gleichzeitig wirkt das Ganze jedoch ziemlich konstruiert und verliert zunehmend an Plausibilität.
Vor allem gilt das für den Schluss der Geschichte, der nicht nur unglaubwürdig, sondern geradezu ärgerlich ist, weil es dem bedrohten und durch mehrere Todesfälle erschütterten Protagonisten zwar gelingt, die Wahrheit herauszufinden, diese jedoch ohne irgendwelche Konsequenzen für die Täter bleibt, mit denen der gebeutelte Held auf einmal höchst einvernehmlich zu dem Schluss kommt, dass nur so das große Ganze zu retten ist. Diese freiwillige Bereitschaft zu augenzwinkernder Harmlosigkeit ist einfach enttäuschend und in Anbetracht des brisanten Themas geradezu opportunistisch.
Susanna Mende
Martin Suter: Montecristo. Roman. Zürich: Diogenes 2015. 310 Seiten. 22,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.
Mehr zu Susanna Mende.











