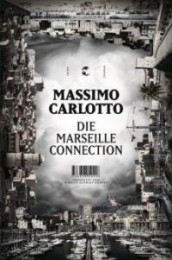 Ödes Schwarz in Schwarz
Ödes Schwarz in Schwarz
– Marseille ist die Stadt von Jean-Claude Izzos gleichnamiger Trilogie (mehr hier) und dieses Jahrhundertwerk der (Kriminal-) Literatur setzt immer noch den Maßstab, wie man literarisch mit dieser faszinierenden Hafenstadt am Mittelmeer umgehen kann. Oft kopiert und nie erreicht, sozusagen. Auch Massimo Carlottos „Die Marseille Connection“ kann Izzos opus magnum nicht das Wasser reichen, findet Thomas Pöttgen.
Kennen Sie die Kulturhauptstadt Europas 2013? Richtig (bzw. falsch!) – das ist (neben Košice) Marseille. Die zweitgrößte Stadt Frankreichs ist als wichtigster Hafen unseres Nachbarlands selbstverständlich auch ein bedeutender Drogenumschlagsplatz. Seit einigen Jahren herrscht in Marseille ein Krieg um die Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt. (Bei Interesse daran, was davon in den deutschen Medien hängengeblieben ist, lesen Sie beispielsweise hier, hier und hier weiter.
Der Italiener Massimo Carlotto hat einen Krimi veröffentlicht, der die gegenwärtige Lage in Marseille zum Thema nimmt und darüber hinaus noch die neuen internationalen Verflechtungen der organisierten Kriminalität einbeziehen will. Diese hält mit der Globalisierung der legalen Wirtschaft locker Schritt, so scheint es, wenn sie ihr nicht von jeher einen Schritt voraus war. Immerhin gab es schon zu Zeiten der berühmten French Connection, auf die der deutsche Titel so subtil anspielt, einen lukrativen, Kontinente übergreifenden Drogenhandel via Marseille.
Doch seitdem ist alles viel komplexer geworden, glaubt man Massimo Carlotto. Die hehren Ansprüche des Autors, das ganz große Bild zu zeichnen, haben ergeben, dass (unter anderem!) folgende Themen Einzug in den Roman gehalten haben: Freiheitskampf im fernen Transnistrien, heimlicher Handel mit verstrahltem Holz von Tschernobyl aus, Ausbeutung der Arbeiter in Abwrackwerften in Indien, türkische Chirurgen, die in einer italienischen Klinik unfreiwillige Ganzkörperspender ausweiden, illegale Sondermüllentsorgung vor der Küste Somalias, die Ränke des russischen Geheimdiensts FSB, Begehrlichkeiten mexikanischer Drogenkartelle, finstere Pläne nordafrikanischer Islamisten, Revierkämpfe chinesischer Gangs im paraguayanischen Ciudad del Este, das Treiben der Mafias – der korsischen, der russischen, der chinesischen und natürlich einer der vielen süditalienischen Mafias. Schließlich ist da auch noch das zutiefst korrupte Geflecht aus Wirtschaft und Politik im gebeutelten Marseille, das sich so viele Kräfte gewaltsam unter den Nagel reißen wollen. Und das alles auf 240 Seiten! Kann das gutgehen? Nö, in diesem Fall leider nicht.
Böse, böser, Marseille
Die kaum zu bewältigende Überfülle an Themen lässt nur Raum für hastiges namedropping in der jeweiligen Sprache, statt einem Hauch von Lokalkolorit und der Beschreibung kultureller Eigenheiten der vielen Schauplätze und Gruppen Platz zu lassen. Doch das ist nur eine der Schwächen, die die Lektüre des Romans wenig erfreulich macht. Abgesehen davon kennt Carlottos Palette leider nur Schwarz. Soll heißen: ein Bösewicht in Marseille ist noch viel böser als der andere, und die Gesetzeshüter sind auch nicht viel besser. Nichts gegen einen gesunden Pessimismus, aber direkt zu Anfang, wenn eine ganze Bande Russenmafiosi ihr Leben lässt, wird eine röhrende Überbietungsmaschinerie angeworfen, die keine interessante Dramaturgie mehr zulässt. Da wird vergewaltigt und gemetzelt, dass es nur so spritzt. Ganz paritätisch dürfen Frauen und Männer aus aller Herren Länder um den Titel des größten Folterknechts /der größten Foltermagd wetteifern. Und so gibt es leider auch keinen Raum für Ambivalenz, interessante Widersprüchlichkeit und vielschichtige Charaktere, weder unter den aufstrebenden Neugangstern, die sich als glänzende Wirtschaftsstudenten in Leeds kennengelernt und zu neoliberalen Supermafiosi verschworen haben, noch auf Seiten der eigentlichen Heldin des Buches, des zynischen tough girls im Polizeidienst, B.B.
Geisterbahn
Das Buch ist meist so differenziert wie eine vollgequetschte Liste, die Schrecken und Abgründe so wohldosiert wie die einer Geisterbahn. Als beispielhaft für die Art und Weise, wie die unzähligen Figuren, ihre Hintergründe und die internationalen Verwicklungen des Verbrechens in der „Marseille-Connection“ angerissen und sofort wieder fallengelassen werden, sei hier zum Abschluss noch folgende Szene zitiert, die auch für den sprachlichen Stil des Romans und den Spannungsaufbau charakteristisch ist:
„Bevor sie im Zócalo als Köche anfingen, hatten Hernán und Valentín im Waffen- und Kokainhandel gearbeitet und sich lange in den heimischen Gefängnissen aufgehalten. Auch die Putzfrau, Concepción, genannt Concha, war keine Heilige, und keiner der drei war sonderlich beeindruckt angesichts der auf sie gerichteten Pistolen.
Die Frau beschränkte sich auf die Mitteilung, der Chef komme später, und die beiden Männer blickten die Angreifer so ausdruckslos an wie eine Wand.
Nur Garrincha war sich bewusst, wie gefährlich sie sein konnten. Er vergeudete nur so viel Atem, wie es brauchte, um sicherzugehen, dass er sich nicht geirrt hatte. „Wo ist der Stoff?“, fragte er auf Spanisch.
Keine Antwort. „Dreht euch zur Wand!“, befahl er.
Die Köche und Concha drehten sich langsam um. Gott weiß, was ihnen durch den Kopf ging. Arschlöcher, genau wie ihr Chef. Esteban verlor die Geduld und gab seinen beiden Männern ein Zeichen abzudrücken.“
Thomas Pöttgen
Massimo Carlotto: Die Marseille-Connection. (Respiro Corto, 2012). Aus dem Italienischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Stuttgart: Tropen 2013. 240 Seiten. 18,95 Euro. Foto: Blick auf Marseille von Notre Dame de la Garde aus. Foto von Adrian Pingstone, Wikimedia Commons, Quelle.












