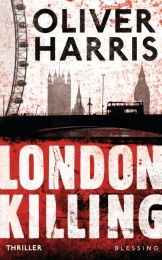 Der obdachlose Bulle
Der obdachlose Bulle
– Ein paar Bemerkungen zum Verhältnis von Polizei und Crime Fiction, anlässlich Oliver Harris´ Debut „London Killing“. Von Thomas Wörtche.
Bei gefühlten 80 Prozent der Kriminalliteratur könnte man den Eindruck haben, sie sei in cleveren PR-Abteilungen von Polizeipräsidien entwickelt worden. Die ganzen CSI-Allmachtsphantasien (egal, wie ihr´s anstellt, wir kriegen euch doch), all die knorzigen Kommissare und ihre flippigen Assistentinnen und all die bedenkentragenden Kommissarinnen mit ihren grämlichen Assistenten, die witzischen Forensiker und Leichenschneider, die skurrilen Staatsanwälte und die putzigen Mordfälle – egal, ob Tod auf dem Klo, im Gemüsebeet, in der Kurklinik oder bei der Weinverkostung, egal, ob die Killer mit Gedärmen rumwickeln oder mit Leichenteilen spielen, ob Leute, in slow motion und genüsslich dargestellt, zu Tode gefoltert, filetiert, erstickt, gehäutet oder sonst was werden – Pop Stolizei! Ähhh, Stop, Polizei! (according to Seyfried) – ist flugs da und löst, mal mit weniger, mal mit mehr eigenen Blessuren das ganze Elend auf. Auch wenn das Elend nur zu diesem Zweck erfunden worden ist, um die Polizei als Garanten von Recht & Ordnung zu featuren. Ganz hartnäckige Schreiberlinge erfinden dann auch noch nette Polizisten in Diktaturen und anderen Schweinesystemen.
Denn wenn´s auch manchmal schwarze Schafe in der Bullentruppe gibt, eitle Vorgesetzte, inkompetente Randfiguren – das System ist all at all schon gut und gerecht.
 Ideologie & Werte
Ideologie & Werte
Wie gesagt, in gefühlten 80 Prozent der Fälle scheint das so zu sein, aber das reicht, um so allmählich eine Allergie gegen polizeifromme, geradezu polizeihörige Ideologieproduktionen zu entwickeln. Wobei die schlimmsten Fälle die sind, bei denen das völlig unbewusst passiert – also in den meisten Regio-Grimmis und sonstigen Schwarten, wo Chef & Assistent(en) immer noch sortiert sind wie Stefan und Harry, aber natürlich längst viel cooler aussehen. Nach lebensweltlichen Normen für unkündbare Beamte mit Pensionsberechtigung (und analogen Privilegien in anderen Ländern).
Aber dass eben diese gefühlten 80 Prozent aller derzeitigen Kriminalromane ohne großes Bewusstsein für die eigene Verfasstheit für den Markt hin produziert werden wie Fischstäbchen, ist bekannt und wird noch nicht mal von Produzenten- und Rezipientenseite bestritten. Wie auch, wenn man Krimis für Wellnessprodukte und ähnlich literatur- resp. kriminalliteraturferne Erzeugnisse hält. Die Nele Neuhause (prototypisch, nicht ad personam) dieser Welt und ihr Publikum bilden da schon eine bemerkenswert konsistente Einheit. Was an und für sich völlig zielgruppenorientiert okay ist, wenn da nur nicht eben pausenlos ordnungspolitische und mittelstandskompatible Werte mit zudem fragwürdigem gender-factor wie auf dem Kasernenhof durch ständige Wiederholung, Repetition und reflexionsfreies Durchexerzieren eingepaukt und eingedrillt würde.
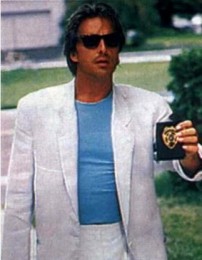 Es geht auch anders
Es geht auch anders
Es geht auch anders. Es ging sogar schon immer anders, seit Hammetts Zeiten; aber die subversiven bis anarchischen Modelle der Polizei-Romane (nur davon reden wir gerade), also die des frühen und mittleren Wambaugh, die von Jerome Charyn, Derek Raymond, Bill James und Stuart MacBride etwa (flankiert von Filmen und TV ab Miami Vice über The Shield bis, cum grano salis, Luther), hatten und haben gegen die Übermacht des ordnungspolitisch Korrekten (und manchmal Reaktionären) nur höchst limitierte Chancen.
Deswegen freut man sich sehr, wenn man auf einen Polizisten stößt, der obdachlos ist, sich im schicken Haus eines Mordopfers einquartiert, Polizeiarbeit faked, geklaute Streifenwagen im Suff schrotet und dann stehen lässt, Vorgesetzte belügt und betrügt, was aber nicht schlimm ist, weil die ganz korrupte, schlimme Finger sind, und tausend mehr Dinge tut, die ein anständiger Polizist nicht tut. Nicht mal einer aus der genauso polizeifrommen, nur etwas düsterer dekorierten Bullentruppe von der Abteilung Tristesse, Melancholie, Weltschmerz und Seelenqual. Unser britischer Copper hier ist all dies nicht. Er ist noch nicht einmal ganz tief drinnen und in Wirklichkeit ein guter Polizist. Er ist einfach ein cleveres, völlig bedenkenloses und schlaues Kerlchen. Ein kleines Dreckstück, das auch ganz charmant sein kann (was nicht dasselbe ist wie ein charmantes Miststück).

The City of London
Detective Constable Nick Belsey heißt diese hochplausible Figur, die Oliver Harris (*1978) für seinen ersten Roman „The Hollow Man“ (auf Deutsch total sinnfrei: „London Killing“) erfunden hat. Belsey ist nicht der titelgebende hollow man. Das ist ein toter Oligarch, der eine Menge Kohle für ein größenwahnsinniges Bauprojekt einsammeln will, wie es für die von megalomanen Bauprojekten nur so strotzende City of London typisch ist. Nur, dass der tote Oligarch weder Oligarch noch … aber das müssen Sie selbst lesen.
Auf jeden Fall quartiert sich der völlig abgebrannte Belsey, der gerade aus der letzten billigen Absteige rausgeflogen ist, im exklusiven Hampstead in ein Luxushaus ein, dessen Bewohner verschwunden zu sein scheint. Es riecht ein wenig streng, aber Belsey bearbeitet stoisch den Vermisstenfall, Recherche vor Ort. Es riecht immer strenger. Klar, hinterm Kleiderschrank ist ein verstecktes Büro, im Drehstuhl sitzt eine Leiche und west vor sich hin. Aber ein Leichenfund wäre nicht günstig wegen der Routinen, die sich bei Mord nun mal in Bewegung setzen. Mit der gemütlichen Bleibe wär es aus. Außerdem stinkt es nicht nur nach Kadaver, es riecht auch nach Geld. Und das braucht unser DC dringend. Also manipuliert Belsey die Vermisstensache Devereux, so hieß der Mann mit der aufgeschlitzten Kehle vermutlich. Manipulieren kann Belsey gut, weil er das System Polizei kennt. Er kann sich Informationen beschaffen, er kommt an Daten, er kann sich aus dem System logistisch bedienen, Identitäten vortäuschen, lügen und betrügen. Das System interessiert es nämlich nicht, ob einer „gut“ ist oder „böse“, es arbeitet für den, der es beherrscht. Um ein kompetenter Krimineller zu sein, braucht man bloß einen Job bei der Polizei.
Eyes wide shut
Harris lässt seinen Belsey durch die verschiedenen Milieus von London flitzen und sich durchbluffen, ausgekocht, kaltschnäuzig, abgebrüht und manipulativ, immer eine flotte Lüge auf der Lippe, nie um einen wisecrack verlegen. So schlängelt er sich durch – bei den grauen Machthaber der City, bei den Gangstern von Elephant & Castle, bei Bullen, Geheimdienstlern, Gangstern, hartgesottenen Journalistinnen und exklusiven Privatclubs. Hin und wieder erinnern diese Trips, die ins Ungewisse, in ominöse Clubs und schicke Landsitze und andere fast irreale Milieus von Greater London führen, an die Irrfahrten von Tom Cruise alias Dr. Bill Harford in Kubricks „Eyes wide shut“ durch New York.
Ein komplizierter Zeitplan und diverse zu umschiffende, auszutricksende und gegeneinander auszuspielende Parteien sorgen für die Dramaturgie des Romans, der keinesfalls nur komödiantisch ist, sondern DC Belsey in einer sehr handfest robusten Umwelt sehr robusten Herausforderungen aussetzt. Getötet und gestorben wird in „London Killing“ auch – sogar aus plausiblen, wenn auch wenig erfreulichen Gründen.
Kriminalroman pur
Schließlich ist das Buch ein Kriminalroman und handelt von Kriminalität auf buchstäblich allen Ebenen. Völlig selbstverständlich kriminell ist auch die Polizei. Nicht nur einzelne böse Buben, nicht nur korrupt als Skandal, sondern systemisch. Und das macht jemanden, der einmal ein „anständiger“ Polizist sein wollte, am Ende völlig kriminell. Mit aller kriminellen Kompetenz, die, siehe oben, nur ein Polizist haben kann. Belsey aber war noch nicht mal früher ein „anständiger“ Polizist, deswegen ist er jetzt clever genug, nicht offen kriminell zu sein. Hochkriminell aber schon. Und von dieser Konstellation lebt diese grimmige Komödie.
„London Killing“ ist ein Roman mit allen Zutaten für einen gepflegten BritNoir – aber, und das ist vermutlich die schönste Lektüreerfahrung, er ist zur Selbstironie fähig. Und wird insofern zu einem roman noir mit einer ausgesprochen anti-noirishen Volte. Und davor liegt einer der irrsten Showdowns der Literaturgeschichte, der – so viel sei verraten – auf unser aller Lieblingsbilligfliegerflughafen Stansted abgeht und ziemlich viel mit Pferden zu tun hat. Aber das ist schon wieder eine andere genre-mäßig vertrackte Teufelei … Wer will, kann natürlich nach Querverweisen, Anspielungen und Zitaten suchen, das übliche Programm für post-postmoderne Textgenerierung durchlaufen lassen. Geht, muss aber nicht …
Welch schöner Schluss
Gerade weil „London Killing“ kein üblicher noir ist und kein üblicher braver Polizeiroman, kein „kritischer“ Polizeiroman und keine übliche Gaunerkomödie, gerade weil er innerhalb des Genres „Kriminalroman“ keine weitere stichhaltige Subsumierung zulässt, ist er ein Kriminalroman sui generis. Ein Roman über Verbrechen, Verbrecher, Polizei und eine Großstadt. Comme il faut.
Und er bietet einen der coolsten Schlusssätze, die mir in letzter Zeit untergekommen sind: „Als London auffiel, dass er immer noch da war, verkniff es sich ein Lächeln. So, so, schien es sich zu sagen, da wären wir also wieder, wir beide.“
Thomas Wörtche
Oliver Harris: London Killing (The Hollow Man, 2012). Roman. Deutsch von Wolfgang Müller. München: Blessing 2012. 478 Seiten. 19,95 Euro (als Kindle e-book 15,99 Euro). Verlagsinformationen zum Buch.











