 Hohe Qualitäten
Hohe Qualitäten
Ein neues Buch von Paco Ignacio Taibo wird immer freudig begrüßt. Auch wenn dieses neue Buch so neu gar nicht mehr ist. Eine kleine Einordnung von Thomas Wörtche.
Die deutsche Publikationsgeschichte von Paco Ignacio Taibo II ist so anarchisch wie seine Romane. Nach langem Mäandern durch Großverlage, Mittelverlage, Kleinverlage und Winzverlage (in der Spannweite u. a. von Bertelsmann über Rotbuch zum Eisbär) scheint er so allmählich bei der engagierten Assoziation A in verlässlichen und sinnvollen Händen zu sein. Auch wenn es nach wie vor zu netten, paradoxen Situationen kommt und wir aktuell PIT II’s Roman Der Schatten des Schattens aus dem Jahre 1986 jetzt, 2010, lesen dürfen, die Quasi-Fortsetzung Die Rückkehr der Schatten aber schon seit 2004 kennen dürfen.
Aber was soll solch kleinbürgerlicher chronologischer Ordnungszwang, zumal es auch in Taibos Büchern nicht gerade schablonenhaft geordnet zugeht. Und das ist schon einmal eine ihrer großen Qualitäten. In Taibos Opus Magnum Cuatro Manos (Vier Hände, 1990) war es voll ausgefaltetes Prinzip, spannende Geschichten so disparat wie möglich zu erzählen. Hier im Schatten der Schatten ist schon in nuce zu sehen, wie brillant Taibo aus Fragmenten von Kriminal- und Abenteuergeschichten einen komplexen Text montiert, der sowohl als historischer Roman taugt, als Abenteuerroman, als Kriminalroman und als politischer Roman gleich mit.
Pistoleros in De Efe
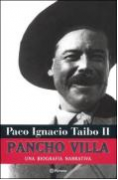 Wir sind im Mexiko City des Jahres 1922 – seit zwei Jahren ist der Bürgerkrieg offiziell vorüber, aber die mexikanische Gesellschaft und speziell die urbane Metropolen-Gesellschaft von „el De Efe“ ist noch lange nicht stabil. Pancho Villa, der sozialrevolutionäre Bürgerkriegsgeneral und populärkulturelle Groß-Mythos, war noch nicht ermordet – das passierte erst 1923, ein Jahr nach unserer Handlung. Aber Villa ist allgegenwärtig. (PIT II hat eine brillante Biografie über ihn geschrieben: Pancho Villa. Una biografía narrativa, 2007 leider noch nicht übersetzt, weshalb Menschen, die englisch können, sich noch mit Friedrich Katz’ monumentaler, vor Material überquellenden Biografie The Life & Times of Pancho Villa von 1998 begnügen müssen).
Wir sind im Mexiko City des Jahres 1922 – seit zwei Jahren ist der Bürgerkrieg offiziell vorüber, aber die mexikanische Gesellschaft und speziell die urbane Metropolen-Gesellschaft von „el De Efe“ ist noch lange nicht stabil. Pancho Villa, der sozialrevolutionäre Bürgerkriegsgeneral und populärkulturelle Groß-Mythos, war noch nicht ermordet – das passierte erst 1923, ein Jahr nach unserer Handlung. Aber Villa ist allgegenwärtig. (PIT II hat eine brillante Biografie über ihn geschrieben: Pancho Villa. Una biografía narrativa, 2007 leider noch nicht übersetzt, weshalb Menschen, die englisch können, sich noch mit Friedrich Katz’ monumentaler, vor Material überquellenden Biografie The Life & Times of Pancho Villa von 1998 begnügen müssen).
Die Regierung des Revolutionsgenerals Álvaro Obregón saß noch alles andere als sicher im Sattel. Die amerikanischen Erdölgesellschaften machten Druck und waren selbst unter Druck durch aggressive englische und holländische Konsortien; die forcierte Industrialisierung einer außerhalb der Städte wesentlich agrarischen Gesellschaft führte zu den erwartbaren Kämpfen; immer putschbereite Militärs, ein korruptes Polizeiwesen, individuelle und Bandenkriminalität, die Ubiquität von Schusswaffen und die zunehmende Beschleunigung des Lebens – das alles ergibt wunderbare Motive für Taibos Stadtmosaike und -tableaux.
Mexiko City war auch gleichzeitig eine Stadt mit einem extrem günstigen Klima für Kunst- und Lebensformavantgarden, es war, wie ganz Mexiko für den europäischen Blick „der surrealistische Ort“ schlechthin, wie André Breton ein paar Jahre später schwärmen sollte. Frida Kahlos Fotosammlung (s.u.) und die Biografie ihres Gefährten Diego Rivera von Patrick Marnham vermitteln einen schönen Eindruck, wie Taibos Setting ausgesehen haben mag, und wie belebt und sinnenträchtig er diese Zeit beschreibt.
Vier Amigos
Und in diesem Hexenkessel spielen sie Domino: Der Journalist Poiquinto Manterola, der im Journalismus „die Poesie des Jahrhunderts“ sieht, der Dichter Fermín Valencia (nicht zufällig wie Taibo und vor allem Taibos Vater Paco Ignacio Taibo I – Bürgerkriegsflüchtling, weil kritischer Journalist – im asturianischen Gijón geboren), der als alter Kampfgenosse Pancho Villas in der Norddivision mit seinem 45er Colt bestens umgehen kann; der Chinese Tomás Wong, der kein Chinesisch kann, kein chinesisches Essen mag, ein hartgesottener Kämpfer für die Sache der Arbeiterklasse ist und mit karikaturhaft-chinesischem Akzent splicht; dazu der Anwalt Verdugo, der sich in allen Bereichen der demi-monde herumtreibt und für Huren, Revolutionäre und diverse Nachschattengewächse den Rechtsbeistand gibt.
Diese vier Herren nun schliddern, nicht ganz gegen ihren Willen, in höchst rätselhafte Umtriebe, die allesamt mit Leichen zu tun haben – einem erschossenen Militärmusiker, einem aus dem Fenster gefallenen Obersten und so weiter … Die vier Amigos werden angegriffen, beschossen, stürzen durch Falltüren in Kellergewölbe, belauschen in Bordellen merkwürdige Sexualpraktiken, müssen sich mit geschniegelten Offizieren prügeln und mit Pistoleros herumschießen und kommen zum guten Ende einem veritablen und sehr realpolitischen Komplott auf die Spur.
Spiel und Hintersinn
Was manchmal durchaus beabsichtige Anklänge an Eugéne Sue hat – wer unbedingt auch die Musketiere von Dumas pere im Spiel sehen will, unsere vier Domino-Spieler würden sich nicht arg widersetzen – und ganz offen auf den Italiener und Sandokan-Erfinder Emilio Salgari – eine Art Karl May der Romania – anspielt, ist trotz aller Assoziations- und Spielfreude nicht „meta“. Klar, man muss grinsen, wenn ein Schurke in Uniform ausgerechnet Martínez Fierro heißt. Martín Fierro ist der Titel eines episch-breiten, von 1872 bis 1879 entstandenen Gedichts, die Gründungsschrift des Gaucho-Mythos in Argentinien aus der Feder von José Hernandez. Natürlich ist der Gaucho Martín Fierro ein Rebell, einer, der aus dem Zwang der Umstände heraus Verbrechen begehen muss – also genau das Gegenteil von Schurke Fierro bei Taibo. Wer sucht, der findet solche Scherze in Hülle und Fülle.
Aber so hübsch der Einfall sein mag, nur ein Joke für Eingeweihte ist er nicht – er verweist auf eine Tradition von Literatur (und da kommen dann auch Salgari, Dumas, Sue und Co. ins Spiel) die als „marginal“ gilt. Und insofern mit der Kriminalliteratur sozusagen natürlich verbündet ist. Taibo hat das in Interviews und Essays immer wieder betont: Alle seine Romane, nicht nur die aus dem Zyklus um den Privatdetektiv Héctor Belascoaran Shayne, gehören zur Kriminalliteratur, ungeachtet dessen, welcher Formen und Traditionen sie sich sonst noch im Einzelfall bedienen. Sie sind deswegen bewusst „marginal“, weil Kriminalliteratur damit immer in Oppostion zum Nicht-Marginalen, zum Offiziellen steht. Da gehört sie hin.
Und die ganzen Cluster von Verweisen, Querverweisen, Anspielungen, benannten oder unbenannten Hintergründen, die Taibo aufbietet, stehen ganz im Dienste seiner erheblichen Fähigkeit, mit diesen ausgefuchst ästhetischen Mitteln komplex und gleichzeitig unterhaltend, witzig, lehrreich, spannend und sehr intelligent zu erzählen.
Poesie
Hin und wieder ist Taibo so souverän, einen einmal eingeschlagenen Duktus zu verlassen, und Erzählhöhe und -ton jäh zu verlassen – dann schwimmen plötzliche einzelne kurze Kapitel wie Eisschollen im blauen Meer der opulenten narration. Sequenzen, die keine Verbindung zu irgendetwas zu haben scheinen. Irritierend und opak, wie zum Beispiel das 33. Kapitel dieses Romans, in dem ein weibliches Ich sich vergeblich zu bestimmen versucht. Die Botschaft – neben der poetischen Qualität, die diese Passage per se hat,– zielt auf Verwirrung, auf Skepsis auch dem ach so realistisch Erzählten gegenüber. Die Poesie hat eine mächtige Eigendynamik …
Der Schatten des Schattens gehört in die Reihe von Texten, die in den 1980ern anfingen, die Potenziale von „Kriminalroman“ ernsthafterweise auszuschöpfen. Jerome Charyn, William Marshall, Derek Raymond oder Andreu Martín gehören u. a. in diese Reihe. Taibo-Bücher haben alle das subversive, spezifisch sozialkritische Moment, das alle wirklich gute Kriminalliteratur auszeichnet. Das Argument, das an dieser Stelle gerne dumpf wiedergekäut kommt: Kriminalliteratur müsse/solle keine Botschaft haben, möchten wir bitte endgültig einmotten: Eine Botschaft oder einen radikalskeptischen Blick auf die Welt zu haben, sind kategorial unterschiedliche Dinge. Taibo hat keine Botschaft. Stattdessen arbeitet er mit Witz und Geist, und die Methode braucht Formen, die nicht im (allzu) Kanonischen festgefahren sind.
Der Schatten der Schatten ist ein sehr komisches und sehr, sehr vergnügliches Buch. Das sind hohe Qualitäten.
Thomas Wörtche
Paco Ignacio Taibo II: Der Schatten des Schattens (Sombra de la Sombra, 1986). Roman.
Aus dem Spanischen von Harry Stürmer.
Berlin/Hamburg: Assoziation A 2010. 228 Seiten. 18 Euro.
Paco Ignacio Taibo II: Vier Hände.
Aus dem Spanischen von Annette von Schönfeld.
Zürich: Unionsverlag 2005. 445 Seiten. 11,90 Euro.
Paco Ignacio Taibo II: Pancho Villa. Una biografía narrativa.
Planeta 2006.
Friedrich Katz: The Life & Times of Pancho Villa
Stanford University Press 1998.
Pablo Ortiz Monasterio (Hrsg.): Frida Kahlo. Ihre Photographien.
Leben, Liebe, Kunst, Revolution und Tod. 400 Bilder aus dem Photoschatz im Blauen Haus.
München: Schirmer/Mosel 2010
Patrick Marnham: Diego Rivera. Träumer mit offenen Augen.
Bergisch-Gladbach: Lübbe 2001.
| Mehr zu Paco Ignacio Taibo II
| Paco Ignacio Taibo II bei Assoziation A
| Frida Kahlo – Retrospektive im Martin-Gropius-Bau (30.04.-09.08.2010)












