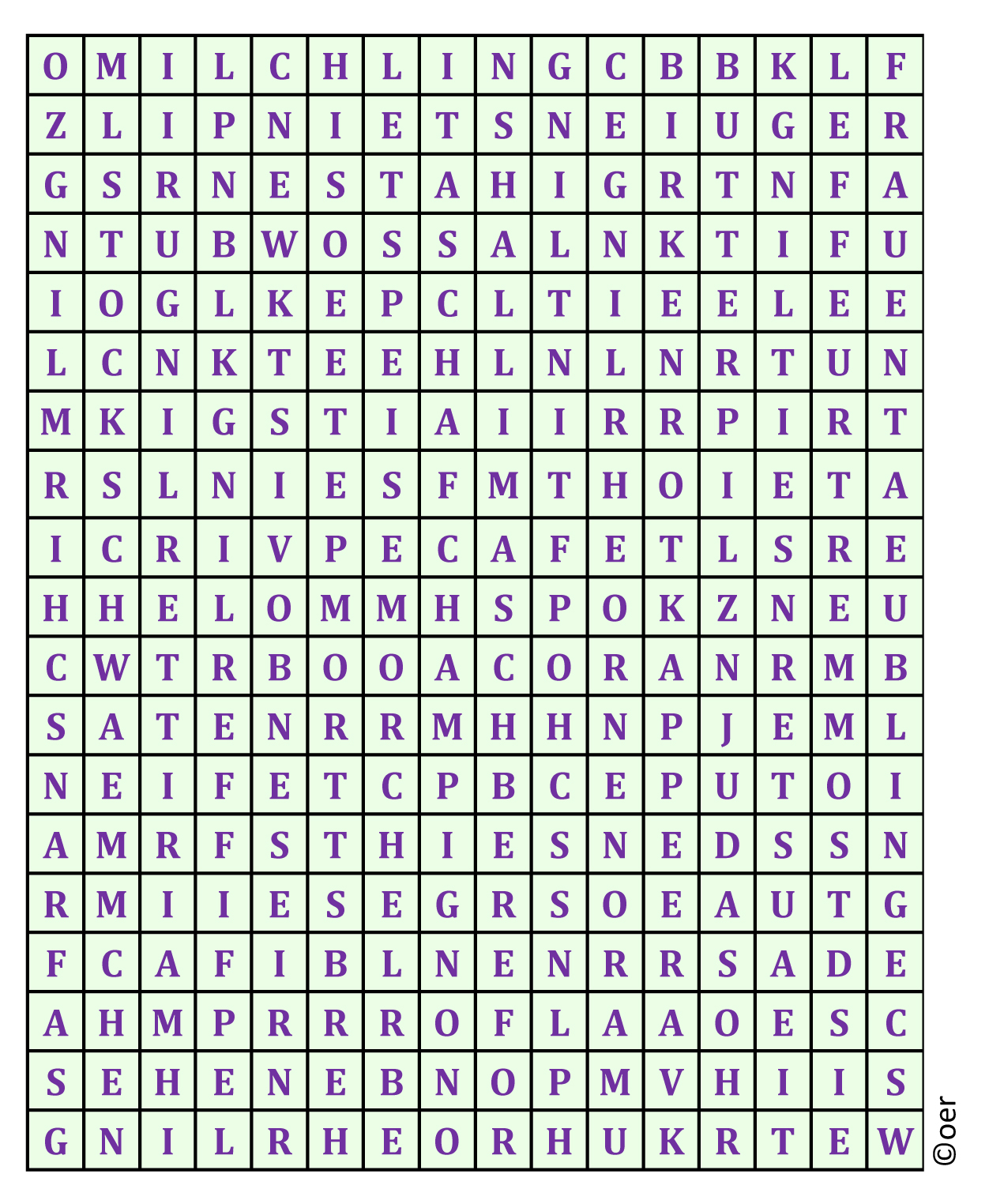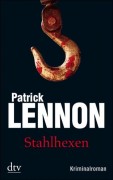 Kein Hexenwerk
Kein Hexenwerk
Lektoratsschlampereien und -inkompetenzen, unangemessene Werbung und schräges Marketing – vielen Verlagen merkt man an, dass sie auf den Krimi-Boom setzen und ihnen alles andere als Verkaufszahlen herzlich egal ist. Henrike Heiland hat sich geärgert.
Die Idee ist ganz nett: Tom Fletcher, einst Polizist in Cambridge (siehe Vorgänger Tod einer Strohpuppe, dtv 2007), jetzt Privatdetektiv. Sieht gut aus, ist clever und um die dreißig. Der hat einen Vater, den er achtzehn Jahre lang nicht gesprochen hat, weil er glaubt, er sei schuld am Verschwinden seiner Mutter Kate. Und jetzt meldet sich der Vater nach achtzehn Jahren und sagt am Telefon kryptische Dinge wie: „Wir müssen ihn töten.“ Dazu noch eine vage Ortsangabe, und dort findet Tom eine Leiche: Nathan Slade, Amerikaner, irgendwas Wichtiges bei einem amerikanischen Waffenkonzern in der Nähe von Cambridge. Was hat jetzt sein Vater mit diesem Slade zu tun? Hat er ihn etwa umgebracht? Auch tot, aber erst später gefunden: Daisy Seager, Elitestudentin und – hört hört – Hostess zum Taschengeldaufbessern, außerdem offenbar die Geliebte von Nathan Slade. Oder doch nicht?
Hexen auf Nasen
Daraus wird schnell eine spannende Geschichte mit den Zutaten Zweiter Weltkrieg, verschwundener, sagenumwobener US-Luftwaffenstützpunkt in Norfolk, Cambridge-College, das an atomwaffentauglichem Zeugs rumgebastelt hat, und jungen Frauen, die als Hexen auf den Nasen einiger US-Flugzeuge von einem unbekannten Künstler verewigt wurden und fortan „Stahlhexen“ hießen. Dann hat Daisy auch noch ein grobkörniges Foto von Tom Fletcher als kleinem Jungen extrem vergrößert an ihrer Pinnwand hängen, und irgendwie kommt da jedenfalls auch noch Fletchers verschwundene Mutter ins Spiel. Als Sahnehäubchen quasi rollt ein Orkan auf Ostengland zu, das gerade im Jahrhunderthochwasser versinkt. Ja, es ist alles ein bisschen komplex, und eine stimmungsvolle Erzählung aus der Vergangenheit, in der es um einen Hexenjäger, sein Vermächtnis und zwei junge Frauen auf einem einsamen Gehöft geht, kommt noch mit dazu. Also erst mal eine gute Sache: Man will wissen, wie das ganze da im Einzelnen zu einem Ergebnis führt.
Nun. Streckenweise bleibt es auch recht spannend, hat aber diverse Haken. Erst versteht man nicht so richtig, warum Tom Fletcher – achtzehn Jahre Funkstille hin oder her – nicht so wirklich nach seinem Vater fahndet. Den lässt er, obwohl er weiß, dass er seinen Armeerevolver aus einem Versteck gezerrt und frisch geölt hat, einfach in der Pampa herumlaufen. Überhaupt schafft es der Autor nicht, Fletcher zu einem Charakter zu machen, der berührt und anspricht. Er gibt ihm zwar haufenweise Schwächen und Background und Zeugs, scheint also durchaus zu wollen, dass der Leser Fletcher richtig gern hat, aber der Kerl sperrt sich. Dann kommt noch ein unruhiges Hin- und Hergerenne dazu: Fletcher geht zu Ort A und redet da erstmal. Dann geht er nach B und redet. Dann nach C, und jetzt fällt dem Autor ein, Action wäre eine gute Sache, also ein bisschen Action. Und so weiter. Man wird das Gefühl nicht los, dem Autor werkstattmäßig über die Schulter zu schauen. Was auch hier wieder daran liegt, dass Atmosphäre zwar behauptet wird, aber nicht recht entsteht. Sie wird sogar an vielen Stellen großzügig verschenkt.
Das macht keinen Spaß
Richtig wild wird es dann zum Schluss. Gerade ist man so weit, dass man denkt, okay, jetzt packen wir aber mal so langsam zusammen, und aha, da ist er ja, der Showdown.
Von wegen. Der Showdown wird so elend in die Länge gezogen, dass man spätestens jetzt den Autor erwürgen möchte mit den Worten: Konntest du nicht einfach hundert, ach was, hundertfünfzig Seiten weniger schreiben?! Zum Ende hin passiert nämlich folgendes: Man weiß, wer der Mörder ist, hat so eine ungefähre Ahnung, was hinter allem steckt, Motivlage und so weiter, aber man muss sich mit den Figuren durch den Sturm und die Wassermassen kämpfen, um hier noch mal ein Bröckchen neue Info und da noch mal einen Satz neue Erkenntnis zu erlangen. Statt schön auf das Ziel loszusteuern, lässt sich Fletcher, dem mittlerweile die junge Amerikanerin Mia zur Seite steht (nur für dieses Buch), immer wieder ablenken: Ach, schauen wir doch da noch mal nach. Huch, ich kenn ja noch einen, der könnte uns vielleicht das und das erzählen. Eigentlich sollten wir ja weiter, aber hören wir doch mal, was der alte Mann uns so zu sagen hat. Und hui, was für ein Unwetter.
Das macht keinen Spaß. Die Briten mögen sich ja gerne mit dem Thema Wetter auseinandersetzen, und im Grunde ist das für einen Showdown auch eine gute Idee, man hat so ein zeitgleich ablaufendes Ereignis, das die Sache noch schwieriger und den Höhepunkt noch gewaltiger machen kann, aber – man kann’s auch übertreiben. Patrick Lennon hat sich so sehr in diese Unwetteridee verliebt, dass es vermutlich nur so – pun intended – aus ihm heraussprudelte. Lieber Herr Lennon, man muss auch mal loslassen können. Einige der Logik zuträglichen Teile der Geschichte wurden von den Wassermassen offenbar mitgerissen, weitere lose Fäden, die es durch den Sturm bis ans Ende des Buchs geschafft haben, sind wohl durchaus gewollt lose Fäden geblieben, von wegen – Achtung! – ein paar Dinge im Nebel lassen. (Nebel kommt nämlich auch noch gerade so im rechten Moment beim Showdown vorbei.) Das kann man machen, das finden viele Leser auch schön, wenn es sich um eine Sache handelt. Aber gleich bei … Moment … fünf Punkten? (Es können auch mehr sein, wie gesagt, im Unwetter ist einiges verloren gegangen.)
Patrick Lennon hat sich bei diesem Buch eine ganze Menge gedacht. Oft zu viel. Und oft sieht man sehr deutlich die hin gedrechselte Struktur des Romans, die den Blick für Stimmungen, Charaktere, Emotionen verstellt. Und damit versenkt Lennon die Stahlhexen, die an sich eine schöne Grundidee haben und deren Vergangenheitsstrang auch wirklich anspricht, damit versenkt er also (yes, pun intended, again) diesen seinen zweiten Roman in der Mittelmäßigkeit. Wo einen die holprige Übersetzung und das Satzzeichen nach Gutdünken über den Text verstreuende Korrektorat allerdings immer noch ärgern. Dtv! Krimi des Monats! Also echt jetzt. Ein bisschen mehr Sorgfalt, bitte.
Henrike Heiland
Patrick Lennon: Stahlhexen (Steel Witches, 2008). Roman.
Deutsch von Barbara Ostrop.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009. 384 Seiten. 8,95 Euro.