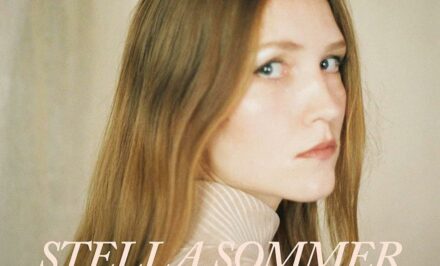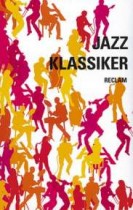 Veritables Standardwerk
Veritables Standardwerk
„Jazz-Klassiker“ ist ein must. Für Leute, die diese Musik gerade entdecken, für Leute, die verlässliche Informationen suchen, für Leute, die Substantielles über Jazz lernen wollen und für Leute, die meinen, schon alles zu kennen und alles schon selbst gedacht zu haben. Also für alle.
„Das Geheimnis der großen Jazzmusiker ist, dass sie das Wesen des Jazz offenlegen, ohne es zu verkünden“. Dieser kluge Satz eröffnet den Artikel über Billie Holiday, könnte aber auch gut als Motto für die 98 Porträts von Jazz Klassikern stehen, die unter der Herausgeberschaft von Peter Niklas Wilson gerade in zwei allerliebst aufgemachten Bänden erschienen sind. Posthume Herausgeberschaft, muß man leider präzisieren, denn Peter Niklas Wilson ist im Oktober 2003 im Alter von 46 Jahren gestorben. Wilson, dessen Arbeit ich immer unendlich geschätzt habe, war nicht nur einer der klügsten Köpfe der deutschen Musik-Publizistik, nicht nur selbst ein kompetenter Musiker von Rang, sondern auch einer, der seine hochintelligenten, intellektuell spielfreudigen, dabei aber auf festem Wissensgrund stehenden Reflexionen glänzend formulieren konnte und vor allem kommunizieren wollte. Unprätentiös, Moden, Hypes und schrillen Tönen zutiefst abgeneigt, immer clare et distincte argumentierend, so dass man selbst einen Dissens mit ihm höchstens als produktiv verstehen konnte, nie als sinnlos polarisierend.
Wilsons intellektuelles Format und seine Souveränität zeigen sich auch in diesem, seinem letzten großen Projekt: „Jazzgeschichte als Werkgeschichte der wichtigsten Musiker zu schreiben, ohne Anspruch auf lexikalische Vollständigkeit, aber mit dem Anspruch auf Relevanz“, wie seine Frau Nina Polaschegg es im Vorwort der „Jazz-Klassiker“ auf den Punkt bringt. Dazu gehört auch die kluge Auwahl der Mitarbeiter: Gerd Filtgen, Stefan Hentz, Wolfram Knauer, Thomas Loewner, Martin Pfleiderer, Stephan Richter, Hans-Jürgen Schaal, Tom R. Schulz und Markus A. Woelfle, die allesamt ihre eigenen Kompetenzen so in den Dienst des Projektes stellen, dass es organisch bleibt, ohne Individualismen zu verleugnen.
Herausgekommen ist bei diesem Unternehmen ein veritables Standardwerk – Faktensicherheit ist sowieso gewährleistet, an der Auswahl der Musikerinnen und Musiker können höchstens schmallippige Erbsenzähler mäkeln, wenn ihr persönlicher Darling nicht dabei ist. Klar fehlt die eine oder der andere, aber auch Bücher sind endlich.
Es gibt aber weit und breit kein Buch, das es mit diesem hier aufnehmen könnte. Die einzelnen Artikel mischen biographische, anekdotische, historische, soziologische und musikanalytische Ansätze in extrem lesbarer Form. Sie versuchen vor allem, stets und immer den Musikern und ihrem Werk gegenüber gerecht zu sein. Auch wenn das nicht immer den Beifall der hin und wieder bespöttelten „Jazzpolizei“ im „Sperrbezirk Jazz“ passen mag. Das trifft etwa auf den klugen Artikel über Dave Brubeck zu. Oder gerät zu einer furiosen Verteidung von Sun Ra, zu einer wahrhaft gebrochenen Lanze für Anthony Braxton oder zu einer Klischee-Entsorgung in den Fällen MJQ oder Peter Brötzmann (nebst anderen). Während natürlich auch der verstockteste Ignorant nicht über die Relevanz der Säulenheiligen von Louis Armstrong bis Thelonious Monk oder John Coltrane debattieren kann, nutzen Wilson und seine Koautoren ihr Konzept, um ein paar objektiv unterbewertete Musiker eben dahin zu stellen, wohin sie gehören: Zu den Klassikern. Das gilt für Charlie Christian, für Benny Moten, für George Russell, Steve Lacy oder Chris McGregor. Und war unbedingt notwendig.
Besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang der Neuakzentuierung ist der zweite Band. Denn dort tauchen neben den gesicherten Klassikern der Moderne wie Cecil Taylor, Eric Dolphy, Wayne Shorter, Albert Mangelsdorff oder Albert Ayler plötzlich völlig gleichberechtigt Namen aus Europa auf: Alexander von Schlippenbach, Misha Mengelberg, Gianluigi Trovesi, das Ganelin-Trio, Franz Koglmann, Mathias Rüegg oder Louis Sclavis. Also alles, was unbestreitbar wertvolle, nachhaltige Beiträge zum Jazz today geliefert hat, aber von der angelsächsisch dominierten Publizistik nicht oder nur marginal wahrgenommen wird. Leider gehen dabei – aber auch da ist das Buch endlich – der lateinamerikanische und asiatische Anteil verloren (die einzige Achillesferse des Projekts, wenn es denn unbedingt eine haben soll).
Ebenfalls sehr bemerkenswert und wichtig ist noch ein letzter Punkt. Jazz ist zwar nach wie vor eine lebendige, aber durchaus von totaler Kommerzialisierung bedrohte Kunst. Das heisst nicht, dass Musiker kein Geld verdienen sollen – au contraire; sondern meint die Tendenz, Jazz zu musealisieren; Billie Holiday Songs für Werbespots, die ganze Retro-Masche, die ganze schiefe Traditionsdebatte. Jazz hat sich entwickelt, und wo er dies aus guten Gründen der musikalischen Logik getan hat (und immer noch tut), ist er schon immer zu den Grenzen von E und U vorgestossen und weit darüber hinaus. Ob das irgendjemandem mit Gründen oder ohne gefällt oder mißfällt, spielt keine Rolle – es sei denn, man wollte eine Teleologie des Jazz moralisch untermauern. Es ist einfach so. Deswegen finden wir in den „Jazz-Klassikern“ einzelne Artikel, die diesen Zusammenhang historisch und aktuell begleiten: Das geht von Stan Kenton über Anthony Braxton bis zu Jan Garbarek. Dass Peter Niklas Wilson diese Artikel, die solche Erweiterungen und Modifikationen thematisieren, oft selbst geschrieben hat, ist kein Zufall, denn das Ausbrechen aus dem Sperrbezirk Jazz war Movens seiner eigenen theoretischen und künstlerischen Arbeit.
All at all: „Jazz-Klassiker“ ist ein must. Für Leute, die diese Musik gerade entdecken, für Leute, die verlässliche Informationen suchen, für Leute, die Substantielles über Jazz lernen wollen und für Leute, die meinen, schon alles zu kennen und alles schon selbst gedacht zu haben. Also für alle.
PS: Wie heißt es immer? Habent sua fata libelli. Bevor ein Buch aber von einem (öffentlichen) Schicksal ereilt werden kann, muß es in die Öffentlichkeit dürfen. In die öffentliche Diskussion, genauer gesagt. Medien unterhalten eigens dafür ihre Feuilletonredaktionen, Verlage ihre Presseabteilungen. Letztere sind dazu da, zum Wohl ihrer Autoren (und ihrer Verkaufszahlen) Rezensionsexemplare zu verteilen, Interviewtermine zu vermitteln, überhaupt Autor/Werk und Leser/Käufer miteinander zu verknüpfen.
Als Thomas Wörtche ein solches Rezensionsexemplar beim Verlag orderte, kam die schnöde Mitteilung: das Kontingent derselben sei erschöpft. Drolligerweise nämlich war keinerlei kontingentale Erschöpfung zu spüren, als die Redaktion eines Printmediums Wochen später ebenfalls um ein Rezensionsexemplar bat, ebenfalls für Thomas Wörtche, allerdings ohne den Namen zu erwähnen. Das Exemplar kam prompt. Thomas Wörtche grübelt jetzt: Mag es daran liegen, daß er vor ein paar Jahren mal ein arg verunglücktes Nachschlagewerk aus demselben Hause verrissen hat? Nicht als Einziger, aber als Erster – und sehr deutlich, mit guten Gründen, allesamt belegbar? Steckt das dahinter? Ein Verriss kann gar nicht begründet sein, der kann sich nur aus Bosheit speisen. Darüber muß man nicht reden, das schreit nach – Strafaktion? Können Presseabteilungen so unprofessionell sein? Zensoren wider die freie Meinungsbildung?
Das wäre schon schlimm genug. Aber in diesem Fall wäre es um ein Haar auf Kosten eines brillanten Autors und eines grandiosen Buchs passiert – eines toten Autors, der sich dagegen nicht mehr hätte wehren können.
Thomas Wörtche
Peter Niklas Wilson (Hg): Jazz-Klassiker. Stuttgart: Reclam 2005. Kartoniert. 816 Seiten, 2 Bde. im Schuber, 24,90 Euro.