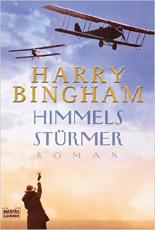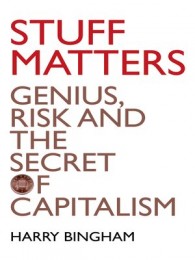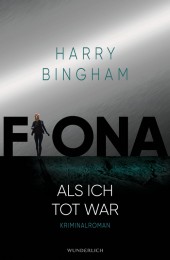 Absolute Spitzenklasse
Absolute Spitzenklasse
Harry Binghams Polizistin Fiona bekommt endlich den Auftritt, den sie verdient. Alf Mayer freut sich darüber und porträtiert Heldin und Autor.
Es gibt sie, die glücklichen Bücherschicksale. Und ja – so muss man es machen! Protagonistin und Autor haben dieses gute Ende mehr als verdient. Wobei, eigentlich ist es ein Neuanfang, und eben nur ein Anfang. Aber immerhin, der Teppich ist jetzt ausgerollt für eine der interessantesten zeitgenössischen Krimiheldinnen. Jetzt müssen sich nur noch Leser für Fiona Griffiths finden, diese seltsame junge Polizistin aus Cardiff/ Wales.
Es ist der zu Rowohlt gehörende Wunderlich Verlag, der bereits Philip Kerr und dessen Nazi-Zeit-Detektiv Bernie Gunther neu zu beleben verstand (CrimeMag-Kritik und -Interview hier und hier) und nun dem britischen Autor Harry Bingham einen fulminanten Neustart in Deutschland ermöglicht. „Fiona. Als ich tot war“ (The Strange Death of Fiona Griffith, 2014) kommt – warmherzig, witzig, sensibel und kraftvoll übersetzt von Andrea O’Brien – als solides Hardcover auf den deutschen Krimimarkt. Andrea O’Brien hat für ihre Fahnderprofile auf ihrer Website „Krimi-Scout“ auch den Autor interviewt und das Buch besprochen – so etwas, finde ich, sollten viel mehr Übersetzerinnen und Übersetzer wagen, kommen sie einem Buch doch am allernächsten, steigen in jede Falte.
Im Grenzland des Innovativen
Die inzwischen insgesamt sechs Romane um die Polizistin Fiona Griffith sind alles andere als Ware von der Stange, sie sind aufregende Kriminalliteratur im Grenzland des Innovativen, und Harry Bingham ist gewiss nicht der ganz so übliche Ich-schreib-dann-mal-einen-Krimi-Autor. Seine Serie mit Fiona Griffith gehört zur absoluten internationalen Spitzenklasse und zu den besten Kriminalgeschichten der Gegenwart. Bei kaum einem Autor freue ich mich zudem mehr auf die Nachbemerkungen zu seinen Romanen, Harry Bingham hat viele Trümpfe und Überraschungen in seinem Ärmel.

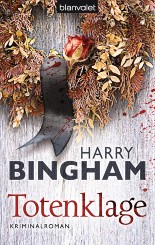 „Das Universum ist voll wundersamer Dinge, die geduldig darauf warten, dass sich unsere Sinne schärfen“, lautet das Motto von „Fiona“. Den Serienauftakt „Totenklage“ (Talking to the Dead, 2012) läutete Harry Bingham mit einem Beckett-Zitat ein: „Zuerst tanzen, später denken.“ (Dance first. Think later. It’s the natural order.)
„Das Universum ist voll wundersamer Dinge, die geduldig darauf warten, dass sich unsere Sinne schärfen“, lautet das Motto von „Fiona“. Den Serienauftakt „Totenklage“ (Talking to the Dead, 2012) läutete Harry Bingham mit einem Beckett-Zitat ein: „Zuerst tanzen, später denken.“ (Dance first. Think later. It’s the natural order.)
„Fiona. Als ich tot war“ ist Band 3 der Serie – und ein bestens geeigneter Einstieg, zudem ein selten intensiver Ausflug in die Welt der undercover-Ermittlungen. Die ersten beiden Fiona-Griffith-Romane, „Totenklage“ (Blanvalet TB 2012; Originaltitel: Talking to the Dead, 2012) und „Totenspiel“ (Blanvalet TB, 2014; Love Story, with Murders, 2013) waren bei uns relativ untergegangen – unverdient. Beides sind Bücher, die es immer noch aufzuspüren lohnt. Brandaktuelle Nachricht von Rowohlt: Nächstes Jahr, 26. Juni, sollen sie einen Neuauftritt im Taschenbuch erhalten, danach soll es sukzessive mit Buch 4 bis 6 weitergehen. Band 3 jetzt lässt sich auch ohne Kenntnis der zwei Vorläufer lesen, noch schöner (und spannender) ist es freilich, Fiona von Anfang an zu folgen.
Sie ist eine Heldin mit begeisternder Resilienz, ebenso verletzlich wie risikobereit, kratzbürstig und seltsam, neugierig und draufgängerisch, dauernd an einem inneren Abgrund. Wenn man sie denn schon mit Stieg Larssons Elisabeth Salander vergleichen will – eine entfernte Verwandtschaft mit Andreas Pflügers blinder Polizistin Jenny Aaron läge da eher näher -, muss dabei unbedingt konstatiert werden, dass Harry Bingham der mit Abstand bessere Stilist und Plotter ist als der skandinavische Brävling. Die Fiona-Bücher entzücken mich als abgebrühten Leser. Dieses innere glückliche Schnauben, dieses freudige „Hah!“, das habe ich bei ihrer Lektüre immer wieder erlebt.
Eine eher marginale Figur in den Mittelpunkt stellen
In seinem früheren Leben war Harry Bingham Investmentbanker bei J.P. Morgan, später bei der europäischen Förderbank für Osteuropa, er hat einige Sachbücher (u.a. das Kapitalismus-Buch „Stuff Matters“) und zwei Schreib-Ratgeber verfasst, betreibt den „Writer’s Workshop“ und organisiert eines der besten Literaturfestivals Englands. Seine Schriftstellerkarriere begann er im Jahr 2001 mit dem Epos „The Money Makers“, vier weitere voluminöse Belletristik-Werke folgten. Dann ist ihm Fiona Griffiths begegnet: „Die meisten Kriminalromane haben Männer mittleren Alters als Helden, Personen von Gewicht und Substanz. Ich wollte das Gegenteil. Fiona ist eine Frau, sie ist klein und jung, sie hat einen niedrigen Dienstgrad und sie arbeitet für die Polizei von Süd-Wales, nicht gerade den Nabel der Welt. Es hat mich interessiert, eine eher marginale Figur in den Mittelpunkt zu stellen und mit ihr all die Themen zu untersuchen, die unser heutiges Leben ausmachen.“
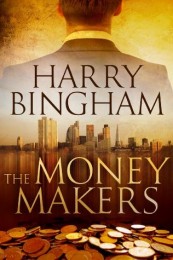 Der Reiz dabei: Zusammen mit Fiona schaut Bingham weit über den Tellerrand der Provinz hinaus. Finanzbetrügereien großen Ausmaßes, Waffenhandel, Menschenhandel, Regierungskriminalität, Geschäfte ohne Rücksicht, Gewalt in vielen Formen, auch ganz banal im Alltag, die normale und die ganz große kriminelle Gier, die Anfälligkeit dafür und wie die Welt sich immer schneller dreht, das alles bildet sich sinnlich ab in Harry Binghams Romanen. Fionas Stimme pulsiert – Übersetzerin Andrea O’Brien, die mit einem Iren verheiratet ist, hat dafür einen pfiffigfen, kraftvollen Sound entwickelt. Das zu lesen, macht gegenüber den vielen blutleeren Übersetzungen, die mir so oft die Füße einschlafen lassen, großen Spaß. Wo zum Beispiel schon habe ich mal jemanden als „Erklärbär“ bezeichnet gesehen? Das ist großartig gelöst (deutsche Ausgabe Seite 66, englische Seite 52).
Der Reiz dabei: Zusammen mit Fiona schaut Bingham weit über den Tellerrand der Provinz hinaus. Finanzbetrügereien großen Ausmaßes, Waffenhandel, Menschenhandel, Regierungskriminalität, Geschäfte ohne Rücksicht, Gewalt in vielen Formen, auch ganz banal im Alltag, die normale und die ganz große kriminelle Gier, die Anfälligkeit dafür und wie die Welt sich immer schneller dreht, das alles bildet sich sinnlich ab in Harry Binghams Romanen. Fionas Stimme pulsiert – Übersetzerin Andrea O’Brien, die mit einem Iren verheiratet ist, hat dafür einen pfiffigfen, kraftvollen Sound entwickelt. Das zu lesen, macht gegenüber den vielen blutleeren Übersetzungen, die mir so oft die Füße einschlafen lassen, großen Spaß. Wo zum Beispiel schon habe ich mal jemanden als „Erklärbär“ bezeichnet gesehen? Das ist großartig gelöst (deutsche Ausgabe Seite 66, englische Seite 52).
Was mir in den Fiona-Romanen wieder und wieder gefällt, das ist die Sache mit der Empathie. Gegenüber Menschen wie auch gegenüber Sachverhalten. Gegenüber dem Zustand unserer Welt. Gegenüber der Macht des Geldes und der Gier. Gegenüber den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen, zwischen Arm und Reich, Provinz und großer Welt. Eigentlich fühlt Fiona ganz wenig – und natürlich gerade dadurch ganz viel, aber eben ganz anders als wir.
Am Ende das zweiten Buches, in dem sich eine sehr scheue Beziehung zu einem Polizistenkollegen entwickelt (die in Band 3 dann Fiona-typisch in Frage gestellt wird), realisiert sie am Buchende, dass etwas an ihr „undicht ist … es fühlt sich an wie die reinste Form von Empfinden, das man schönerweise haben kann, es sind Tränen, die ihr aus den Augen rinnen. Sie ist Fiona Griffiths. Bürgerin des Planeten Normal.“
Mit dem Tod weit mehr Zeit verbracht als die meisten anderen Menschen
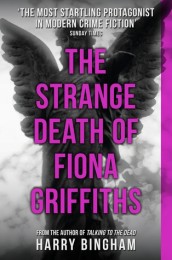
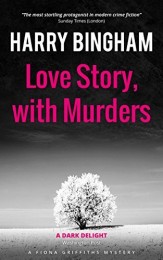 Fiona hat eine – gelinde gesagt – bipolare Störung. Sie leidet am Cotard-Syndrom. Sie sagt von sich – diese Passage ist eine Montage aus den ersten Fiona-Romanen: „Ich habe mit dem Tod weit mehr Zeit verbracht als die meisten anderen Menschen…“ Sie ist gut darin, die Eltern von Mordopfern zu informieren – weil sie „keine normalen Gefühle“ hat. In „Love Story, with Murders“ wie auch in „Talking to the Dead“ schläft sie in der Leichenhalle zwischen den Toten, weil es bei einer Mordermittlung nicht nur um die Suche nach einem Täter geht, sondern auch darum, den Toten ein wenig Frieden zu bringen. „Es ist keine Frage der Gerechtigkeit, die ist den Toten egal … es Teil des Begräbnisritus. Ich bringe den Toten Geschenke im Ausgleich zu dem Frieden, den sie mir geben.“ Ihr Cotard-Punkt tritt auf, wenn zwei tödliche Kräfte aufeinander treffen: Depression und Dissoziation. Das disloziert sie von ihren Gefühlen und macht ihre Welt eintönig grau, versetzt sie zurück ins Teenageralter, macht wieder ein Mädchen aus ihr, das sich nicht fühlen konnte. Ein Mädchen, das das Schlimmste sah und das Schlimmste annahm. In ihr selbst. In allem. Das zwei lange Jahre von sich glaubte, tot zu sein. Cotard-Patienten halten sich für tot, sie können sehen, wie ihr Fleisch verwest und von Maden bevölkert wird. Erstmals beschrieben wurde das Syndrom 1880 vom französischen Neurolgen Jules Cotard (1840–1889), er schilderte den Fall einer 43-jährigen Patientin namens „Mademoiselle X“, sie glaubte, kein Gehirn zu haben und tot zu sein, verlangte deshalb, verbrannt zu werden. Cotard bezeichnete ihren Zustand als „délire des négations“, als wahnhaftenGlaube an die eigene Nicht-Existenz. Man bezeichnet die Krankheit auch „nihilistischer Wahn“ oder als „Walking Corpse Syndrome“.
Fiona hat eine – gelinde gesagt – bipolare Störung. Sie leidet am Cotard-Syndrom. Sie sagt von sich – diese Passage ist eine Montage aus den ersten Fiona-Romanen: „Ich habe mit dem Tod weit mehr Zeit verbracht als die meisten anderen Menschen…“ Sie ist gut darin, die Eltern von Mordopfern zu informieren – weil sie „keine normalen Gefühle“ hat. In „Love Story, with Murders“ wie auch in „Talking to the Dead“ schläft sie in der Leichenhalle zwischen den Toten, weil es bei einer Mordermittlung nicht nur um die Suche nach einem Täter geht, sondern auch darum, den Toten ein wenig Frieden zu bringen. „Es ist keine Frage der Gerechtigkeit, die ist den Toten egal … es Teil des Begräbnisritus. Ich bringe den Toten Geschenke im Ausgleich zu dem Frieden, den sie mir geben.“ Ihr Cotard-Punkt tritt auf, wenn zwei tödliche Kräfte aufeinander treffen: Depression und Dissoziation. Das disloziert sie von ihren Gefühlen und macht ihre Welt eintönig grau, versetzt sie zurück ins Teenageralter, macht wieder ein Mädchen aus ihr, das sich nicht fühlen konnte. Ein Mädchen, das das Schlimmste sah und das Schlimmste annahm. In ihr selbst. In allem. Das zwei lange Jahre von sich glaubte, tot zu sein. Cotard-Patienten halten sich für tot, sie können sehen, wie ihr Fleisch verwest und von Maden bevölkert wird. Erstmals beschrieben wurde das Syndrom 1880 vom französischen Neurolgen Jules Cotard (1840–1889), er schilderte den Fall einer 43-jährigen Patientin namens „Mademoiselle X“, sie glaubte, kein Gehirn zu haben und tot zu sein, verlangte deshalb, verbrannt zu werden. Cotard bezeichnete ihren Zustand als „délire des négations“, als wahnhaftenGlaube an die eigene Nicht-Existenz. Man bezeichnet die Krankheit auch „nihilistischer Wahn“ oder als „Walking Corpse Syndrome“.
Keine langen Rückblenden oder Erklärungen, hier wird nicht gefackelt
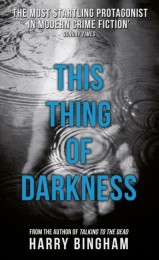
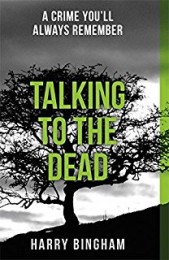 Dieser Zustand aus der traumatischen Kindheit kann immer noch über Fiona schwappen. Jederzeit. Sie sagt über sich: „Es ist einfacher, sich eine Persönlichkeit auszudenken als diejenige zu verstehen, die ich bin.“ Im Studium waren ihr der schottische Philosoph David Hume und dessen Theorie der persönlichen Identität sympathisch. Hume glaubte nicht an ein festes Bild von einem selbst: „Aller Glaube an Tatsachen oder wirkliches Sein stammt lediglich von irgend einem Gegenstand, der dem Gedächtnis oder den Sinnen gegenwärtig ist, und von einem gewohnheitsmäßigen Zusammenhang zwischen diesem und einem anderen Gegenstand.“ Menschen waren ihm nichts weiter als ein Bündel verschiedener Perzeptionen, die schnell aufeinander folgen und ständig im Fluss sind.
Dieser Zustand aus der traumatischen Kindheit kann immer noch über Fiona schwappen. Jederzeit. Sie sagt über sich: „Es ist einfacher, sich eine Persönlichkeit auszudenken als diejenige zu verstehen, die ich bin.“ Im Studium waren ihr der schottische Philosoph David Hume und dessen Theorie der persönlichen Identität sympathisch. Hume glaubte nicht an ein festes Bild von einem selbst: „Aller Glaube an Tatsachen oder wirkliches Sein stammt lediglich von irgend einem Gegenstand, der dem Gedächtnis oder den Sinnen gegenwärtig ist, und von einem gewohnheitsmäßigen Zusammenhang zwischen diesem und einem anderen Gegenstand.“ Menschen waren ihm nichts weiter als ein Bündel verschiedener Perzeptionen, die schnell aufeinander folgen und ständig im Fluss sind.
So könnte man auch Harry Binghams Erzählmethode auf den Punkt bringen. Er langweilt nicht mit langen Rückblenden oder Erklärungen, mit scheinbar leichter Hand bringt er uns Fionas Zustand/ Zustände und ihre Weltsicht näher. Das kann mitten in einem Dialog sein, in kurzen Gedanken seiner Ich-Erzählerin, in scheinbar konfusen Momenten von Verwirrung oder scharfen Bewusstseins. Blicke aus seltsamer Vogelperspektive auf die Welt, dazu ein Erzählduktus mit Rhythmus und Tempo, eine Tour de force, oft ganz wunderbar geschrieben. Die Plots sind plausibel, ohne vorhersehbar zu sein, die Schrauben werden – darauf kann man sich bei Harry Bingham verlassen – deutlich weiter angezogen als in der Konvention. Die Dialoge sind knackig, die Bücher verdienen das Adjektiv „smart“.
Ihr gefährlicher Freund Lev, ein Ex-SpesNaz …
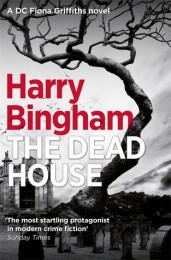
 Und immer wird es auch körperlich, geht es hinaus aus der Stadt und hinein in die Elemente. In Buch 4, „This Thing of Darkness“ heuert Fiona für ihre Form der Gerechtigkeit sogar als Smutje auf einem Trawler an, kommt in wirklich schwere See. In „Love Story, with Murders“ macht sie das Krankenhaus happy, weil sie nach einer irren Auseinandersetzung auf einer einsamen Farm mit Erfrierungen und gleichzeitig Verbrennungen eingeliefert wird. In „Talking to the Dead“ macht sie einen Auftragskiller in Glasgow ausfindig, versteckt sich mit einem Messer unter dessen Bett, schlägt ihn nieder und quetscht ihn aus. In „Als ich tot war“ stellt sie den Bösesten der Bösen, der in ihrem Undercover-Job ihr Chef und Mephisto gewesen war, auf einem Felsabhang und sorgt dafür, dass er „die Fliege macht“. Was das Strafgesetzbuch vorsieht, das ist ihr nicht immer weitreichend und gerecht genug.
Und immer wird es auch körperlich, geht es hinaus aus der Stadt und hinein in die Elemente. In Buch 4, „This Thing of Darkness“ heuert Fiona für ihre Form der Gerechtigkeit sogar als Smutje auf einem Trawler an, kommt in wirklich schwere See. In „Love Story, with Murders“ macht sie das Krankenhaus happy, weil sie nach einer irren Auseinandersetzung auf einer einsamen Farm mit Erfrierungen und gleichzeitig Verbrennungen eingeliefert wird. In „Talking to the Dead“ macht sie einen Auftragskiller in Glasgow ausfindig, versteckt sich mit einem Messer unter dessen Bett, schlägt ihn nieder und quetscht ihn aus. In „Als ich tot war“ stellt sie den Bösesten der Bösen, der in ihrem Undercover-Job ihr Chef und Mephisto gewesen war, auf einem Felsabhang und sorgt dafür, dass er „die Fliege macht“. Was das Strafgesetzbuch vorsieht, das ist ihr nicht immer weitreichend und gerecht genug.
In den ersten beiden Romanen taucht immer wieder ihr gefährlicher Freund Lev auf, Ex-SpesNaz, zwei Jahre in Grosny gewesen, im Tschetschenen-Krieg. Er lehrt ihr Krav Maga, den Kampfsport der israelischen Special Forces: „Maximale Gewalt, maximaler Körperschaden, maximale Bewegungsunfähigkeit. Schnell, fies, endgültig.“
Aber sie ist eben nicht Modesty Blaise, Fiona ist eine junge, kleine, zierliche Frau. Harry Bingham kann das gut, dass uns das Herz pocht und sich die Kehle zuschnürt, wenn da ein Mann mit Axt auf sie zukommt. „Das ist es. Worauf Lev mich vorbereitet hat“, denkt sie. „Einen Kampf bekommst du nie dann, wenn du ihn willst. Und nie bekommst du den Kampf, auf den du dich vorbereitet hast. Du bekommst ihn nur, wenn er dich holt und krallt. Und dieser Moment ist jetzt. Schlachtgesang.“ Dann ist da der Mann mit der Axt, da sind vier Frauen, die gefesselt an Haken hängen, aber sie hat Stahl in ihren Schuhspitzen…. (Lotte Lenya lässt grüßen, wobei hier Arbeitsschuhe mit Stahlkappen genügen.) Und man kann das Schmunzeln nicht unterdrücken, wenn Fionas Vorgesetzter dann ihren Rachefeldzug abschließend ins Bürokraten-Sprech übersetzt: „At least you left something for us to do.“
„Polizeiarbeit ist wie Gerüstbau“
Die Vigilanten-Aspekte in den Fiona-Büchern sollten aber nicht überdecken, dass die Romane des passionierten Felskletterers Bingham auch sehr schöne Polizeiromane sind. „Als ich tot war“ zum Beispiel steigt anschaulich in die verdeckte Ermittlungsarbeit. „Talking to the Dead“ hat auf Seite 135 ein schönes Bild: „Polizeiarbeit ist wie Gerüstbau. Es gibt einen alten Witz, warum eine irische Expedition am Mount Everest scheiterte. Sie hatten kein Gerüstbaumaterial mehr. Ho, ho. Aber genauso würden auch wir Cops das Ding ersteigen. Nur mit dem Unterschied, dass uns das Material nicht ausgehen würde. Wir würden einfach weitermachen, Stange für Stange, Klammer für Klammer. Interviews. Aussagen. Dann Tests. Fingerabdrücke. Eine Million Daten. Tausende Stunden geduldiger, gründlicher Arbeit. Erbarmungslos, methodisch, unausweichlich. Und eines Tages, wenn deine halb erfrorenen Finger ein weiteres Gerüstbrett hochhieven, merkst du, dass der Berg zu Ende ist. Das Sonnenlicht erreicht dich horizontal. Du bist auf dem Gipfel angekommen.“
Fiona pflegt Umgang mit einem im Gefängnis sitzenden korrupten Polizisten, ihr Vater hat (nicht nur) eine Nachtclubvergangenheit, es gibt ganz wunderbar klare Beschreibungen, was in einem Lapdance-Lokal so abgeht. Es gibt einmal ein wunderbares Encounter mit einer lesbischen Chefin, sie entwickelt eine Beziehung zu Buzz, einem Polizisten …. „dating the more-than-slightly crazy daughter of one of Wales’ best-known criminals“. Für eine Undercover-Ermittlung meldet sie sich, weil man sie „wie Dracula nicht im Spiegel sehen kann“, so unscheinbar versteht sie sich zu machen. „Normal zu sein, ist nicht der richtige Zugang“, sagt sie. „Polizeiarbeit bewegt sich immer im Kreis. Die Zeugen bleiben die selben, aber jede Runde bringt dich etwas näher als Ziel.“
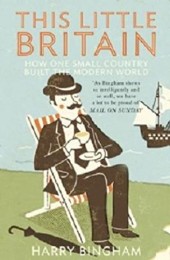 P.S. „Twll din pob Sais“ – Jeder Engländer ist ein Arschloch, heißt es in einem der Fiona-Romane. Bei aller Liebe, Anschaulichkeit und kulturellem Verständnis für Wales, das aus den Zeilen der Fiona-Bücher tritt, gilt festzuhalten, dass Harry Bingham kein Waliser ist und es auch gar nicht sein will. Geboren wurde er in Londons Notting Hill, wuchs in der Nähe des walisischen Bücherdorfes Hay-on-Wye auf, studierte in Oxford und lebt in Oxfordshire. In „Talking to the Dead“ rast Fiona dem Schatten ihres Peugeots in den Sonnenuntergang nach, einem blutigen Finale an einem Leuchtturm entgegen:
P.S. „Twll din pob Sais“ – Jeder Engländer ist ein Arschloch, heißt es in einem der Fiona-Romane. Bei aller Liebe, Anschaulichkeit und kulturellem Verständnis für Wales, das aus den Zeilen der Fiona-Bücher tritt, gilt festzuhalten, dass Harry Bingham kein Waliser ist und es auch gar nicht sein will. Geboren wurde er in Londons Notting Hill, wuchs in der Nähe des walisischen Bücherdorfes Hay-on-Wye auf, studierte in Oxford und lebt in Oxfordshire. In „Talking to the Dead“ rast Fiona dem Schatten ihres Peugeots in den Sonnenuntergang nach, einem blutigen Finale an einem Leuchtturm entgegen:
„Pontardulais. Llanddarog. Carmarthen.
This is real Wales. Deep Wales. Old Wales. This isn’t the Wales created by the Victorians, all iron and coal and ports and factories. This is the Wales of the Celts. Of opposition. Oppositions to the Normans, the Vikings, the Saxons, the Romans. Opposition to the invader. An F-off sign, lasting centuries. Out here, people speak Welsh because they’ve never spoken anything else. Using English marks you out as a foreigner.
St Clears. Llanddewi. Haverfordwest…“
Alf Mayer
Harry Bingham: Fiona. Als ich tot war (The Strange Death of Fiona Griffiths , 2014). Aus dem Englischen von Andrea O’Brien. Wunderlich Verlag, Hamburg 2017. 512 Seiten, 19,95 Euro.
Harry Binghams Internetseite.
The Money Makers (2000)
Sweet Talking Money (2001)
The Sons of Adam (2003)
Glory Boys (2005, dt. Himmelsstürmer)
The Lieutenant’s Lover (2006)
Non-Fiction:
The Little Britain (2007)
Stuff Matters (2010)
Getting Published (2010)
The Writers and Artists Guide to How to Write (2010)
Fiona Grifftiths:
Talking to the Dead (2012, dt. Totenklage, am 26.6. 2018 Neuauflage bei Rowohlt)
Love Story, With Murders (2013, dt Totenspiel, am 26.6. 2018 Neuauflage bei Rowohlt)
The Strange Death of Fiona Griffiths (2014, dt. Fiona. Als ich tot war)
This Thing of Darkness (2015)
The Dead House (2016)
The Deepest Grave (2017)