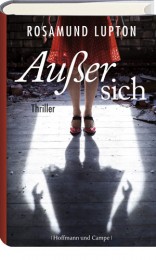 Eine Frau steht neben sich
Eine Frau steht neben sich
– Aufklärerisch tätig sein können eine Menge Entitäten. Tiere, Engel und so … Ein schwebender Geist, eine Seele ohne Körper (bitte komplettieren Sie Ihrer metapyhsischen Grundüberzeugung nach selbst!) oder was immer ist Henrike Heiland in einem Roman von Rosamund Lupton begegnet. Geht nicht? Lesen Sie selbst …
Während des Sportfests fängt die Schule an zu brennen. Zum Glück sind fast alle draußen im Stadion – aber eben nur fast. Jenny, die den Dienst im Erste-Hilfe-Raum übernommen hat, befindet sich im Gebäude. Ohne nachzudenken stürzt sich Grace in die Flammen, um ihre Tochter zu retten. Das Nächste, was Grace weiß: Sie liegt lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Dasselbe gilt für Jenny. Das Feuer hat die beiden fast getötet, ob und wie lange sie noch am Leben bleiben, ist ungewiss. Jenny hat schwere Verbrennungen am ganzen Körper, und Grace hat keine Hirnaktivität mehr.
 Was schwebt?
Was schwebt?
Warum Grace das weiß? Weil sie sich nicht mehr in ihrem Körper befindet. Sie hat ihren Geist, wenn man es so nennen mag, dort rausgezwängt, und jetzt bewegt sie sich, für die anderen unsichtbar, durchs Krankenhaus. Einzig ihre Tochter kann sie sehen, die sich nämlich in demselben außerkörperlichen Zustand befindet. Der noch nicht entschiedene Todeskampf, das buchstäbliche Schweben zwischen Leben und Tod ist die einzige Erklärung, die die beiden haben. Bald schon erfährt Grace, dass ihr kleiner Sohn Adam das Feuer gelegt haben soll, aber sie kann nichts tun, um zu verhindern, dass die Polizei ihm wirklich diese schreckliche Tat zuschreibt.
So weit die Ausgangssituation. Die Erzählperspektive – Grace, die sich außerhalb ihres Körpers befindet – ist gewöhnungsbedürftig. Natürlich kennt man ähnliche Experimente. Es gibt Ich-Erzähler, die sind tot oder liegen im Koma, manchmal sind die Erzähler Tiere oder Frühstückseier oder was nicht noch alles. Das Gewöhnungsbedürftige hierbei ist aber, dass leider nicht alles sehr logisch ist: Grace kann Dinge anfassen, Menschen umarmen, aber sie kann nichts bewegen, wie also kommt sie durch Türen, wie steigt sie in ein Auto? Und wenn sie ohne fremde Hilfe durch Türen kommt, warum kann sie nicht auch durch Wände gehen? Und so weiter. Wer sich gerne über solche Sachen aufregt, fängt besser erst gar nicht mit der Lektüre an. Das zweite, woran man sich gewöhnen muss, ist, dass die Ich-Erzählerin nichts weiter tun kann als zuzuschauen. Und eben erzählen. Ihre große Stunde kommt zum Ende des Buchs, so gesehen stimmt die Dramaturgie, aber bis dahin muss man die Ohnmacht aushalten. Und das wiederum ist etwas, dass das Buch auf eine grausame Art spannend macht. Grace ist dazu verdammt zuzusehen, wie alle Welt glaubt, ihr kleiner, schüchterner, ängstlicher Adam sei ein Feuerteufel und hätte Mutter und Schwester auf dem Gewissen. Sie kann nicht widersprechen. Sie kann keine Hinweise geben, wenn jemand in eine falsche Richtung schlussfolgert. Sie ist machtlos.
Kammerspiel mit Verzweiflung
Gleichzeitig macht diese Ohnmacht etwas mit ihr: Dadurch, dass sie nicht eingreifen kann und dass die Menschen sich von ihr unbeobachtet fühlen, lernt sie sie zum ersten Mal richtig kennen. Sie versteht, was für ein Mensch ihre Schwägerin, die sie für eine perfektionistische Musterpolizistin gehalten hatte, wirklich ist. Sie erfährt Dinge, die ihr ihre Tochter verschwiegen hat. Sie muss ihre Meinung vom Freund ihrer Tochter völlig revidieren. Sie findet heraus, welches Geheimnis ihre beste Freundin seit Jahren mit sich herumträgt. Kurz: Grace bekommt auf alles eine neue Sicht. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen, um nach vielen falschen Vermutungen ein erschütterndes Gesamtbild zu ergeben.
Die ganze Geschichte ist fast ein Kammerspiel. Neben dem Krankenhaus, in dem Grace und Jenny behandelt werden, gibt es noch ein paar wenige weitere Schauplätze, die aber nicht über einen sehr begrenzten Rahmen hinausgehen. Auch thematisch erscheint die Geschichte recht klein, geht es doch letztlich nur um eine Mutter, die ihren Sohn schützen und ihre Tochter retten will. Ein Familiendrama? In Wirklichkeit ist es noch enger gesteckt, denn es ist das Drama einer Mutter, die miterleben muss, wie nichts mehr so ist, wie sie es einmal kannte. Gleichzeitig steckt in diesem Mikrodrama die ganze Welt, jedenfalls für Grace und ziemlich schnell auch für die Leser. Hier braucht es kein Blut, keine Folter, keine Verfolgungsjagden, es muss auch nicht gleich der ganze Planet gerettet oder der Vatikan gesprengt werden. Er reicht die Verzweiflung einer Mutter, die nichts für ihre Kinder tun kann, um die Spannung bis zum Ende zu halten.
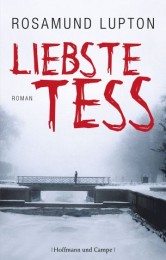 Genre, Label, egal …
Genre, Label, egal …
„Außer sich“ ist Rosamund Luptons zweites Buch – wie auch schon „Liebste Tess“, ihr Debüt, gelabelt mit „psychologischer Thriller“, was bitte nicht mit den Fitzek’schen „Psychothrillern“ verwechselt werden darf. Auch wenn sich diese ganzen Labels gerade furchtbar schlecht erschließen und ein wahres Definitionschaos auslösen. Es ist kein Buch, dass das Genre umkrempeln und neue Wege aufzeigen wird, nichts, an dem man sich noch Tage nach dem Lesen abarbeiten will, aber eine packende, sehr emotionale (teils vielleicht auch etwas zu gefühlige), gut gemachte Geschichte.
Henrike Heiland
Rosamund Lupton: Außer sich. (Afterwards, 2011) Roman. Deutsch von Barbara Christ. Hamburg: Hoffmann und Campe 2012. 429 Seiten. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Webseite der Autorin. Autorin bei Richard and Judy im Interview. Wie Lupton zu ihrem ersten Buch kam … Homepage von Henrike Heiland.











