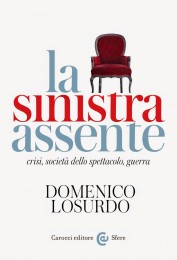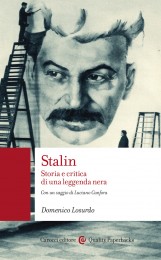Zur Ideologie der Gewaltlosigkeit
Zur Ideologie der Gewaltlosigkeit
Der Freiheitskämpfer ist – nicht nur in südafrikanischen Kriminalromanen – eine beliebte Figur, deren Gewaltaffinität, ob nun überwunden oder nicht, manche Handlung vorantreibt, etwa bei Niq Mhlongo oder Deon Meyer. Natürlich hat das alles seinen philosphischen Hintergrund. Der italienische Philosoph und politische Aktivist Domenico Losurdo hat sich damit in seiner Studie „Gewaltlosigkeit. Eine Gegengeschichte“ beschäftigt. Mit seinem Buch „Stalin. Geschichte und Kritik einer schwarzen Legende“ hatte Losurdo sich vor allem linker Kritik ausgesetzt, eine gewisse Staatsgläubigkeit scheint auch in seiner auf Italienisch 2011 erschienenen und jetzt bei uns vorliegenden Monographie zur Gewaltlosigkeit auf (La non-violenza. Una storia fuori dal mito), mit der Elfriede Müller sich für CrimeMag auseinandersetzt. Gewisse banale Schlussfolgerungen am Ende, findet sie, trüben nicht die Erkenntnisse, die sich bei konzentrierter Lektüre über ein politisch nicht unbedingt auf der Hand liegendes Thema einstellen.
Losurdo verbindet mit seiner Untersuchung eine grundsätzliche Kritik am Liberalismus und dem Gebrauch und der Instrumentalisierung dessen, was als „gewaltloser Widerstand“ bezeichnet wird. Intelligent weist Losurdo nach, dass sämtliche Vertreter von Gewaltlosigkeit in bestimmten Situationen Gewalt als politisches Mittel nicht ausschlossen, bzw. wie im Fall von Gandhi, diese sogar propagierten und politisch in Kauf nahmen. Ausgehend von der These, dass das Versprechen des ewigen Friedens nicht eingelöst wurde, analysiert Losurdo, warum dies nicht geschah. Weder die verschiedenen Revolutionen unter sozialistischen Vorzeichen haben dies erreicht, noch der Liberalismus, den das propagierte Ende der Geschichte als definitive Gesellschaftsform ausgerufen hat.
Ghandis langer Weg
Angefangen beim Kampf gegen die Sklaverei in den USA, der auch viele Vertreter der Gewaltlosigkeit angezogen hatte, unterstützten diese jedoch in den meisten Fällen schließlich den Sezessionskrieg, nachdem die Sklavenhalter die Waffen in die Hand nahmen und ihren Status militärisch verteidigten. Ausgehend von den USA, bestimmt dann der antikoloniale Unabhängigkeitskampf einen großen Teil des Bandes und bildet damit auch einen wichtigen Beitrag zu den Postcolonial Studies. Am ausführlichsten beschäftigt sich Losurdo in seiner Studie mit der widersprüchlichen Persönlichkeit Gandhis und dessen Entwicklung vom Rekrutierer für das Empire zum erklärten Pazifisten. Losurdo beschreibt auch die Kriege des Britischen Empires und vor allem die grausame Niederschlagung von Aufständen wie dem Boxer-Aufstand in China und dem Sepoy-Aufstand in Indien. Gandhi trat zunächst in Südafrika für die Niederschlagung des Zulu-Aufstands ein und hielt die Inder für Arier, weshalb er sie zu Briten machen wollte und sie von den Schwarzen abgrenzte. Er legte einen langen Weg zurück, bis er sich als vegetarischer religiöser Prophet zum Anführer der Inder gegen den britischen Imperialismus entpuppte. Lange Zeit äußerte Gandhi keinerlei Kritik an der kolonialen Herrschaft, noch hatte er einen Plan zur Emanzipation. Als religiöser Führer verurteilt Gandhi Gewalt als eine dem Westen innen wohnende Eigenschaft, die das indische Volk überwinden könne.
Beim Vergleich mit Tolstoi schneidet letzterer besser ab, weil Tolstoi Losurdo zufolge ein weit konsequenterer Vertreter der Gewaltlosigkeit gewesen sei, der die soziale Frage immer mit gedacht habe. Tolstoi lehnte den russischen Imperialismus von Grund auf ab und begrüßte 1905 die „friedensfördernden Sowjets von Petersburg“, wie er auch das Blutbad der Versailler Truppen gegen die Pariser Kommune verurteilte. Tolstoi verachtete Militarismus und Kolonialismus gleichermaßen, worin Losurdo einen aktuellen Anknüpfungspunkt erkennt, wenn er in seinem Fazit zur Entwicklung neuer antimilitaristischer Bewegungen aufruft.
Losurdo vergleicht Gandhi mit der sozialistischen Bewegung, die ebenfalls gewaltförmige Verhältnisse abschaffen wollte, ohne dass ihr das bis heute gelungen wäre, genauso wenig wie in Indien eine gewaltfreie Gesellschaft entstanden ist. Den Antimilitarismus der Sozialisten stellt der Autor der langen Identifikation Gandhis mit dem Britischen Empire gegenüber. Kautskys und Lenins Ablehnung der Sklaverei und Zwangsarbeit gingen mit ihrer Verachtung der kolonialen Gewalt einher, die vor allem Lenin mit der Dritten Internationale bekämpfen wollte. Die Sozialisten bzw. Kommunisten sahen in der revolutionären Gewalt die Möglichkeit, die Gewalt des Krieges zu bekämpfen, d. h. die Regierungen zu stürzen, die für die jeweiligen Kriege verantwortlich waren. Während der späte Gandhi dem Krieg mit Gewaltlosigkeit gegenübertritt, halten die Sozialisten die revolutionäre Gewalt für ein überzeugenderes Mittel.
Losurdo schlägt die Dichotomie Kooptation/Emanzipation als Interpretationskriterium vor, die seit der Französischen Revolution in die Debatte geworfen wird. Statt Emanzipation und Gewaltlosigkeit plädierten vor allem die englischen Liberalen für eine Kooptation der Volksmassen, was natürlich die Teilnahme an den Kriegen des Empires beinhaltete. Das Kooptationsmodell galt sowohl für die Einwohner der Kolonien als auch für die britischen Arbeiter. Lenin entwickelte daraus seine Metapher der Arbeiteraristokratie, die in die herrschende Klasse im Westen auf Kosten von Kriegen und kolonialer Ausbeutung integriert wurde. Gandhi hatte zunächst das indische Volk dazu aufgerufen, sich in den Kriegen des Britischen Empire den „rassischen“ Aufstieg zu verdienen und strebte Losurdo zufolge zunächst eine Kooptation an. Erst nach diesem gescheiterten Versuch erkämpfte er die Anerkennung im Rahmen der antikolonialistischen Bewegung, zu der auch die Sozialisten gehörten. Die propagierte Gewaltlosigkeit Gandhis wird beim Salzmarsch zur routinierten politischen Taktik, dies mit dem Ziel, weltweit moralische Empörung hervorzurufen. Gandhi selbst beschreibt den Salzmarsch 1931 in einer Rede folgendermaßen: „Es ist ein Kampf, um das Leben hinzugeben, nicht um es zu erhalten.“ Gandhis berühmtes Mantra lautete von nun an: „Handeln oder sterben“. Manchmal wurde in Indien aber auch durch Handeln gestorben. Gandhis Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit schloss die Möglichkeit, an einem bewaffneten Konflikt teilzunehmen, nicht aus. Dass die indische Unabhängigkeit 1947 erlangt wurde, lag weniger an der religiösen Propaganda der Gewaltlosigkeit als an der internationalen Konstellation nach der Niederlage des Dritten Reiches und den in Gang gesetzten antikolonialistischen Bewegungen.
 Das Gewinnen von Selbstachtung
Das Gewinnen von Selbstachtung
Martin Luther King, ein weiterer Vertreter des gewaltlosen Widerstandes, wird Gandhi positiv gegenüber gestellt. King vertrat einen „realistischen Pazifismus“ und war auch kein Prediger der Sinneskontrolle wie Gandhi. Angesichts der Tatsache, dass die Afroamerikaner nur ein Achtel der Bevölkerung stellen, war die Gewaltlosigkeit Kings auch eine realistische Einschätzung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses. Es ist vor allem Kings politische Entwicklung, die Losurdo als eine aufsteigende Kurve der Bewusstseinsbildung in der Frage der Gewalt beschreibt: King schließt Fälle von gerechtfertigter Gewalt von unten nicht aus, wie im Fall von Südafrika gegen die Apartheid oder im Zweiten Weltkrieg. Das Scheitern des amerikanischen Traums führte Losurdo zufolge zum Traum der Dritten Welt, der „Gewinnung von Selbstachtung“, wie es Frantz Fanon formulierte. Für Gandhi wie Fanon galt, dass die aktive bis heldenhafte Teilnahme am bewaffneten Kampf die Bedingung war, diese Anerkennung erringen zu können. Fanon richtete sie gegen die Kolonialherren, Gandhi gegen die Feinde des Empires, dessen Anerkennung er erringen wollte.
Losurdo weist Hannah Arendts Kritik der antikolonialen Befreiungsbewegung und der „Black Panther“-Bewegung als blinden Gewaltkult zu Recht zurück. Gerade Fanon hatte formuliert, dass Hass, Rache und Ressentiment keinen Befreiungskampf schüren können. Weder die „Black Panther“ noch Fanon forderten je das Verschwinden der weißen amerikanischen bzw. der französischen Bevölkerung in Algerien, wie es ihnen Arendt unterstellte. Sie habe, so wirft ihr Losurdo vor, die schwarze Emanzipation nur im Sinne der Kooptation statt im Sinne der Emanzipation gedacht. Der Vietnamkrieg hatte den Zusammenhang zwischen der in Asien entfesselten Gewalt und der Gewalt gegen Afroamerikaner in den USA deutlich werden lassen und vereitelte auch jeden Versuch, einen Sozialstaat aufzubauen. Die Politik der Kooptation statt Emanzipation lässt Losurdo zufolge die Gewalt irrationaler werden, aber keinesfalls verschwinden. In der Suche nach Kooptation erkannte auch Fanon die Quelle des Selbsthasses, der Frustration und des Ressentiments der Afroamerikaner.
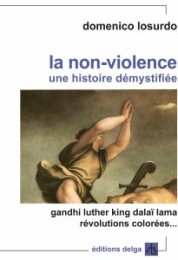 Das autonome Tibet als Gebetsmühle
Das autonome Tibet als Gebetsmühle
Interessant ist die zentrale These Losurdos, dass die Apostel der Gewaltlosigkeit als Kontrapunkt zu den Vertretern der revolutionären Bewegungen dienten, vor allem bei den antikolonialistischen Bewegungen. Gandhi wurde in der liberalen Argumentation gegen Ho Chi Minh, Castro, Lumumba u. a. gestellt. Unter Auslassung bestimmter Positionen wurden auch Martin Luther King und Tolstoi den Gewaltlosen zugeordnet. Bei King fällt seine Kritik des Vietnamkrieges, sein Aufruf zur Umverteilung und seine Verbundenheit mit dem Kommunisten Du Bois in dieser Argumentation hinten runter. Als Farce der gewaltlosen Vertreter erscheint schließlich eine in der aktuellen Politik relevante Figur: der Dalai Lama. Losurdo erzählt ausführlich die gewaltvolle, feudale und bis heute religiös geprägte Geschichte Tibets, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrang. Wenig bekannt ist auch die wichtige Rolle, die Tibet im Kalten Krieg gegen das rote China spielte. In der aktuellen politischen Debatte kommt Gewalt in Tibet nur von außen, als Resultat der chinesischen Invasoren. Das in westlichen Medien verherrlichte „einfache Leben“ sei, so der Autor, ein klassischer Gemeinplatz des konservativen Denkens. Das autonome Tibet als erfundene Tradition des Kalten Krieges schafft es bis heute in die Schlagzeilen und in die politische Kultur des Liberalismus. Man erinnere sich an einen der vielen Besuche des Dalai Lama in der Bundesrepublik, etwa als der Friedensnobelpreisträger Claudia Roth einen Schal schenkte, den diese stolz als Symbol für ein autonomes Tibet lange demonstrativ in der Öffentlichkeit zur Schau stellte. Die Geschichte des modernen Tibet verdeutlicht, dass der Zusammenbruch des lamaistischen Tibet alles andere bedeutete als das Eindringen von Gewalt in eine gewaltlose Gesellschaft, sondern auch den Ansatz einer Überwindung repressiver, religiöser Kasten und Stände.
Nur unterschiedliche Formen der Gewalt
Losurdo zufolge ist die große Erzählung der Gewaltlosigkeit längst in die aktuelle Kriegsideologie integriert. Die Freunde des westlichen Liberalismus werden zu Vertretern der Gewaltlosigkeit stilisiert, während die Gegner zur Repräsentanten der Gewalt auserkoren werden: „Die ‚Gewaltlosigkeit’ hat sich von einer Waffe der Schwachen in eine weitere Waffe der Mächtigen und Übermächtigen verwandelt, die auch außerhalb der UNO entschlossen sind, das Recht des Stärkeren geltend zu machen.“ Heute gehe die Proklamation der Gewaltlosigkeit Hand in Hand mit der Glorifizierung des westlichen Liberalismus, der sich durch Embargos und „humanitäre Kriege“ ermächtigt fühlt, die Welt zu destabilisieren und manchmal auch Staatsstreiche zu motivieren und zu unterstützen.
Das Fazit lautet, dass wir in Wahrheit nur zwischen unterschiedlichen Formen von Gewalt zu wählen haben, dass gewaltförmige Verhältnisse Gewalt hervorbringen. Wie Gandhi mit seiner politischen Taktik sich und die von ihm angeführte Bewegung der Gewalt der Gegner aussetzte, war eine Methode moralische Empörung hervorzurufen, die bewusst Opfer in Kauf nahm, aber keine prinzipielle Gewaltlosigkeit. Für heutige Revolutionen, zukünftige Aufstände und Widerstand bedeutet das, sich auf Gewalt einzustellen, sich ihr nicht instrumentell auf eigene Kosten auszusetzen und vor allem, sie nicht zu reproduzieren und damit die Emanzipation aufs Spiel zu setzen. Eine Herkulesaufgabe, die eine weitere große Erzählung des 21. Jahrhunderts werden könnte.
Elfriede Müller
Domenico Losurdo: Gewaltlosigkeit. Eine Gegengeschichte (La non-violenza. Una storia fuori dal mito; 2011). Aus dem Italienischen von Erdmute Brielmayer. Argument Verlag, Hamburg 2015. 270 Seiten. 33,00 Euro.
Verlagsinformationen zum Buch hier. Zum Blog von Domenico Losurdo hier.