 About Crime Fiction
About Crime Fiction
Hinweise zur Sekundärliteratur von Thomas Przybilka
(Lieferung No. 64, Juni 2016 – Dezember 2016)
Seit Jahren bibliografiert, archiviert und kommentiert der Ehrenglauser-Preisträger Thomas Przybilka in seinem BoKAS (= Bonner Krimi-Archiv Sekundärliteratur) wissenschaftliche und publizistische Arbeiten aus aller Welt, die sich mit den unendlichen Facetten von Kriminalliteratur befassen. In unregelmäßig regelmäßigen Abständen erscheinen dann seine unschätzbar wertvollen Zusammenfassungen der aktuellen Sekundärliteratur, die jeder zur Kenntnis nehmen muss, der sich auch nur ein bisschen über seine Lieblingsliteratur kundig machen möchte. Ein solcher „Newsletter“ hat leicht einmal 160 bis 200 Seiten; deswegen empfiehlt CrimeMag unregelmäßig ein paar Titel aus dieser Fülle, die uns besonders bemerkenswert erscheinen.
Bibliographien, Nachschlagewerke, Referenzliteratur, Aufsätze
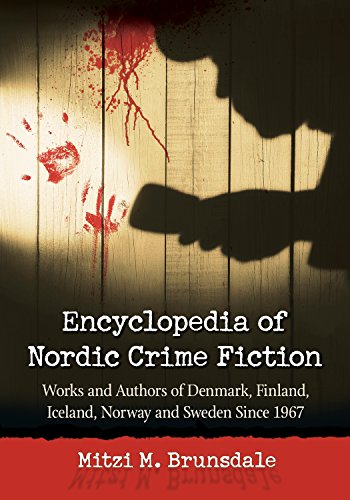 Brunsdale, Mitzi M.: Encyclopedia of Nordic Crime Fiction. Works and Authors of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Since 1967. 2016, 572 S., McFarland & Company, US $ 65,00
Brunsdale, Mitzi M.: Encyclopedia of Nordic Crime Fiction. Works and Authors of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Since 1967. 2016, 572 S., McFarland & Company, US $ 65,00
Einen wahren Fundus an Informationen zum skandinavischen Krimi hat Mitzi M. Brunsdale in ihrer jüngsten Veröffentlichung zusammengetragen. Nicht nur Europa wurde spätestens seit dem Erscheinen der Krimis von Henning Mankell mit skandinavischer Kriminalliteratur geradezu überschwemmt. Die Welle schwappte auch bis in die USA. Als Ausgangspunkt für ihre Darstellungen hat die Autorin die späten 60er-Jahre gewählt, dem Erscheinungszeitraum der Sozio-Krimis von Sjöwall/Wahlöö um Kommissar Beck, die für die internationale Kriminalliteratur wegweisend waren (und häufig noch sind). Mit der „Encyclopedia of Nordic Crime Fiction“ hat Mitzi M. Brunsdale nicht nur eine mehr als arbeits- und recherchemäßige Übersicht und Analyse, sondern gleichzeitig auch das englischsprachige Nachschlagewerk zur skandinavischen Kriminalliteratur vorgelegt – Chapeau. Die einzelnen Länderabschnitte sind klug gegliedert. Eingeführt wird jeweils mit einer Abhandlung „The Cultural Context of … Fiction“ mit ausführlichen Hinweisen zur Literaturhistorie des jeweiligen Landes (sozialer und kultureller Hintergrund), gefolgt von einer Aufstellung der Krimipreise (Vergabejahr, Autor, Titel – ggf. vorliegende englischsprachige Übersetzung). Diese Aufstellung wird ergänzt durch „A Parallel Chronology of … Literature and World Events“. Es folgen dann wiederum ausführliche Darstellungen zu den einzelnen Autoren („Contemporary … Authors of Crime Fiction“) in autorenalphabetischer Reihenfolge (beigefügt Lebensdaten, Wohnort, etc). Der Würdigung der einzelnen Autoren schließt sich eine Bibliographie der erschienenen Krimis/Thriller (auch hier werden die englischsprachigen Übersetzungen aufgelistet) nach Erscheinungsjahr an (teilweise gegliedert nach Serien). Den Abschluss bilden Hinweise auf die wichtigsten zuerkannten Preise und zur Homepage des Autors. Berücksichtigung finden natürlich auch Verweise auf Kurzkrimi-Anthologien und auf Kriminalromane/Thriller, die zwar in dem jeweiligen Land angesiedelt sind, nicht aber von skandinavischen Autoren geschrieben wurden. Ergänzt wird dieses herausragende Nachschlagewerk durch eine sehr umfangreiche Aufstellung weiterführender Literatur (Ländergliederung). Erschlossen wird das Werk durch einen Autoren- und Titelindex. Wer die bisherigen Veröffentlichungen von Mitzi M. Brunsdale kennt, wird das sehr zu empfehlende vorliegende Werk als unverzichtbares Nachschlagewerk wie auch als höchst interessante Lektüre zu schätzen wissen.
Inhalt:
Preface / Introduction / Denmark / Finland / Iceland / Norway / Sweden / Works Cited / Index.
Mitzi M. Brunsdale ist emeritierte Professorin für Englisch aneiner kleinen Universität in North Dakota und war Lehrbeauftragte für Englisch an der North Dakota State University in Fargo. Neben zahlreichen Essays zur Kriminalliteratur liegen von Mitzi M. Brunsdale als Veröffentlichungen vor: „Gumshoes. A Dictionary of Fictional Detectives“, „Icons of Mystery and Crime Detection. From Sleuth to Superheroes“ (2 Bände) und „Dorothy L. Sayers. Solving the Mystery of Wickedness“. (tp) KTS 64
 Geherin, David: Small Towns in Recent American Crime Fiction. 2015, 191 S., McFarland & Company, US $ 40,00
Geherin, David: Small Towns in Recent American Crime Fiction. 2015, 191 S., McFarland & Company, US $ 40,00
Die Anonymität, die den Verbrecher in urbanen Metropolen mehr oder weniger schützt, gibt es im ländlichen Raum, in kleinen Gemeinden und Ortschaften nicht. Der gesichtslose Verbrecher findet hier schwer einen Rückzugsort. Jeder kennt jeden, jeder weiß, wie der andere tickt. Im ruralen Raum muss Dieb, Einbrecher, Erpresser oder Mörder wesentlich cleverer vorgehen, muss klug bezirzen und gekonnt übertölpeln, seine eventuellen psychologischen Spielchen und Tricks sollten Tiefe haben und auf Langlebigkeit ausgerichtet sein. Sollten – in die Fänge der Ermittler wird er dennoch geraten. „Small Town Cops“ agieren ähnlich wie der zu Verfolgende. Auch sie kennen (fast) jeden, wissen, wie (fast) jeder tickt. Am Ende klicken immer die Handschellen, garantiert. Dennoch, die kleine Gemeinde oder Ortschaft garantiert schon lange nicht mehr eine Gemütlichkeit à la Miss Marple. Einige amerikanische Krimiautoren lassen ihre Ermittler oftmals zweigleisig dem Verbrechen entgegentreten. Aus den großen Ballungsräumen (z.B. Atlanta von Karin Slaughter) lassen sie andere, clevere Polizeiermittler oder Sheriffs in überschaubarer Umgegend kleiner Kommunen im ländlichen Raum ermitteln (z.B. Heartsdale bei Karin Slaughter). Und zwar genauso kreativ wie in den Metropolen. David Geherin hat sich für seine Analyse 10 bekannte amerikanische Krimiautoren ausgesucht und die Ermittlungen ihrer Protagonisten beleuchtet. Seine Untersuchung in „Small Towns in Recent American Crime Fiction“ wird durch eine ansprechende Bibliographie der Primärliteratur der ausgewählten Autoren (im Zeitraum 1972 bis 2013) und eine ebenfalls ansprechende Bibliographie der Sekundärliteratur sowie einen Index ergänzt.
Inhalt [Ortsnamen von tp]:
Preface / Introduction / K.C. Constantine [Rocksburg, Pennsylvania] / Daniel Woodrell [West Table, Missouri] / Dana Stabenow [Niniltna, Alaska] / Nevada Barr [verschiedene Nationalparks] / William Kent Krueger [Aurora, Minnesota] / Steve Hamilton [Paradise, Michigan] / P.L. Gaus [Millersburg, Ohio] / Karin Slaughter [Heartsdale, Georgia] / Julia Spencer-Fleming [Millers Kill, New York] / Craig Johnson [Durant, Wyoming] / Additional Readings / Bibliography / Index.
David Geherin ist emeritierter Professor für Englisch an der Eastern Michigan University. Bei McFarland & Company liegen von David Geherin vor: „The Dragon Tattoo and Its Long Tail: The New Wave of European Crime Fiction in America“ (2012) und „Scene of the Crime: The Importance of Place in Crime and Mystery Fiction“ (2008). Er ist Autor weiterer Bücher zur Kriminalliteratur, von denen zwei für den Edgar Allan Poe Award der Mystery Writers of America nominiert waren. David Geherin lebt in Ypsilanti, Michigan/USA. (tp) KTS 64
 Hall, Katharina (ed): Crime Fiction in German. Der Krimi. 2016, 167 S., 1 Karte German-speaking Areas in Europe, University of Wales Press (European Crime Fictions), Hardcover £ 75,00 // Paperback £ 24,99
Hall, Katharina (ed): Crime Fiction in German. Der Krimi. 2016, 167 S., 1 Karte German-speaking Areas in Europe, University of Wales Press (European Crime Fictions), Hardcover £ 75,00 // Paperback £ 24,99
Bereits seit Jahren angekündigt, liegt jetzt in der Reihe „European Crime Fictions“ der Band zum deutschsprachigen Kriminalroman vor, herausgegeben von Katharina Hall, ausgewiesene und international bekannte Krimiexpertin an der Swansea University. Neben Katharina Hall sind es fünf weitere Beteiligte, die mit ihren insgesamt acht Essays einen so umfassenden wie kritischen Blick auf die deutschsprachige Kriminalliteratur werfen. Für Leser und Krimi-Interessierte in der englischsprachigen Welt wird mit „Crime Fiction in German. Der Krimi“ endlich eine bis dato nur leicht angelehnte Tür weit geöffnet. Die Analyse geht von den Anfängen des deutschsprachigen Krimis über die NS-Zeit, die Zeit des Kalten Krieges bis hin zu den diversen Gruppierungen und Subgenres der zeitgenössischen Kriminalliteratur. Der „Afrika-Krimi“, Frauenkrimi, Soziokrimi oder der historische Kriminalroman, um nur wenige Stichworte zu nennen, mit ihren bekannten wie auch weitgehend weniger bekannten Autorinnen und Autoren finden hier ebenfalls Berücksichtigung. Selbstverständlich wird auch ein Blick auf die vielen Fernsehkrimis in Deutschland geworfen. Eingeleitet wird „Crime Fiction in German“ von einer Übersichtskarte Deutschlands, dem kleinen deutschsprachigen Teil Belgiens, Luxemburgs, der Schweiz, Liechtensteins und Österreichs. Eine clevere Ergänzung findet sich in einer Synopse „Key historical, political, criminal events“ zu „Key publishing milestones, primary texts, trends“, beginnend mit dem Jahr 800 und endend mit dem Jahr 2015. Jede Betrachtung wird mit einer umfangreichen Aufstellung von Fußnoten und weiterführender Literatur abgeschlossen. Ergänzend ist auch ein (englischsprachiger) Auszug aus dem Kriminalroman eines ausgewählten, im jeweiligen Kapitel behandelten Autors beigefügt. Erfreulich ist auch das abschließende Kapitel mit einer kommentierten Bibliographie weiterführender Literatur zu Archiven und Bibliographien, von Buchpublikationen, Zeitschriften- und Magazinartikeln sowie wichtigen Websites. Ebenso umfangreich ist das Autoren-, Personen-, Stichwort- und Titelregister. „Crime Fiction in German. Der Krimi“ ist auch deutschen Lesern und Krimifreunden herzlich empfohlen, um den einen oder anderen Aspekt dieses populären Genres zu vertiefen oder auch, um Entdeckungen zu machen.
Inhalt:
Map of German-speaking Areas in Europe / Chronology of Crime Fiction in German.
— Katharina Hall: Crime Fiction in German. Concepts, Developments and Trends (Der Krimi / The pioneers (1828-1933) / Crime fiction under National Socialism (1933-45) / Early post-war crime narratives (1945-60) and East German crime fiction (1949-71) / The West German „Soziokrimi“ (1960-) and later East German crime fiction (1971-89) / Turkish-German crime fiction and the „Frauenkrimi“ (1980-) / Historical crime fiction, regional crime fiction and the rise of the „Afrika-Krimi“ (1989-) / Crime fiction of the new millennium and the lacuna of Jewish-German crime fiction).
— Mary Tannert: The Emergence of Crime Fiction in German. An Early Maturity.
— Marieke Krajenbrink: Austrian Crime Fiction. Experimentation, Critical Memory and Humour (Literary experimentation with the crime genre. Handke, Roth, Lebert and Jelinek / Crime writing since 1995. Haslinger, Haas, Steinfest, Hochgatterer).
— Martin Rosenstock: Swiss Crime Fiction. Loosli, Glauser, Dürrenmatt and Beyond (The beginnings of Swiss crime fiction / Carl Albert Loosli / Friedrich Glauser / Friedrich Dürrenmatt).
— Julia Augart: „Der Afrika-Krimi“. Africa in German Crime Fiction (The German Afrika-Krimi and its development / The constituent elements of the German Afrika-Krimi / Conclusion).
— Faye Stewart: „Der Frauenkrimi“. Women’s Crime Writing in German (Literary and publishing contexts).
— Katharina Hall: Historical Crime Fiction in German. The Turbulent Twentieth Century (The forms and functions of historical crime novels in German / Hans Fallada’s „Jeder stirbt für sich allein [Alone in Berlin] / Simon Urban’s „Plan D“).
— Katharina Hall: „Der Fernsehkrimi“. An Overview of Television Crime Drama in German.
— Katharina Hall: Annotated Bibliography of Resources on German-language Crime Narratives.
Index.
Katharina Hall ist Associate Professor für Deutsch an der Swansea University. Ihr international ausgerichteter Krimiblog unter ihrem alias „Mrs. Peabody Investigates“ (s.u.) ist ebenfalls meine Empfehlung! (tp) KTS 64
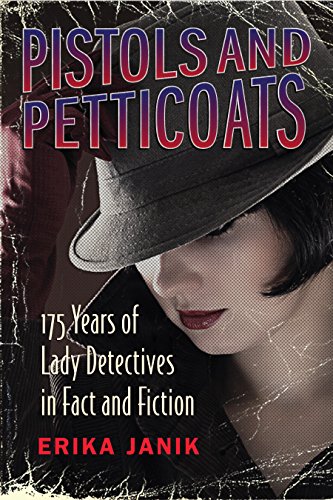 Janik, Erika: Pistols and Petticoats. 175 Years of Lady Detectives in Fact and Fiction. 2016, 238 S., 18 Abbildungen, Beacon Press, Hardcover US $ 25,95 // Paperback US $ 18,00
Janik, Erika: Pistols and Petticoats. 175 Years of Lady Detectives in Fact and Fiction. 2016, 238 S., 18 Abbildungen, Beacon Press, Hardcover US $ 25,95 // Paperback US $ 18,00
Das Medienecho war immens, als Alice Clement 1913 ihren Dienst als eine von zehn weiblichen Ermittlern bei der Polizei in Chicago antrat. Aufgrund ihrer Erfolge wurde Alice Clement schon bald Chicagos „female Sherlock Holmes“ genannt. Drei Jahre zuvor war es Alice Wells, die als einzige Polizistin im männlich dominierten Los Angeles Police Department ihren Eid ablegte. Auch dies war ein mediales Ereignis. Polizeiarbeit jener Zeit war eine männliche Domäne, und dass Frauen ihrem Dienst auf der Straße nachgingen, mit Betrügern, Betrunkenen, Prostituierten oder Einbrechern konfrontiert wurden, ging nicht so recht in die Köpfe der Bevölkerung ein. Alice Wells, unbewaffnet, ihre Polizeimarke unsichtbar für ihre Klientel in der Handtasche verborgen, war äußerst erfolgreich. So erfolgreich, dass sie anderen Frauen Mut machte, den Beruf als Detective zu ergreifen, trotz Schikane und Diskriminierung durch ihre männlichen Kollgen. Sie wurde das Aushängeschild und Sprachrohr der ersten weiblichen Polizisten der USA. Erika Janik nutzt in „Pistols and Petticoats“ geschickt die Geschichte realer weiblicher Ermittler des 19. und 20. Jahrhunderts, um auf die Entwicklung der Kriminalliteratur überzuleiten. Ihre Schwerpunkte sind Kriminalromane und Thriller, die von Frauen für Frauen geschrieben wurden. Ausgangspunkt ihres Diskurses zum „Frauenkrimi“ sind die Kriminalromane von Anna Katherine Green, gern als die „Mother of Detective Fiction“ bezeichnet. Ihre (Privat)-Ermittlerinnen betraten lange vor Agatha Christies Miss Marple die literarische Bühne – die Damen des „London Detection Club“ von 1930 hielten übrigens große Stücke auf ihre amerikanische Kollegin! Von Anna Katherine Green über die Jugenddetektivin Nancy Drew bis Kay Scarpetta, Sue Grafton, Sara Paretsky und anderen reicht Erika Janiks Analyse. Kurze Abstecher unternimmt die Autorin auch in die Welt der weiblichen TV-Ermittler, wie z.B. Olivia Benson („Law & Order“) oder „Rizzoli and Isles“. Die Hinweise zu weiterführender Literatur, integriert im Teil Anmerkungen, sind überaus umfangreich. Ein Personen-/Titel-/Sachregister erschließt „Pistols and Petticoats“.
Inhalt:
Detecting Women / Sleuths in Skirts / Sisterhood Behind Bars / Spinster Sleuth / The First Policewoman / Girl Detectives / Breaking Through the Ranks / Hard-Boiled Heroes / From Mothers to Crime Fighters / Women Detectives Today / Notes / Index.
Erika Janik, BA Geschichte, MA amerikanische Geschichte, MA Journalismus, ist freie Autorin und Produzentin beim Wisconsin Public Radio. Neben Buchveröffentlichungen liegt von ihr eine Vielzahl von Essays in verschiedenen Publikationen vor. (tp) KTS 64
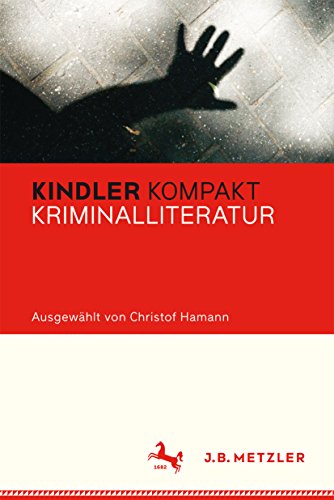 Hamann, Christof (Hg): Kindler Kompakt Kriminalliteratur. 2016, 204 S., Lesebändchen, J.B. Metzler Verlag (Springer), 19,95 Euro.
Hamann, Christof (Hg): Kindler Kompakt Kriminalliteratur. 2016, 204 S., Lesebändchen, J.B. Metzler Verlag (Springer), 19,95 Euro.
Nach einer längeren Einführung zum Krimi präsentiert Christof Hamann in diesem Band der Reihe „Kindler Kompakt“ einen Kanon von 53 Autoren aus dem Bereich der Verbrechensliteratur und der Kriminalliteratur sowie einen Beitrag zu einem Werk der Referenzliteratur. Die kurzen Essays verschiedener Beiträger beschäftigen sich hauptsächlich mit einem ausgewählten Werk der/s jeweiligen Autorin/Autors, selten wird ein Blick auf das Gesamtwerk geworfen. Die Auswahl beschränkt sich vorwiegend auf repräsentative Kriminalromane aus Europa und den USA. Kriminalliteratur aus Asien, Afrika und Lateinamerika wurde nicht berücksichtigt. Zudem wurden „nur literarische Texte berücksichtigt, die in die dritte, völlig neu bearbeitete Auflage von Kindlers Literatur Lexikon aufgenommen wurden“. Der Titel dieser Auswahlsammlung trifft allerdings auf die ersten 13 Betrachtungen nicht ganz zu: „König Oidipus“ von Sophokles oder Voltaires „Zadig“ zum Beispiel als Kriminalliteratur einzuordnen, fällt mir jedenfalls schwer.
Inhalt:
Christof Hamann: Krimis. Eine Einführung / Sophokles: König Oidipus / Daniel Defoe: Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders / François Gayot de Pitaval: Merkwürdige Rechtshändel als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit / Voltaire: Zadig oder Das Schicksal / Horace Walpole: Die Burg von Otranto / Friedrich von Schiller / Der Verbrecher aus verlorener Ehre / Ann Radcliffe: Udolphos Geheimnisse / William Godwin: Die Abenteuer des Caleb Williams / Thomas de Quincey: Der Mord als schöne Kunst betrachtet & Klosterheim oder Die Maske / E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi / Charles Dickens: Oliver Twist / Annette von Droste-Hülfshoff: Die Judenbuche / Hermann Kurz: Der Sonnenwirt / Émile Gaboriau: Die Affäre Lerouge / Fedor Michajlovič Dostoevskij: Schuld und Sühne / Wilkie Collins: Der Monddiamant / Theodor Fontane: Unterm Birnbaum / Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes & Der Hund von Baskerville / Caston Leroux: Das Phantom der Oper / Gilbert Keith Chesterton: Alle Geschichten um Father Brown / Agatha Christie: Das erzählerische Werk & Roger Ackroyd und sein Mörder & Die Mausefalle / Erich Kästner: Emil und die Detektive / Dashiell Hammett: Der Malteser Falke / Georges Simenon: Die Maigret-Romane / Dorothy L. Sayers: Mein Hobby – Mord & Aufruhr in Oxford / Friedrich Glauser: Die Kriminalromane / Raymond Chandler: Der große Schlaf & Der lange Abschied / Albert Camus: Der Fremde / Léo Malet: Nouveaux mystères de Paris / Friedrich Dürrenmatt: Die Kriminalromane / Ian Fleming: Die James-Bond-Romane / Thomas Narcejac & Pierre Boileau: Ich bin ein anderer / Michel Butor: Der Zeitplan / Chester B. Himes: Das Romanwerk / Patricia Highsmith: Das Romanwerk / John le Carré: Der Spion, der aus der Kälte kam / Dieter Wellershoff: Die Schattengrenze / Tony Hillerman: Das Romanwerk / P.D. James: Ein reizender Job für eine Frau / Manuel Vázquez Montalbán: Die Carvalho-Serie / Ken Follett: Die Nadel / Umberto Eco: Der Name der Rose / James Ellroy: Das erzählerische Werk / Patrick Süskind: Das Parfum / Ruth Barbara Rendell: Die Verschleierte / Henning Mankell: Die Wallander-Romane / Donna Leon: Venezianisches Finale / Wolf Haas: Die Brenner-Romane / Liza Marklung: Die Annika-Bengtzon-Serie / Kazuo Ishiguro: Als wir Waisen waren / Dan Brown: Sakrileg / Luc Boltanski: Rätsel und Komplotte.
Christof Hamann ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik an der Universität zu Köln und publiziert neben wissenschaftlichen Arbeiten auch literarische Texte. (tp) KTS 64
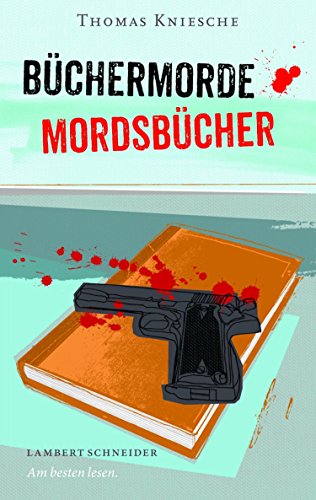 Kniesche, Thomas: Büchermorde – Mordsbücher. 2016, 144 S., Lesebändchen, Lambert Schneider (WBG), 16,95 Euro.
Kniesche, Thomas: Büchermorde – Mordsbücher. 2016, 144 S., Lesebändchen, Lambert Schneider (WBG), 16,95 Euro.
Wertvolle Manuskripte oder seltene Bücher haben in der Kriminalliteratur schon häufig auf Gauner eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Entweder, um die eigene Bibliothek mit Raritäten zu bestücken, oder um den Bücherschatz gegen ein horrendes Lösegeld dem rechtmäßigen Besitzer wieder anzubieten. Spenser, Bostons berühmtester Privatermittler, wurde in „The Godwulf Manuscript“ (1973, dt. „Spenser und das gestohlene Manuskript“, 1976), von Robert B. Parker auf die Spur des Diebes gesetzt. Und mancher Bücherdieb wurde bei der Beschaffung des Objektes seiner Begierde auch schon einmal zum Mörder. Kate Fansler, Ermittlerin in den Krimis von Amanda Cross aka Carolyn Heilbrunn, hat es in „The James Joyce Murder“ (1967, dt. „In besten Kreisen“, 1997) mit der Aufklärung eines Mordfalls zu tun. Auch Bibliotheken waren für einige Kriminalautoren/autorinnen beliebte Schauplätze: „Strong Poison“ (1930) von Dorothy L. Sayers oder „The Body in the Library“ (1942) von Agatha Christie oder Umberto Ecos „Der Name der Rose“ (dt. 1982). Und es waren nicht immer Gift und Schusswaffen, die einem Leben das Ende brachten – Bücher taten es als tödliche Schlagwaffen auch: In „The Cruellest Month“ von Hazel Holt dient ein Exemplar der 1732 erschienenen 700 Seiten starken „Britannia Romana“ als Mordwaffe. In „Büchermorde – Mordsbücher“ zeigt Thomas Kniesche was Gedrucktes im wahren Leben wie in der Kriminalliteratur alles anrichten kann. Buch und Bluttat können durchaus eine verhängnisvolle Verbindung eingehen. Thomas Kniesche hat diesen Verbindungen nachgespürt und mit „Büchermorde – Mordsbücher“ ein kleines aber feines Kompendium vorgelegt.
Inhalt:
Von Büchern und Bluttaten / Historische Büchermörder und ihre literarischen Doppelgänger / Das Buch als Objekt der Begierde: Warum Bibliophile morden / Dem Täter auf der Spur: Buchhändler sind die besten Detektive / Wenn Bücher töten: Das Buch als Waffe / Der Mord in der Bibliothek: Ein Tatort sorgt für Überraschung / Bildung schützt vor Blutdurst nicht: Gelehrte Mörder lauern an der Universität / Postmoderne Bücherkrimis: Wenn Fiktion und Realität verschmelzen / Von unendlichen Büchern und glücklichen Lesern: Im Labyrinth mit Jorge Luis Borges / Anmerkungen / Literatur / Dank.
Thomas Kniesche ist Associate Professor of German Studies an der Brown University in Providence/Rhode Island, USA, und passionierter Krimi-Leser. (tp) KTS 64
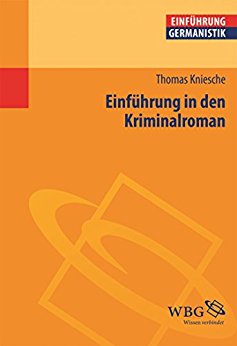 Kniesche, Thomas: Einführung in den Kriminalroman. 2016, 168 S., WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Einführung Germanistik), 19,95 Euro
Kniesche, Thomas: Einführung in den Kriminalroman. 2016, 168 S., WBG – Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Einführung Germanistik), 19,95 Euro
War es zunächst Verbrechensliteratur, die die Leser faszinierte, von der Sammlung berühmter Gerichtsfälle (1734-1743, Pitaval) bis hin zur „Judenbuche“ (1842, Droste-Hülshoff), so kann man den ungefähren Beginn der Kriminalliteratur mit dem Erscheinen von Gaboriaus „Die Affäre Lerouge“ (1866) datieren. Seitdem hat sich das Genre Kriminalroman stark differenziert. Die Veränderungen in der Kriminalliteratur werden durch die zahlreichen Untergattungen, wie Detektivroman, Polizeiroman, Frauenkrimi etc dokumentiert. Thomas Kniesche gibt einen kompakten Überblick über das Genre, beginnend mit Definitionen und Begriffsbestimmungen, einem kurzen Überblick zur Forschungsgeschichte und Beispiele zu verschiedenen Untergattungen. Abschließend zu seinem Überblick bietet er dem Leser 8 Einzelanalysen und Interpretationen repräsentativer Kriminalromane. Im Anhang beleuchtet eine Zeitleiste die Entwicklung von der Verbrechensliteratur über die Kriminalnovelle bis zur zeitgenössischen Kriminalliteratur. Das äußerst umfangreiche, teilweise kommentierte Literaturverzeichnis und die Hinweise zu Webseiten (ebenfalls annotiert) dürfte für Studenten der Germanistik, aber auch für interessierte Leser von Kriminalromanen ein Fest sein. Ein Personenregister und das abschließende Sachregister erschließen diese kompetente, wichtige wie erfreuliche „Einführung in den Kriminalroman“.
Inhalt:
- Definitionen und Begriffsbestimmungen des „Kriminalromans“ (Schwierigkeiten der Definition / Gattungsfragen und Definitionsversuche / Typologien des Kriminalromans / Eine Systematik des Kriminalromans / Historische Wandlungsprozesse des Kriminalromans).
- Forschungsgeschichte
III. Theoretische Ansätze zur Analyse von Kriminalliteratur (Formalistische, semiotische und strukturalistische Theorieansätze / Gattungsgeschichtliche und gattungstheoretische Überlegungen / Psychoanalytische und sozialpsychologische Ansätze / Sozialhistorische und ideologiekritische Studien / Postkoloniale Interpretationen und Minderheitenforschung / Feministische und gendertheoretische Ansätze / Medienübergreifende Forschung).
- Geschichte der Gattung (Vorformen des Kriminalromans / Frühe Formen des Kriminalromans im 19. Jahrhundert – „The Notting Hill Mystery“, Wilkie Collins, Émile Gaboriau, Anna Katharine Green / Der Detektivroman der Zwischenkriegszeit – Agatha Christie, Dorothy Sayers, S.S. Van Dine / Die amerikanische Schule des „hard-boiled“ Krimis – Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross Macdonald / Der psychologische Thriller und der Action-Thriller – James M. Cain, Patricia Highsmith / Der Polizeiroman und der forensische Thriller – Ed McBain, Patricia Cornwell / Postmoderne Kriminalromane und Anti-Kriminalromane – Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Paul Auster / Minderheiten-Detektive und Detektivinnen – Chester Himes, Walter Mosley, Barbara Neely / Der Frauenkrimi und der feministische Kriminalroman – Doris Gercke, Ingrid Noll / Historische Kriminalromane – Ellis Peters, Umberto Eco, Volker Kutscher / Der Kriminalroman in Deutschland).
- Einzelanalysen beispielhafter Kriminalromane (Georges Simenon „Maigret und Pietr der Lette“, 1931 / Friedrich Glauser „Matto regiert“, 1936 / Friedrich Dürrenmatt „Der Richter und sein Henker“, 1952 / Jörg Fauser „Der Schneemann“, 1981 / Patrick Süskind „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“, 1985 / Henning Mankell „Die fünfte Frau“, 2000 / Heinrich Steinfest „Nervöse Fische“, 2004 / Andrea Maria Schenkel „Tannöd“, 2006).
Zeitleiste / Literaturverzeichnis / Personenregister / Sachregister.
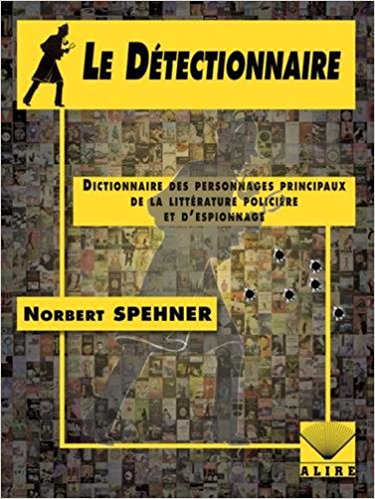 Spehner, Norbert/ Yvon Allard (mit Thérèse Bouchard-Forray & Denis Beauchemin): Le Détectionnaire. Dictionnaire des personnages principaux de la littérature policière et d’espionage. 2016, 791 S., zahlreiche s/w Coverabbildungen und Fotos, Les Éditions Alire, CAN $ 69,95 / 59,00 Euro
Spehner, Norbert/ Yvon Allard (mit Thérèse Bouchard-Forray & Denis Beauchemin): Le Détectionnaire. Dictionnaire des personnages principaux de la littérature policière et d’espionage. 2016, 791 S., zahlreiche s/w Coverabbildungen und Fotos, Les Éditions Alire, CAN $ 69,95 / 59,00 Euro
Weltweit gibt es in der internationalen Krimiszene nur sehr wenige Personen, die sich akribisch mit der bibliographischen Aufarbeitung und Darstellung der Kriminalliteratur beschäftigen. In Kanada sind es nur zwei Autoren, die sich dieser recht wichtigen Gattung der Referenzliteratur widmen. Im englischsprachigen Kanada wäre da L. David St. C. Skene-Melvin zu nennen („Canadian Crime Fiction“, 1996), für den französischsprachigen Teil des Landes zeichnet seit Jahrzehnten Norbert Spehner verantwortlich für entsprechende Standardwerke. Lesern des „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ dürften die Hinweise auf seine Auswahlbibliographien zur Kriminalliteratur verschiedener Länder bekannt sein. Im Oktober 2016 konnte Norbert Spehner endlich sein umfassendes Projekt eines Nachschlagewerkes zu Protagonisten der Kriminal- und Spionageliteratur vorlegen. Spehners Ansatzpunkt für die Auswahl der hier aufgenommenen Einträge war relativ simpel, um nicht ins Uferlose abzugleiten: Gelistet wurden nur solche Figuren, die häufig, wenigstens aber in zwei Kriminal- oder Spionageromanen erscheinen; außerdem muss der jeweilige Roman in mindestens einer Übersetzung vorliegen. Zusammengekommen sind so über 2.500 Einträge zu über 2.000 Autoren aus aller Welt. Die Einträge, personenalphabetisch geordnet, werden mit einer kurzen Biographie des Protagonisten eingeleitet, es folgen der Autorenname, Geburts- und Sterbedaten des Autors sowie Angaben zum Herkunftsland und zum Pseudoym. Aufgelistet werden die Titel und entsprechenden Übersetzungen mit Erscheinungsjahr und Verlag. Sollte es Film-, TV- oder TV-Serien-Adaptionen gegeben haben, werden diese ebenfalls mit Titel, Erscheinungsjahr und Hauptdarsteller genannt. Angereichert ist diese Fülle an Material mit Schwarz-Weiß-Abbildungen von Buchcovern und Fotos verschiedener Autoren/Autorinnen (bei einer schnellen Durchsicht konnten 23 deutschsprachige Autoren festgestellt werden). Im Vorlauf zum „Détectionnaire“ werden die Quellen aufgelistet, die der Autor mit seinen Beiträgern konsultiert hat. Das Kapitel „Crimes en séries“ gibt einen gestrafften Überblick zum Genre wie auch zu den verschiedenen Ermittler- und Figurentypen der Kriminal- und Spionageliteratur. Norbert Spehner, Spezialist für Krimi, Science Fiction und Phantastik, legte „Le Détectionnaire“ auch als Geburtstagsgabe zum 20-jährigen Bestehen der Éditions Alire vor. Erschlossen wird das Werk durch einen Autoren- und einen Personenindex. „Le Détectionnaire“ dürfte, wie andere Publikationen Spehners, schnell den Rang eines Standardwerkes im französischsprachigen Raum erringen. Ein ausführliches Interview von Philippe Turgeon, „Conversation avec Norbert Spehner“ (Alibis, No. 60, Oktober 2016), vermittelt Hintergründe und Arbeitsweise zum vorliegenden Werk.
Inhalt:
Genèse d’un projet / Présentation et mode d’emploi / Crimes en séries / Les Personnages / Annexes: Index des auteurs & Index des personnages.
Norbert Spehner, 1943 in Frankreich geboren, lebt seit 1968 in Québec. Er ist Autor von diversen Bibliographien zur Kriminalliteratur („Écrits sur le roman policier. Bibliographie“, 1990 / „Le Roman policier en Amérique française“, 2000) sowie zu Science Fiction und zur phantastischen Literatur. Neben „Marginalia“ (siehe ständige Hinweise) ist Spehner auch Mitherausgeber des kanadischen Krimimagazins „Alibis“. Daneben zahlreiche Veröffentlichungen in Krimimagazinen in Großbritannien, Frankreich und den USA. (tp) KTS 64
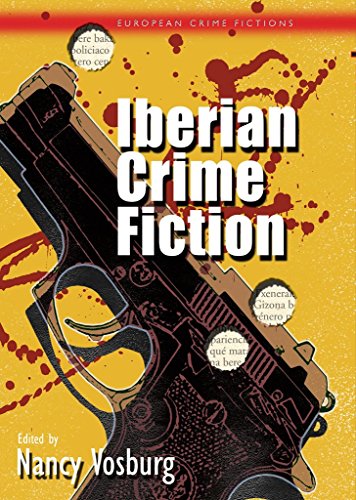 Vosburg, Nancy (ed): Iberian Crime Fiction. 2011, 149 S., University of Wales Press (European Crime Fictions), £ 40,00
Vosburg, Nancy (ed): Iberian Crime Fiction. 2011, 149 S., University of Wales Press (European Crime Fictions), £ 40,00
„Iberian Crime Fiction“ liefert einen kurzen Abriss zu den Ursprüngen und der Entwicklung der Kriminalliteratur in Spanien. Portugal wird ebenfalls berücksichtigt, allerdings in nur einem Kapitel. Über Mord und andere Verbrechen wurde in der Literatur der Iberischen Halbinsel bereits im 12. Jahrhundert berichtet. Der Kriminalroman (género policíaco oder novela negra) entstand hier, wie auch in anderen europäischen Ländern, gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Voll zur Blüte gelangte er nach dem Spanischen Bürgerkrieg und kurz vor dem Tod des spanischen Diktators Franco. Einen weiteren wichtigen Schub erlebte die spanische Kriminalliteratur durch die Romane eines der bedeutendsten Autoren des Landes: Manuel Vázquez Montalbán. Auch in den eigenständigen Landessprachen des Baskenlandes, Katalaniens oder Galiziens wurden Kriminalromane geschrieben und publiziert. In 7 Kapiteln vermittelt „Iberian Crime Fiction“ zu verschiedenen Autorinnen und Autoren und zu bestimmten Gattungen der Kriminalliteratur einen guten Überblick. Ergänzt werden die einzelnen Kapitel durch zum Teil ausführliche Hinweise auf weiterführende Literatur.
Inhalt:
Nancy Vosburg: Introduction to Iberian Crime Fiction / Patricia Hart: Crime Fiction since the Spanish Civil War / Mari Paz Balibrea: In Search of a New Realism – Manuel Vázquez Montalbán and the Spanish „Novela Negra“ / Stewart King: Detecting Difference/Constructing Community in Basque, Catalan and Galician Crime Fiction / Nancy Vosburg: Spanish Women’s Crime Fiction, 1980s-2000s – Subverting the Conventions of Genre and Gender / David Knutson: Spanish Crime Fiction – 2001 and Beyond / Paul M. Castro: Five Cases from 130 Years of Portuguese Detective Fiction, 1870s-2000s / Index.
Nancy Vosburg ist Professorin für Spanische Literatur und Sprache und leitet die Fakultät Modern Languages & Literature an der Stetson University in DeLand, Florida/USA. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt u.a. bei moderner spanischer Frauenliteratur. (tp) KTS 64
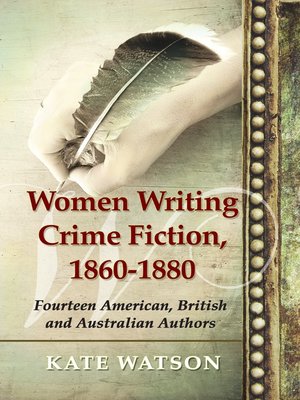 Watson, Kate: Women Writing Crime Fiction, 1860-1880. Fourteen American, British and Australian Authors. 2012, 260 S., McFarland & Company, US $ 40,00
Watson, Kate: Women Writing Crime Fiction, 1860-1880. Fourteen American, British and Australian Authors. 2012, 260 S., McFarland & Company, US $ 40,00
Gemeinhin werden Namen wie Arthur Conan Doyle, Wilkie Collins, Fergus Hume oder Émile Gaboriau als Vorläufer und/oder Begründer der Detektiv-/Kriminalliteratur genannt und angeführt. Wohl weniger bekannt ist, dass sich bereits einige Damen in England, den USA und Australien einen Namen mit Veröffentlichungen in diesem Literaturgenre gemacht hatten. Deren Veröffentlichungen erschienen teilweise bereits vor den Erstveröffentlichungen ihrer männlichen Kollegen, und zwar in der Zeit von 1860 bis 1880: einer Periode, die als maßgeblich für die Entwicklung der Kriminalliteratur angesehen wird. Kate Watson von der Universität in Cardiff hat sich auf Spurensuche begegen. In „Women Writing Crime Fiction“ berichtet sie über das Leben und Werk von 14 an dieser maßgeblichen Entwicklung beteiligten Schriftstellerinnen, von denen einige wenige Namen geläufig sein dürften. Eine äußerst ausführliche Aufstellung weiterführender Literatur bieten der Anhang mit Anmerkungen und die umfangreiche Bibliographie.
Inhalt:
Preface / Introduction: Transformation, Transmission and Transportation.
Britain – Introduction / Catherine Crowe (1790-1872) / Caroline Clive (1810-1873) / Elizabeth Cleghorn Gaskell (1801-1865) / Mary Elizabeth Braddon (1835-1915) / Mrs. Henry (Ellen) Wood (1814-1887) / Colonial Connections.
United States – Introduction / Harriet Prescott Spofford (1835-1921) / Louisa May Alcott (1832-1888) / Metta Victoria Fuller Victor (1831-1885) / Anna Katharine Green (1846-1935).
Australia – Introduction / Celeste de Chabrillan (1824-1909) / Caroline Woolmer Leakey (Oline Keese) (1827-1881) / Eliza Winstanley (1818-1882) / Ellen Davitt (c. 1812-1879) / Mary Helena Fortune (c. 1833 – ca. 1909/10).
Chapter Notes / Bibliography / Index.
Kate Watson lehrt an der Universität von Cardiff. Ihre Forschungsgebiete und Veröffentlichungen behandeln das 19. Jahrhhundert, Frauenliteratur, Gender und Kriminalliteratur. (tp) KTS 64
Autorenporträts, Autobiographien, Biographien, Werkschau
 Hornung, Alfred: Jack London. Abenteuer des Lebens. 2016, 320 S., Lesebändchen, Verlag Lambert Schneider (WBG), 24,95 Euro
Hornung, Alfred: Jack London. Abenteuer des Lebens. 2016, 320 S., Lesebändchen, Verlag Lambert Schneider (WBG), 24,95 Euro
Am 12. Januar 1876 wird Jack London in San Francisco in ärmlichen Verhältnissen geboren. Sein Werdegang ist zunächst von einem unsteten Berufsleben geprägt. Jack London verdingt sich als Fabrikarbeiter, Austernpirat, Landstreicher und Seemann. Spät holt er sein Abitur nach und beginnt ein Studium. Dann wieder verschlägt es ihn als Goldsucher nach Alaska, später nach East London, ein Elendsquartier, wo er einige Monate lebt. Als Kriegskorrespondent im russisch-japanischen Krieg gerät London in Gefangenschaft. Sein Ruhm, der ihn schließlich zum Millionär werden lässt, gründet auf den Abenteuerromanen „Der Seewolf“, „Ruf der Wildnis“ und „Wolfsblut“. Der Amerikanist Alfred Hornung schildert das abenteuerliche Leben eines vom Ehrgeiz Getriebenen. Eingefügt in diese Biographie hat Hornung Textstellen aus den Romanen, Erzählungen und Londons politischen Essays. Alfred Hornungs Biographie beleuchtet umfassend das Leben eines Menschen auf der Suche nach Selbstverwirklichung, der sich aber auch für Minderprivilegierte einsetzt – ein „Abenteuer des Lebens“. Die abschließende und sehr umfangreiche Bibliografie gliedert sich in „Romane und Erzählungen“, „Kurzgeschichten und Essays“, „Zweisprachige Ausgaben“, „Briefe, Presse, Biografisches“. Es schließt sich eine ebenso umfangreiche Aufstellung der Sekundärliteratur an, ergänzt um ein Personenregister und ein Werkregister. Am 22. November 1916 nimmt sich Jack London auf seiner Farm in Kalifornien das Leben.
Inhalt:
Vorwort – Das Abenteuer Jack London / Abenteuer der Kindheit und Jugend (Ärmliche Verhältnisse eines Adoptivkindes; Schulabbruch und Kinderarbeit; Austernpirat in der San Francisco Bay; Hobo und Tramp in Amerika) / Politische Abenteuer (Hungermarsch nach Washington; Karl Marx und autodidaktisches Studium; Sozialist – Schriftsteller – Liebhaber; Bei den Armen in East London; Kriegskorrespondent in Japan und Korea) / Abenteuer zu Land (Überleben am Yukon und in Alaska; Erste literarische Erzählungen; Abenteuer und Squaws; Ein Hund als Star: Der erste große Erfolg) / Abenteuer zur See („Der Seewolf“: Der zweite große Erfolg; Hawaii und die Leprakolonie; Paradies und Hölle in der Südsee) / Visonäre Abenteuer und Selbstbilder (Sozialistische Visionen; Schreiben für die Revolution; Selbstbilder des Schriftstellers) / Ökologische Abenteuer und Weltgemeinschaft (Öko-Landwirtschaft; Zeitreisen in der Zwangsjacke; Hawaiianische Identität und Weltsprache; Über den Tod hinaus) / Bibliografie / Personenregister / Werkregister.
Alfred Hornung zählt zu den international renommiertesten Amerikanisten. Er ist Professor und Lehrstuhlinhaber Amerikanistik an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. An namhaften amerikanischen, kanadischen, chinesischen und europäischen Universitäten hatte er Gastprofessuren inne. Alfred Hornung war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien und bekleidete wichtige Ämter in Forschung und Lehre. Der Staat Texas verlieh ihm die Ehrenbürgerwürde. (tp) KTS 64
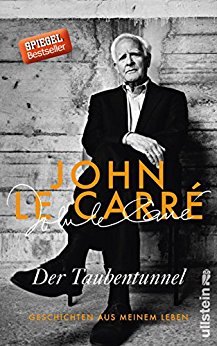 Le Carré, John: Der Taubentunnel. Geschichten aus meinem Leben. 2016, 381 S., Lesebändchen, (The Pigeon Tunnel, Ü.v. Peter Torberg), Ullstein Verlag, 22,00 Euro
Le Carré, John: Der Taubentunnel. Geschichten aus meinem Leben. 2016, 381 S., Lesebändchen, (The Pigeon Tunnel, Ü.v. Peter Torberg), Ullstein Verlag, 22,00 Euro
Am 19. Oktober 2016 beging David John Moore Cornwell seinen 85. Geburtstag. David Cornwell, ehemals Mitglied der britischen Botschaft in Bonn, besser bekannt als John Le Carré, gilt als der Vertreter des intelligenten Spionageromans. Mit seinen Welterfolgen „Der Spion, der aus der Kälte kam“ oder seinen George Smiley-Romanen hat er Eckpunkte für die Spionageliteratur geschaffen. Jetzt hat er seine Autobiographie vorgelegt. Der Erfolg nach „Der Spion, der aus der Kälte kam“ veränderte sein Leben von Stund an. Er verließ den diplomatischen Dienst, um Zeit für seine aufwendigen Recherchen rund um den Erdball zu haben. In „Der Taubentunnel“ berichtet er von seinen Begegnungen mit den Mächtigen der Politik, mit Terroristen und Gaunern oder auch mit Geheimdienstlern und Überläufern. Er beschreibt akzentuiert das muffige Klima der Nachkriegszeit in Deutschland („Eine kleine Stadt in Deutschland“) oder seine Begegnungen mit den Großen der Filmwelt seiner Zeit, mit Richard Burton oder Alec Guinnes. „Der Taubentunnel“ ist ein lesenswerter, teilweise amüsanter Rückblick auf ein erfolgreiches Schriftstellerdasein. Den Titel „Der Taubentunnel“ nutzte Le Carré stets als Arbeitstitel für fast alle seine Bücher.
Inhalt:
Vorwort / Einleitung / Seien Sie nett zu Ihrem Geheimdienst / Globkes Gesetze / Offizieller Besuch / Finger am Abzug / Wen auch immer es betrifft / Die Mühlen der britischen Justiz / Der Überläufer / Das Erbe / Murat Kurnaz ist unschuldig / Feldforschung / Eine zufällige Begegnung mit Jerry Westerby / Einsam in Vientiane / Theater der Wirklichkeit: Tänze mit Arafat / Theater der Wirklichkeit: Villa Brigitte / Theater der Wirklichkeit: Eine Schuldfrage / Theater der Wirklichkeit: Kosenamen / Der sowjetische Ritter stirbt in seiner Rüstung / Der Wilde Osten: Moskau 1993 / Blut und Gold / Die größten Bären im Garten / Bei den Inguschen / Ein Preis für Joseph Brodsky / Aus falscher erster Hand / Seines Bruders Hüter / Quel Panama! / Schläfer im eigenen Land / Die Jagd auf Warlords / Richard Burton braucht mich / Alec Guinnes / Verlorene Meisterwerke / Bernard Pivots Krawatte / Essen mit Gefangenen / Der Sohn des Vaters des Autors / Für Reggie, mit bestem Dank / Marionetten / Das letzte offizielle Geheimnis / Guter Rat für einen angehenden Schriftsteller / Stephen Spenders Kreditkarte / Quellenangaben.
John Le Carré, 1931 geboren, studierte in Bern und Oxford. Er war Lehrer in Eton und arbeitete während des Kalten Krieges kurze Zeit für den britischen Geheimdienst. Seit nunmehr fünfzig Jahren ist das Schreiben sein Beruf. Er lebt in London und Cornwell. (tp) KTS 64
Eine Auswahl weiterführender Literatur im BoKAS:
— Bruccoli, Matthew J. / Baughman, Judith S. (ed.): Conversations with John le Carré. 2004, University Press of Mississippi
— Hindersmann, Jost: John le Carré. Der Spion, der zum Schriftsteller wurde. Portrait und Bibliografie. (Bibliografie unter Mitarbeit von Thomas Przybilka). 2002, NordPark Verlag
— Jenssen, Elena: Die Narrativik des Geheimen und Erzählplots in John Le Carrés Spionageromanen. 1999, Uni. Hamburg
— Jenssen, Elena: Die Narrativik des Geheimen. Erzählplots in den Spionageromanen von John le Carré. 2000 BoD
— Kost, Rudi: Über George Smiley (Biographische Skizzen). 1985, Poller Verlag
— Lewis, Peter: John le Carré. 1985, Frederick Ungar Publishing
— Monaghan, David: Smiley’s Circus. Die geheime Welt des John le Carré. 1992, Heyne Verlag
— Schuster, Winfried: Parallele und Kontrast in den Spionageromanen von John le Carré als Zeichen einer Humanität. Untersuchungen zur Erzähltechnik bei David John Moore Cornwell. 2002, Uni. Mainz
Film, TV, Hörspiel, Theater
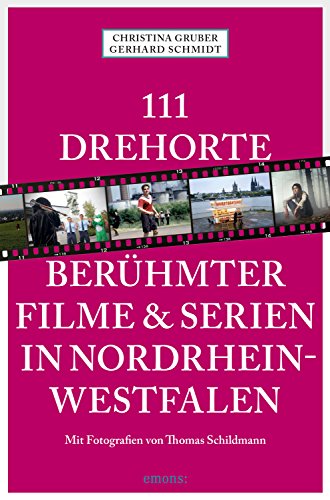 Gruber, Christina / Schmidt, Gerhard: 111 Drehorte berühmter Filme & Serien in Nordrhein-Westfalen. Mit Fotografien von Thomas Schildmann. 2016, 239 S., zahlreiche Farbfotos, 2 Übersichtskarten, Emons Verlag, 16,95 Euro
Gruber, Christina / Schmidt, Gerhard: 111 Drehorte berühmter Filme & Serien in Nordrhein-Westfalen. Mit Fotografien von Thomas Schildmann. 2016, 239 S., zahlreiche Farbfotos, 2 Übersichtskarten, Emons Verlag, 16,95 Euro
Die Polizeistation und deren Besatzung um die Kölner Kriminalkommissarin Sophie Haas (Caroline Peters) im fiktiven Hengasch in der Eifel war Angelpunkt der WDR-Serie „Mord mit Aussicht“. Die TV-Serie war ein Renner und Millionen Fersehzuschauer wollten wissen, wie sich Sophie Haas bei ihrer Ermittlungsarbeit zwischen Kühen, Eulen und Traktoren anstellt. Gedreht wurde zwar auch in der Eifel, genauer gesagt in der Voreifel, in Kallmuth, Kreis Euskirchen. Aber auch im Bergischen Land, am Niederrhein und im Rhein-Sieg-Kreis. Und die berühmteste Frittenbude der Republik steht in der Kölner Aggripinawerft. Mit Blick zum Dom lassen sich die Kölner Tatort-Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenck Currywurst mit Pommes und Kölsch schmecken. Szenen aus „Balko“, „Schimanski“, „Alarm für Cobra 11“ oder „Tannöd“ und viele weitere wurden zwischen Münster und Aachen, Bielefeld und Bad Laasphe gedreht. Nordrhein-Westfalen hat somit jede Menge toller Locations für Krimi-Serien (und natürlich auch für andere Filme) vorzuweisen. Das Gespann Boerne / Thiel ermittelt in Münster mit Prinzipalmarkt und Aasee – allerdings wird aus Kostengründen oft in Köln und Bonn gedreht. Münster ist auch der Standort des Antiquariats von Privatdetektiv Wilsberg. Und Dortmund-Ruhrort hat dem Parka-Träger und Pöbel-Bullen Schimanski ein Denkmal in Form der „Horst-Schimanski-Gasse“ gesetzt. Kurzum, in Nordrhein-Westfalen eignen sich so manche Orte als Filmkulisse für etliche Krimis und Action-Filme. Allein die Gegend vom Ruhrgebiet hinunter bis Bonn ist reich gesegnet mit Film-Locations.Christina Gruber und Gerhard Schmidt stellen 111 Filmorte mit ausführlichen Texten und zahlreichen Fotos, u.a. von Thomas Schildmann, vor. In Nordrhein-Westfalen sind fast 200 Produktionsfirmen ansässig, die jährlich über 250.000 Programm-Minuten herstellen. Kein Wunder daher, dass der Medienstandort NRW ein gefragtes Pflaster für die Location-Scouts dieser Firmen ist.
Christina Gruber, geboren 1966 im Oberbergischen Land, arbeitet als Autorin und Dozentin für Journalismus, Online-Journalismus und digitale Strategien. Als freie Journalistin schreibt sie u.a. über die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Zuvor war sie 16 Jahre bei RTL angestellt, zuletzt als Abteilungsleiterin Unterhaltung verantwortlich für die digitale Präsentation der Shows, Filme, Serien und Soaps bei RTL interactive.
Gerhard Schmidt, Autor, Regisseur, seit 50 Jahren Fernseh- und Filmproduzent, hat seit Mitte der 80er Jahre am Aufbau des Medienstandorts NRW mitgearbeitet; im Team mit Cologne Film und Gemini Film (heute Warnerbros, Köln) entwickelte und produzierte er Kinofilme mit Roger Moore, Kirsten Scott Thomas, Jean Paul Belmondo, Nick Nolte, Til Schweiger und Goetz George und TV-Programme wie „Kommissar Klefisch“, „Wilsberg“, „Marie Brand“, „Das Amt“, „Nicola“ und „Mitternachtsspitzen“.
Thomas Schildmann wurde 1964 in Bottrop geboren. Als Kölner Oberkommissar hat er schon aus beruflichen Gründen einen scharfen Blick fürs Detail. Seit Jahren fotografiert er nicht nur dienstlich für die Polizei, sondern macht auch die Bilder zu den Texten seiner Ehefrau Christina Gruber. (tp) KTS 64
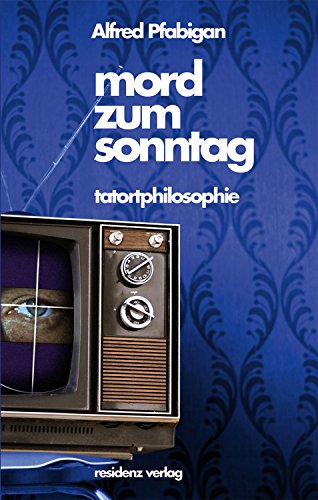 Pfabigan, Alfred: Mord zum Sonntag. Tatortphilosophie. 2016, 208 S., Residenz Verlag, 20,00 Euro
Pfabigan, Alfred: Mord zum Sonntag. Tatortphilosophie. 2016, 208 S., Residenz Verlag, 20,00 Euro
Am Sonntag, dem 13. November 2016, strahlte die ARD den „Tatort. Taxi nach Leipzig“ aus. Es war die 1000. Folge des „Tatort“, Flaggschiff der ARD-Länderanstalten. Millionen von Menschen in Deutschland und Österreich sind regelmäßige „Tatort“-Zuschauer oder –Fans. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 14 Millionen Zuschauer den „Tatort“ zum Sonntagsritual erhoben haben. Unter den (regelmäßigen) Zuschauern ist auch der Wiener Sozialphilosoph Alfred Pfabigan. Als kritischer Zuschauer hat Alfred Pfabigan einiges an der TV-Reihe zu bemängeln. Pfabigan sieht im „Tatort“ eine Verschmelzung von Unterhaltung und Politik, ja er meint, dass „das Format zu einem Instrument der Regierung“ geworden ist. Weiterhin thematisiert Pfabigan die bisher nicht erfolgte Vergangenheitsbewältigung bezüglich maßgeblich am „Tatort“ beteiligter Regisseure. Anzunehmen ist, dass nur wenige Zuschauern wissen, dass mit den Namen Alfred Weidenmann („Derrick“-Erfinder), Herbert Reinecker (Drehbuchautor) oder Jürgen Roland („Stahlnetz“) ein enges Netzwerk ehemaliger Autoren aus NS-Propagandakompanien zu verbinden ist. Ebenso beklagt er, dass noch bis Anfang des 21. Jahrhunderts wichtige kriminalistische Alltäglichkeiten keinen Einzug in die Reihe fanden (z.B. Forensik, Telefonortung, Tatort-Schutzkleidung), oder dass nur ein recht begrenzter Kreis von Schauspielern für die Reihe zur Verfügung steht. Pfabigan beschließt seine „Tatortphilosophie“ mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis und Hinweisen zu weiterführenden Internetquellen.
Inhalt:
Vorwort / Vom Paradies zum „Tatort“ (Der erste Mord; Der erste Mord und der Sozialvertrag; Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet; Fernsehen; Fernsehserien – Die Kinder der Scheherazade und des Schahseman; Von den „Jungen Adlern“ zum „Tatort“; Nachrichten aus dem Innenleben deutsch-österreichischer Polizeiserien; Ästhetik der Beiläufigkeit) / Zur Ästhetik der Gewalt (Der Moment des Tötens; Die Zuschaustellung der Leiche; Die Obduktion im Spannungsfeld von Mythos und Moderne) / Kain und Abel (Wer ist „Opfer“?; Das schuldige Opfer; Die beiden Gesichter Kains; Die Klärung des Falles: Motiv oder Spur) / Ermittler und Ermittlerinnen (Einsame Beamte; Good Cops – Bad Cops; Jenseits des Rechtsstaats) / Anhang (Literaturverzeichnis; Internetquellen, Register).
Alfred Pfabigan, geboren 1947 in Wien, habilitierte 1979 in Politikwissenschaft an der Universität Salzburg. 1993-2013 war er Professor für Sozialphilosophie an der Universität Wien und unterrichtete in den USA, Bulgarien, Frankreich und der Ukraine. Er ist Leiter der „Philosophischen Praxis Märzstraße“ und Autor von zahlreichen Publikationen. (tp) KTS 64











