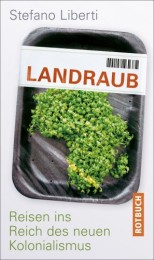 Ausverkauf der knappen Güter
Ausverkauf der knappen Güter
– Makrokriminalität ist ein weites und spannendes Feld. Wer sich mit ihr beschäftigt, lernt eine Menge über diese Welt. Es schon immer gewusst zu haben, ist blasiert. Was Menschen Menschen antun, geht uns alle an, vor allem, wenn es um wirkliche basics geht: Lebensmittel, Wasser, Luft. Ein besonders übles Kapitel ist Landraub. Stefano Liberti hat ein wichtiges Buch dazu geschrieben, Lena Blaudez stellt es uns vor:
„Alle investieren in China für die Industrie, in Indien für den Service. Für Nahrungsmittel muss man nach Afrika gehen.“ Diese auf den ersten Blick unsinnig anmutende Aussage des Generaldirektors einer indischen Gruppe von Investoren ergibt nicht nur für ihn Sinn, sprich Profit.
Wie viele andere Konzerne pachtete seine Firma Land in Äthiopien, u.a. eine Fläche von der Größe Luxemburgs an der Grenze zum Sudan. Gratis sogar in den ersten sechs Jahren und in den folgenden vierundachtzig Jahren für lächerliche 60 Cent pro Hektar. Der Boden ist exzellent, das Klima optimal und die Vergünstigungen, die die Regierung einräumt, geradezu unglaublich. Wie ist das möglich?
Um Antworten auf diese und ähnliche Fragen zum Thema land grabbing zu erhalten, ist Stefano Liberti um die ganze Welt gereist. „Landraub oder Reisen ins Reich des neuen Kolonialismus“ nannte er seine umfassende und gründlich recherchierte Reportage. Er interviewte Vertreter aller Beteiligten dieses gigantischen Nutzerwechsels von Millionen Hektar Ackerlandes. Die Bauern, die von ihrem Land vertrieben werden, kommen ebenso zu Wort, wie die Regierungen, die ihre Böden verschleudern und die Investoren, die traumhafte Rendite einfahren.

Ungeahnte Dimensionen
Der Wettlauf um Ackerland hat so richtig massiv vor rund vier Jahren begonnen, nach der Lebensmittelkrise 2008, einer direkten Folge der Finanzkrise, und er hat sich von Jahr zu Jahr rasant beschleunigt. Waren es 2008 noch vier Millionen Hektar, die aus der öffentlichen Hand in privaten Besitz wechselten, so waren es ein Jahr später bereits 50 Millionen Hektar – eine Fläche, die ungefähr der Größe Spaniens entspricht – wie ein Weltbank-Bericht 2010 ermittelte. Land, verpachtet an multinationale Konzerne, Investmentfonds oder Land, das ausländische Unternehmer in ihren Besitz brachten, um Biotreibstoffe oder Lebensmittel zu produzieren, die für den Bedarf der nördlichen Länder bestimmt sind.
Der Kontrast könnte kaum schärfer sein: Inmitten von Feldern, die mit Ochsen gepflügt und mit der Hacke bearbeitet werden, stehen verdeckt hinter Zäunen High-Tech-Gewächshäuser, in denen perfekte Zucchini, Tomaten, Auberginen und Paprika dank Gentechnik in Standardgröße gedeihen. Computergesteuert mit Technik und Saatgut aus Europa. Innerhalb von 24 Stunden per Kühlcontainer und Flugzeug am Bestimmungsort, in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das „Beste“ an der Sache: Die Arbeitskosten liegen sogar unter dem afrikanischen Durchschnitt – so wirbt die Firma auf ihrer Homepage.
Unser Mann am Horn von Afrika
In Äthiopien gehört der Grund und Boden dem Staat – er verteilt die Anbauflächen, eben auch zu Schleuderpreisen an internationale Großinvestoren. Gleichzeitig ist das Land zur Ernährung seiner Bevölkerung von internationalen Hilfslieferungen abhängig. Meles Zenawi – seit 1991 und dank offenkundigen Wahlbetrugs immer noch Ministerpräsident eines inzwischen totalitären Regimes – lässt die Landvergabe streng geheim ablaufen. Sein Kalkül, so wird von Oppositionsvertretern vermutet, scheint aufzugehen: Als Vermittler der Landverramschung werden die Regierungen, die massiv in Äthiopien investieren, dafür sorgen, dass er im Sattel bleibt. Außerdem ist „unser Mann am Horn von Afrika“ unantastbar, weil er in westlichen Augen Stabilität in dieser Krisenregion zu versprechen scheint. Und so erhält die Regierung – trotz eklatanter Menschenrechtsverletzungen – seit 2008 die höchste Summe aller Länder Afrikas südlich der Sahara an „humanitärer Hilfe“ von der internationalen Gebergemeinschaft … „Beispiellose Heuchelei“ der internationalen Verbündeten Äthiopiens konstatiert Liberti.
Liberti beschreibt, wie der Wüstenstaat Saudi-Arabien mit viel Geld und großer politischer Unterstützung seine Nahrungsmittelproduktion „ins Ausland verlegt“ – nach Senegal, Mali oder Mauretanien und in den Sudan. Zukünftig auch in die Türkei und nach Kasachstan. Dabei geht Liberti detailliert auf die Beweggründe des Landes, die Entwicklungen und die diversen Investorengruppen ein und vermittelt auch hier ein tiefer gehendes Verständnis der Abhängigkeiten und Bedürfnisse. Diese Komplexitäten aufzuzeigen, ist ein großer Verdienst des Buches. Beispielhaft lässt uns der Autor an einer Konferenz 2010 in Riad teilnehmen, auf der Regierungsvertreter von Mosambik, Äthiopien und der Zentralafrikanischen Republik ihre fruchtbaren Böden zu Ramschpreisen mit besten Konditionen anpreisen und sich auf bedrückende Weise gegenseitig unterbieten, um sich auf diesem Markt zu etablieren und an Devisen zu kommen.
Ein Geschäft – mehr als profitabel
Der Landraub durch die reichen Länder in den ärmsten Gebieten in Afrika zieht den Kampf um das lebensnotwendige Wasser nach sich. Investorengruppen setzen in den letzten Jahren auch zunehmend auf das „blaue Gold“. Die zur Bewässerung angelegten Kanäle führen direkt durch die trockenen Felder der von Nahrungsmittelhilfe immer abhängiger werdenden Familien.
Die Sache ist einfach: Die Weltbevölkerung wächst, eine exponentiell steigende Nachfrage nach Nahrung und damit nach Ackerland und Wasser, ist garantiert. Der Traum eines jeden Spekulanten. Mit Tempo werden ebenso Beteiligungen an der Ackerlandnutzung in Brasilien, Argentinien und Indonesien gekauft. In den meisten Ländern erfolgt das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Liberti lässt Vertreter von Organisationen wie Via Campesina zu Wort kommen, die seit Jahren gegen den Landraub kämpfen, der nicht nur die Kleinbauern ihrer Existenzgrundlage beraubt, sondern auch Regenwald zugunsten von Monokulturen wie Palmplantagen für Biodiesel vernichtet. Dabei wird immer wieder (u. a.) deutlich, dass die Vorgehensweise der Weltbank, um ihr Ziel – die Armutsreduzierung – zu erreichen, sich häufig als ziemlich verhängnisvoll für die Armen herausgestellt hat.

FAO-Hauptgebäude in Rom
Win-win-Rhetorik
Selten ist etwas so gutmenschlich verbrämt worden, was so verheerende Folgen hat und besonders in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben wird. Fast alle Akteure in diesem Business benutzen dieselben Floskeln. Ob Funktionäre der Weltbank, FAO (=Food and Agriculture Organization of the United Nations) oder Manager von Investmentfonds – die Rede ist immer von verantwortungsbewusstem Investieren in die Landwirtschaft, zum Wohle aller, umweltgerecht und sozialverträglich. Viele schöne Worte, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen, wie ein altgedienter Mitarbeiter der Weltbank Liberti anvertraute – vertraulich in der Tat. Die Rede ist von Technologietransfer, Modernisierung der Landwirtschaft, Arbeitsplatzschaffung, Produktivitätssteigerung. Win-win-Rhetorik, immer mit den drei P’s: Profit, Planet, Population – Profite machen, dem Planeten Gutes tun und auf der Seite der Menschen stehen. Glaubt man den Sprüchen der Finanziers, ist das alles unter einen Hut zu bringen. Den Ländern zu Wachstum zu verhelfen und der einheimischen Bevölkerung Nutzen zu bringen – nicht alle Akteure sind skrupellose Neokolonialisten und pfeifen auf die Rechte der anderen, schreibt Liberti differenzierterweise. Einige der kleinen und mittleren Investoren würden tatsächlich glauben, einen guten Kreislauf in Gang zu bringen – nur sind ihre Konzepte von Entwicklung andere, als die der Verlierer der Win-win-Situation. Denn das von internationalen Institutionen geförderte Modell der Zukunft heißt Agroindustrie. Liberti erläutert das am Beispiel der Macht multinationaler Agrarkonzerne, die dank ihrer riesigen Plantagen in Brasilien fast den gesamten Weltmarkt an Grundnahrungsmitteln kontrollieren, einen märchenhaften Umsatz einfahren und die Politik ganzer Staaten beeinflussen. Aber auch hier wird stetig immer weiter Land verkauft.
In Tansania wird der Boden mit der Monokultur Purgiernuss ruiniert – angeblich der Treibstofflieferant der Zukunft. Und – so die Propaganda der Firmen – kein Nahrungsmittelkonkurrent, denn die Pflanze wird nicht wie Mais oder Soja der Ernährung vorenthalten und sie wächst auf den schlechtesten und trockensten Böden, die sonst nicht zu gebrauchen sind. Nur, dass die dafür verschacherten Gebiete des Landes weder trocken noch schlecht sind …
Finanziers machen nur ihren Job – internationale Organisationen machen ihren aber nicht
Finanziers sind Leute, die nur ihren Job machen, sagt Liberti auch bei einer Lesung in Berlin. Und der besteht darin, soviel Profit wie möglich zu machen. Egal wie. Das Problem läge bei den internationalen Organisationen wie etwa der FAO oder der Weltbank, denn sie greifen nicht ein, wie er beklagt. Die Hauptschuld sieht Liberti jedoch bei den Regierungen der Länder, die ihr kostbares Land für ein paar Dollar oder eine Gutschrift auf einem ausländischen Konto der jeweiligen Eliten verschleudern.
Der Landraub ist ein großer Betrug – wie in den Kolonialzeiten wird in Übersee beschafft, was die Länder für die eigene Bevölkerung brauchen. Die Konflikte, die daraus entstehen, werden sich ausbreiten und zu immer härteren Zusammenstößen führen. Und, so das Fazit von Liberti: Der Ausgang dieses Kampfes wird bestimmen, wie die Zukunft unseres Planeten aussehen wird.

Stefano Liberti (Quelle: rotbuch.de)
Liberti beschreibt auf seinen Reisen rund um den Globus auf mitreißende Weise das Umfeld und die Personen, die er trifft. Er lässt den Leser staubverkrustet durch die wabernde Hitze wandern, auf spiegelglattem Parkett die Kleiderfrage durchdenken oder sich von charmanten Damen der Finanzwelt verblüffen. Das macht die Lektüre der Reportage auch jenseits der gut aufbereiteten Fakten zu einem Erlebnis. Aber vor allem ist „Landraub“ eine beeindruckende Studie über eine Entwicklung, die – wird sie nicht aufgehalten – für einen großen Teil der Weltbevölkerung in seinen Folgen katastrophal sein wird.
Stefano Liberti arbeitet für die Tageszeitung il manifesto und als TV-Autor, seine Reportagen erscheinen in Geo, L’Èspresso und Le Monde Diplomatique. Er ist für seine Reportagen vielfach ausgezeichnet und zählt zu den bekanntesten investigativen Journalisten Italiens.
Lena Blaudez
Zur Homepage von Lena Blaudez.
Stefano Liberti: Landraub (Original: Land grabbing, 2011). Sachbuch. Deutsch von Alex Knaa. Rotbuch Verlag 2012. 256 Seiten. 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.












