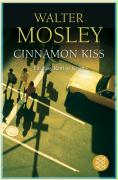 Nimm mir alles, nur nicht meinen Unterschied!
Nimm mir alles, nur nicht meinen Unterschied!
Die Easy-Rawlins-Serie von Walter Mosley startete als Projekt, die Geschichte von Watts in einer Reihe von Kriminalromanen um einen schwarzen Weltkriegsveteranen seit 1948 bis heute zu erzählen. Cinnamon Kiss spielt 1966, Nadja Israel hat sich die Entwicklung der Saga angesehen …
„Wenn uns aber objektive ökonomische Gesetze treiben, sind wir dann nicht unschuldig? Oder zumindest alle gleich schuldig?“ (Philomena Cinnamon Cargill)
Eigentlich ist alles ganz einfach. Walter Mosley überlegt in seinem Roman Cinnamon Kiss, ob ein assimilierter Afroamerikaner noch Afroamerikaner sein kann, und lässt auch in seinem neunten Kriminalroman den man of honor, Ezekiel Rawlins, auftreten, um in dieser Angelegenheit Fragen zu stellen.
Easy, mittlerweile nicht mehr der Jüngste, ermittelt in seinem neuesten Fall zwischen Blumenkindern des Jahres 1966 und beleuchtet dabei – wie gewohnt – auch die dunklen Kapitel amerikanischer Geschichte.
Wie bereits in seinem Erstling Devil in a Blue Dress, geht es auch in Cinnamon Kiss um eine verschwundene, schöne Frau. Easy nimmt diesen Fall nur widerwillig und aus finanzieller Notlage an, um das Leben seiner schwerkranken Adoptivtochter Feather zu retten. Deren kostspielige Behandlung einer komplizierten Blutvergiftung kann allerdings nur in der Schweiz ausgeführt werden, „denn in Europa kennen sie sich aus mit der Blutsache“.
Es geht um Blut und Farben in diesem Roman: Hautfarben, Liebe, Sex, Bluts- und Wahlverwandtschaft, Patchworkidentitäten und -familien. All das wird genauso zum Thema gemacht, wie auch die Frage nach dem Verhältnis von persönlicher versus gesellschaftlicher Verantwortung. Den gebeutelten und verzweifelten Easy führen seine Ermittlungen diesmal in ein abstruses Labyrinth von Verrat, Verschwörung und Verdächtigen, vor dem Hintergrund politischer Aufbruchsstimmung und Hoffnung in Amerika.
In Cinnamon Kiss platzt das Unheil nicht in eine idyllische Mittelschichtszenerie, woraus es beseitigt werden muss. Vielmehr gestaltet Mosley, hier ganz der afro-amerikanischen hardboiled Tradition verpflichtet, Verbrechen systemimmanent und zwingt Easy aufgrund seiner persönlichen Notlage dazu, seinen kleinbürgerlichen Frieden und seinen Job als Hausmeister gegen die Rolle des Privatermittlers einzutauschen. Will Easy nicht selbst ein Verbrechen begehen, benötigt er eines, das er enträtseln kann, denn er steckt in einem echten Dilemma, bei dem die Sorge um die Familie moralische Befindlichkeiten aushebelt.
So ist Easy kurz davor, das Angebot seines literarischen alter egos, Raymond alias Mouse, anzunehmen. Der hochkriminelle und beste Freund von Easy bietet ihm einen Transporterüberfall zur Lösung seiner finanziellen Probleme an. Easy zögert noch, als ihn ein weiteres dubioses Angebot erreicht: Er soll für den berühmten Anwalt Robert. E. Lee (Namensvetter des berühmten Südstaatengenerals) den Menschenrechtler Axel Bowers, seine Partnerin Philomena Cinnamon Cargill und einen entwendeten Aktenkoffer finden. Easy, der sich nicht zuletzt über seine Hautfarbe für diesen Job im Bürgerrechtsmilieu qualifiziert, nimmt den Auftrag an.
Das Mantra des Multikulturalismus?
Fast ein bisschen trotzig und in jedem Fall verlässlich, umschifft Mosley das Mantra des Multikulturalismus. Für ihn bleiben die Schwarzen im Allgemeinen und der schwarze Mann im Besonderen konsequent anders und damit an der Peripherie einer nach wie vor von männlichen Weißen dominierten Gesellschaft.
Die grimmige Annahme, dass man „das Andere“ benutzt, um „das Eigene“ zu definieren, durchzieht den gesamten Roman. Dabei kann einem als Leser schon schwindlig werden bei den geschielten Umkehrungen, die, wie ein Quasisuchtverhalten, immer nach allen Seiten Ausschau halten und den „Gegner“ suchen.
Der Versuch, eine ausdifferenziertere Sicht auf Schwarze in Amerika zu propagieren, vollzieht Mosley über das zum Teil überstrapazierte, bis zur Parodie gesteigerte Verfahren der Umkehrung, beispielsweise über die Beschreibungen von Äußerlichkeiten. Bei ihm sind die Afroamerikaner dabei zimtfarben, süßkartoffelbraun oder schwarz wie die Schuhe eines Bestattungsunternehmers. Die Weißen hingegen sind ausschließlich weiß.
Intellektuelle Schnitzeljagd
Mit viel Ironie lässt Mosley über Mouse und Easy der weißen Leserschaft in einem jazzy street speak deren ganz eigene „Ghetto-Pädagogik“ und Sicht auf die Welt verkünden, und legt ihnen immer mal wieder Worte berühmter Philosophen und Literaten in den Mund. Frei nach dem Motto W.E.B. Du Bois für jedermann!
An solchen Stellen wird der Roman zu einer kleinen intellektuellen Schnitzeljagd, bei der sich der Leser freudig zurücklehnen darf, sollte er in der Lage sein, die sowohl weißen als auch schwarzen kulturellen Referenzen, die der Roman zahlreich aufzuweisen hat, aufzuschlüsseln.
Der Kriegsveteran Easy antwortet auf die Frage, welchen Bildungsgrad er nachweisen kann, mit: „Letzten Monat habe ich Manns Zauberberg gelesen. Davor den Unsichtbaren Mann.“
Bei aller Ironie und einem haarsträubend an Parodie grenzenden Plot ist es Mosley ernst
mit dem traditionellen afroamerikanischen Thema des passing – dem Passieren von Grenzen, dem Grenzgängertum. Bereits seinen Erstling hatte er dieser Frage gewidmet. Sein Devil in a Blue Dress war eine schöne Mulattin, ein gefallener, missbrauchter Engel: Gefährdend, aber in erster Linie ihrerseits gefährdet und damit ein echtes Opfer.
Cinnamon hingegen, ausgebildet in der Elite-Universität Berkeley und liiert mit einem Weißen, stellt vorrangig eine Gefahr dar. Nichts ist übrig vom zum Stereotyp gewordenen tragic mulatta theme. Für Cinnamon ist die Liebe ein überholtes Konzept und körperliches Begehren ein kontrollierbares Instrument. Sie wird Erfolg haben in dieser Welt, egal in welcher Farbe, und auf Easys eher verzweifelte Frage, ob sie ihn liebe, antwortet sie mit einem lakonischen: „Klar doch.“
Hier an der intimsten Stelle zwischen Mann und Frau findet Mosleys eigentlicher Krimi statt. Der Rest ist humorvoller Pulp. Ein spannender Minstrel in alle Richtungen. Der afroamerikanische Mann, hier noch in der Prä-Obama-Ära, befindet sich in einer desolaten Lage.
Während eine schwarze Frau soziale, kulturelle und ethnische Grenzen überschreiten zu können scheint, ist sie zwar gefährdet, bleibt aber begehrenswert und erhält in Mosleys Sichtweise Aufstiegsmöglichkeiten, nicht zuletzt durch die Verbindung mit einem weißen Mann.
Ein Mann, der ähnliche Grenzüberschreitungen anvisiert, riskiert, um mit Ralph Ellison zu sprechen, unsichtbar zu werden und sich selbst auszulöschen. Und so schleudern Mosleys Anti-Helden, Mouse und Easy, ihre Potenz in detaillierten, seitenlangen Beschreibungen den Frauen aller Couleur entgegen, um sich zu spüren und nicht unsichtbar zu werden.
Last but not least: Wer irgend kann, sollte sich diesen Roman im Original zu Gemüte führen, ansonsten muss man sich beim Lesen auf zahlreiche, unfreiwillig komische und ärgerliche Übersetzungsblüten „…gute [n] Taten an der Truth“ und „ …mir beklemmte wieder die Falte das Herz“, einstellen. Bleibt zu hoffen, dass der Fischer Verlag für den kommenden Mosley Blonde Faith etwas mehr Sorgfalt walten lässt.
Nadja Israel
Walter Mosley: Cinnamon Kiss. (Cinnamon Kiss, 2005). Roman.
Aus dem Amerikanischen von Uda Strätling.
Frankfurt am Main 2009: Fischer TB. 319 Seiten. 9,95 Euro.











