 Zeitgenosse Göhre
Zeitgenosse Göhre
Zu den „sonstigen“ Texten eines außergewöhnlichen Autors. Von Alf Mayer
Er hat es wieder getan – und endlich gibt es Nachschub für meine kleine heimliche Sucht. Ja, ich bin ein wenig süchtig. Nachwortsüchtig. Begierig nämlich auch auf jene Texte, die Frank Göhre außerhalb seiner Romane und Erzählungen schreibt, meist eben als Nachworte.
Diesmal heißt der Text „Es war einmal St. Pauli“ und rundet im buchstäblichen Sinne den Sammelband „Geile Meile“ ab, den der Pendragon Verlag jetzt zum 70. Geburtstag Frank Göhres herausgebracht hat. 507 Seiten Göhre sind hier versammelt, die Romane „Zappas letzter Hit“ und „St. Pauli Nacht“, die Erzählungen „Rentner in Rot“ und „Der letzte Freier“ – und zudem „Es war einmal St. Pauli“, eine Annäherung an Jürgen Roland und seine St. Pauli-Filme. 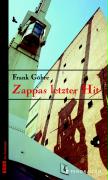
„Zappas letzter Hit“ aus dem Jahr 2006 beginnt mit der an die Wirklichkeit angelehnten Selbsttötung eines Hamburger Killers in seiner Haftzelle. Seine Ehefrau, die ihm die Waffe mitbrachte, nimmt er mit in den Tod. Zappas Tochter wie auch die Polizei ermitteln, unsichtbare Hände liegen über der Stadt. Den dritten Teil der meisterlich lakonischen Erzählstränge eröffnet Göhre mit einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal:
„Es ist mit völlig die Fähigkeit abhanden gekommen,
über irgendetwas zusammenhängend zu denken
oder zu sprechen.“
Nur für die vordergründigsten Leser mögen Göhres Romane und Erzählungen solche eine Anmutung haben. Nicht das Zerstückeln, sondern das Erweitern von Zusammenhang ist seine Methode. Er schneidet und montiert, springt und tanzt, beschleunigt und bremst, geht schnörkellos und ohne Vorreden in Szenen hinein und ebenso selbstverständlich wieder heraus, komponiert sein „Material“ mit der Souveränität eines sich seiner Kräfte und Qualitäten völlig selbstgewissen Filmemachers. Er kann aus ALLEM etwas machen. Den Göhre-Text. Den Göhre-Sound.
Man lese wieder „St. Pauli Nacht“, den zweiten in der „Geilen Meile“ versammelten Roman. Er stammt von 1993, liest sich frisch wie am ersten Tag und legt ein Tempo vor, über das man nur staunen kann. Wie Göhre hier eine groteske Hamburger Straßenszene aufdröselt und uns aus mehreren Perspektiven darauf zuführt, erinnert an das Beste von Chester Himes. Wie jener in seinem Harlem, so lässt Göhre in seinem St. Pauli die Puppen, Kerle, Polizisten und die Verhältnisse insgesamt tanzen, dass man als glücklicher Leser kaum glauben mag, was scheinbar simple, klare Sätze doch an Welt vor einem entstehen lassen können. „St. Paul Nacht“ schließt mit einem Schopenhauer-Zitat, das derart passgenau wohl noch nie eingesetzt worden ist:
„Und so endet dieser Tag, der für Fedder wie auch für etliche andere Personen das bestätigte, was Schopenhauer seinerzeit in der Schrift „Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen“ benannt hatte: Dass nämlich „das Schicksal des Einen zum Schicksal des Anderen passt, und jeder Held seines eigenen, zugleich aber Figurant im fremden Drama ist“
(Vergleichbare Roman-Enden bitte an mich einsenden. AM)
Eine besondere Kunst: anderen Autoren gerecht zu werden
Gute Schriftsteller definieren die Realität, verwandeln Fakten in Wahrheit, meinte Edward Albee: „A good writer turns fact into truth.“ Die Sache mit Fakten und Recherchen aber hat ihre Widerhaken. „The more you know, the harder it is to write“, bekannte Tim O’Brien. Nun, Frank Göhre lässt einen das niemals merken. Sein Stil ist bergbachklar. Da gibt es keine Faxen, keine Locken auf der Glatze. Und wie nur wenige andere Autoren vermag er auch noch etwas anderes – nämlich anderen Autoren gerecht zu werden.
Weltweit kenne ich im Genre der Kriminalliteratur nur eine Handvoll Autoren, die es in größerem Umfang auf sich genommen haben oder nehmen, über Kolleginnen und Kollegen zu schreiben. Die sich die Mühe machen, Werk und Meisterschaft anderer zu ergründen und Leser dafür zu werben. Mir fallen hier ein: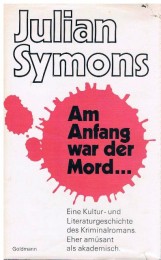
Craig McDonald: „Rogue Males. Conversations & Confrontations about the Writing Life“ (2009) und „Art in the Blood“(2006);
Jean-Patrick Manchette: „Chroniques. Essays zum Roman noir“ (1996, 2005 im DistelLiteraturVerlag);
Julian Symons: „Am Anfang war der Mord. Eine Geschichte des Kriminalromans“ (1972);
Bill Pronzini und Marcia Muller: „1001 Midnights“ (1986);
John Williams: “Into the Badlands” (1991) und „Back to the Badlands“ (2007);
Barry Gifford: „The Cavalry Charges. Writings on Books, Films and Music“ (2007) oder sein Film-Noir-Buch “The Devils Thumbs A Ride” (1998);
Stuart Kaminski: „Behind the Mystery“ (2005):
Keiner von ihnen, keiner, aber hat für solche Annäherungen einen derart eigenen Stil entwickelt, wie er Frank Göhre auszeichnet. Soviel Coolness, Lakonie und Lässigkeit, Demut und Sicherheit im simplen Strich hat sonst keiner. Zu sehr sind viele dieser anderen Porträtisten und Essayisten einem sozusagen journalistischen Einordnungsmuster verhaftet, kommen nicht aus ohne Superlative, Relativsätze oder gönnerhaftes Lob. Bei Göhre begegnen wir anderen Autoren so selbstverständlich als wären es Naturschönheiten. Da geht es nicht um Hierarchie, sondern um einen klaren Blick. Einfach darum, vom fremden Quellwasser zu schmecken. Göhre schafft es – immer und zuverlässig -, dass sich die Essenz eines Autors vermittelt. Irgendwie ist dabei klar: Er fühlt in die Welt und in sich, er redet über das Selbstverständnis eines anderen und zugleich über sein eigenes. Ohne viel Aufhebens darum zu machen. Ein Zeitgenosse.
„Es war einmal St. Pauli“
Das gilt auch für Jürgen Roland und seine St. Pauli-Filme, deren Entstehung und Umfeld Frank Göhre in seinem Abschlußtext in „Geile Meile“ lebendig werden lässt. O-Töne, eine der Spezialitäten Göhres, gibt es zuhauf in diesem Rückblick auf die Filme „Polizeirevier Davidswache“ (1964) und „Die Engel von St. Pauli“ (1969). Wie der Chef von atlas film Duisburg die Finanzierung übernahm, wie es zur Mitarbeit von Polizei und Milieu kam und zur Drehgenehmigung in der Herbertstraße, wie Helmut Schmidt einen Ratschlag gab und wie der Reeperbahnkönig Wilfrid Schulz seine venezianischen Vase günstig ersteigerte, was an Dakota-Uwe so erinnerungswürdig bleibt, wie der hässliche Herbert Fux all die Frauen dazu brachte, sich von ihm pudern zu lassen, wie die Polizei landesweit diesen Film zu ihrer Sache machte, ihm sozusagen Polizeischutz gab und mit Streifenwagen und heute wohl „Testimonials“ genannten Öffentlichkeitsbekundungen mit zum 3,2-Millionen-Besuchererfolg beitrug. Ich habe den Text sofort wieder von vorne begonnen, als ich das erste Mal durch war, mir dann mehr Zeit genommen für als die Feinheiten des einfachen sprachlichen Ausdrucks in diesem knappen, stimmigen, lange nachschwingenden Text, der ohne ein Gramm Fett oder Schwabbel daher kommt. Wie alles von Göhre. Jesus Maria. Und Josef. Ein Abgesang ist es auch auf „Das Loch zur Welt“. Es war einmal die Reeperbahn, heißt es da. Die sterile Phantasmorgie am Ende: ein cleaner „“HH Superdome“. So sei es denn. Amen.
Weit mehr als „blurbs“
„Es war einmal St. Pauli“ ist beileibe nicht sein einziger solcher Text. Frank Göhre hat schon oft vollbracht, was für viele Autoren fast eine Art Tabu darstellt, einen offensichtlich schwierig bis unmöglichen Akt der Selbstüberwindung und Öffnung, mehr eben, weit mehr, als ein schneller, freundlicher „blurb“ für einen anderen Autor an Aktion erfordert. Aus der Redakteursperspektive weiß ich, wovon ich hier rede. In der Zeit nach dem deutschen Herbst, in den späten Siebzigern bis Mitte der Achtziger, war ich einer von zwei Redakteuren einer Medien-Zeitschrift, bei deren Gründung das „Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik“ die Etablierung einer irgend gearteten Aufsicht vergessen hatte, wir also freie Hand mit allem Texten hatten, soweit wir zwei uns nur einig waren. Eines unserer ehernen Gesetze lautete, Texte niemals zu zensieren – zu redigieren ja, aber keine Aussage abzuschwächen. Es war eine Zeit der intellektuellen Überheblichkeit, in der es Wellen schlug, als ich den damals noch unbekannten Filmkritiker Georg Seeßlen aus einem Multiplexkino rezensieren ließ: jeden Film, der dort an einem bestimmten Wochenende lief, und eben nicht nur den einen, der die Feuilletons beherrschte. Oder jene drei Kritiker, die dann jahrelang mit mir nicht mehr redeten, weil ich es gewagt hatte, sie alle drei auf den gleichen Film anzusetzen und die Texte nebeneinander zu stellen. Damals versuchten wir wieder und wieder, Dutzende von Gesprächen sind mir in Erinnerung, Film- und Buchautoren über andere Bücher und Filme und Œvres schreiben zu lassen. Es ging nicht, oder kaum. Die Ausflüchte variierten, unterm Strich blieb: Warum soviel labor of love für einen anderen, wo meine eigene Produktion doch schon solche Kräfte fordert – und mir solche Lektüre vielleicht fremde Flausen in den Kopf setzt.
Wie wählt man Filme aus? Wie Frauen. Man riskiert etwas…
Paul Theroux sieht Schreiben als „praktisch die einzige Aktivität, die keinen Wettbewerbsgeist erfordert“. Ist das so? Legt das Wissen um die Qualität anderer die Maßstäbe an die eigene nicht noch höher? Sicher ist ein solches Indieweltfühlen eine Form der Selbstreflektion und der Herausforderung, ganz im Sinne von James Sallis: „You have to keep challenging yourself.“
Frank Göhre hat das immer schon gemacht. Schon die Kinogeschichten in „Im Palast der Träume“ von 1983 (Reihe rororo panther) sind eine perfekte Collage von O-Tönen, nacherzählten Unterhaltungen und Kurzgeschichten – und sie zeigen, dass sein Herz immer schon dem Kriminalroman und dem Kino gehört hat. Und den Frauen .
Am Anfang der Kinogeschichten „Im Palast der Träume“ (rororo panther, 1983) erzählt Göhre aus Claude Lelouchs „Ein glückliches Jahr“. Der Gangster Simon, gespielt von Lino Ventura, wird dort bei einem Weihnachtsessen in feiner Gesellschaft gefragt, ob er denn keine Filmkritiken lese. Nein, sagt Ventura, den Kopf schräg angelegt, und mit einem Blick, der uns ankündigt, dass er jetzt die Faxen dicke hat. Wie wählen Sie dann die Filme aus? Wie Frauen, sagt Ventura. Ich riskiere was.
Gesten der Zuwendung
Seinen Freunden, schreibt Göhre, verheimliche er die nachmittäglichen Kinobesuche.
War an der Alster spazieren, Eis gegessen, gutes Buch gelesen. Schöner Tag. In Wirklichkeit ist es nicht immer die reine Freude, die ihn ins Kino treibt, nachmittags um drei. Die ihm widerwärtig gewordene Stadt mit ihren pflegeleichten Bewohnern ist dann außen vor. Er ist dann oft allein im Kino. Die Filme entsprechen der Stimmung. Sie sind düster, unsäglich schlecht gemacht, brutal und blöde. Die Handlung ist auf ein Minimum reduziert, die Dialogliste kann nicht mehr als drei Seiten umfassen. Es wird geprügelt, geschossen und vergewaltigt. Jede Menge Wagen gehen zu Bruch, explodieren gekonnt, am Schluss bleckt ein mieser Bulle die Zähne: Yes, Sir, die Stadt ist wieder sauber.
Göhre erzählt aus der Zeit, als Kino etwas für Proleten war und der Herr Verwaltungsdirektor den Knirps, der seinen Sprössling zum Kinogehen abholen will, zurechtweist: Das muss ein Missverständnis sein, unser Sohn geht nicht ins Kino. Und die Tür zuschlägt. Horst Königstein rekapituliert, so wörtlich, muffige Erinnerungen, deren pubertäre Geilheit kaum noch wiederzuerwecken ist. Bernhard Lassahn hat es nach Filmen mit Diane Keaton, Geraldine Chaplin oder Nastassia Kinski noch schwerer, eine geeignete Frau zu finden. Göhre kann das nachvollziehen, ihm geht es so mit Brigitte Bardot. Dazwischen gibt es Erinnerungen an die „Illustrierte Film-Bühne“ und abgebildete Eintrittskarten von Metropolis, Abaton, Klick, Grindel, Broadway Gerhofstraße, sogar den legendären Fehldruck: Brodway, sowie einen wunderschön ausführlichen Abspann, in dem sich zeigt, dass unter anderem Antje Kunstmann und Hans Magnus Enzensberger Texte und Kinoerlebnisse beigetragen haben.
Am Schluss steht ein Zitat von Peter W. Jansen:
„Ich weiß nicht, ob das Kino stirbt, ob es überlebt, ob es noch gebraucht wird. Ich weiß nur, dass Kino genau die Arbeit ist, die im Grunde dem Vergnügen gleicht, der Lust, dem Pläsier, der Libido. Denn es sind die gleichen Gesten wie bei der Liebe, nicht unbedingt der gleiche Rhythmus, aber die gleichen Gesten. Die Gesten der Zuwendung.“
Gesten der Zuwendung, so sehe ich all die Nachworte und „Sondertexte“ Göhres.
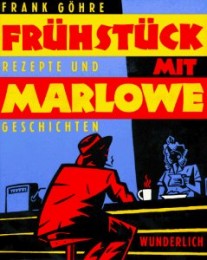 Der Thrill des guten Essens
Der Thrill des guten Essens
Zu den schönsten Krimibüchern, die ich besitze, gehört das großformatige, von Hendrik Dorgarthen illustrierte „Frühstück mit Marlowe. Rezepte und Geschichten“ (Wunderlich im Rowohlt Verlag) aus dem Jahr 1991, in dem Göhre das Kunststück fertig bringt, 180 Rezepte aus Kriminalromanen zu versammeln und vorzustellen, also eine Geschichte der Kulinaristik im Genre und gleichzeitig den damals, Anfang der 1990er geltenden avancierten Kanon der Kriminalliteratur kenntnisreich und anschaulich aufzublättern. Die Treffsicherheit der Urteile und Porträts verblüfft noch heute, macht das Buch zu einem Standardwerk. Abgesehen davon, dass es einige wirklich klasse Rezepte hat. Damit meine ich nicht Kaffee mit Eiswasser (Seite 20):
Trinken Sie drei Tassen Kaffee, schwarz und heiß. Wenn Sie diese intus haben, halten Sie ihren Kopf einige Minuten lang unter fließendes, eiskaltes Wasser. Danach sind Sie vermutlich in der Lage, einen ersten Blick auf die Morgenzeitungen zu werfen. – Gut. Ziehen Sie sich jetzt langsam an und kochen Sie zwei Eier – maximal 4 ½ Minuten.
Kaum ein Krimi, stellt Göhre in der Einleitung fest, in dem nicht vom Essen die Rede ist – sei es als knapper Hinweis auf ein ausgiebiges Frühstück oder, weitaus häufiger, als detaillierte Beschreibung selbst kreierter Gerichte. Mehr und mehr, fasst er seine Lektüren zusammen,
„verstärkte sich bei mir der Eindruck, daß zwischen genüßlichem Verzehr und aufzuklärenden Mordfällen ein Zusammenhang besteht: Detektive und Kommissare sind Jäger, die Verbrecher, die Mörder sind das von ihnen gejagte Wild. Bevor sie es endgültig zur Strecke gebracht haben, verleiben sie sich ersatzweise die verschiedensten Speisen ein.“
Göhre vermittelt uns die Koch- und Schreibkünste von: Jim Thompson, Raymond Chandler, James Ellroy, Sue Grafton, L.A. Morse, Jerry Oster, Chester Himes, Robert B. Parker, Rick Boyer, William Wingate, Anne D. LeClaire und Charles Willeford, dessen Hoke Mosley ein künstliches Gebiss trägt, weil er Geld sparen wollte, er porträtiert Vázquez Montalbán und seinen genußsüchtigen Privatdetektiv José „Pepe“ Carvalho, Delacorte und seinen genialer Verbrecher Serge, den gern in Gasthäusern abhockenden, mit einem guten Appetit ausgestatteten Wachtmeister Studer des Friedrich Glauser, der weiß, dass zu einem Mord ein Schuldiger gehört „wie der der Anken aufs Brot, sonst reklamieren die Leute“, dann gibt es noch Poul Orum mit Jonas Morck und Knut Ejnarsen, Mai Sjöwall und Per Wahlöö mit ihren Polizisten von der Rikspolis, Janwillem van de Wetering und seinen Brigadier de Gier sowie die Gelüste des Alfred Hitchcock. Was für ein Buch, was für eine ebenso kenntnisreiche wie liebevolle Arbeit.
Ins Gewicht fällt da nicht, dass Göhre offenkundig Freelings „Kitchen Book“ (1991) und Len Deightons „ABC of French Food” (1989) entgangen sind. Schwamm drüber. Stattdessen wird nun eine Verneigung fällig vor Günther Butkus, dessen Pendragon Verlag viele Werke von Frank Göhre vorrätig hält. Editorisch vorbildlich und witzig-klug auch die dort erschienenen Göhre-Textsammlungen „Seelenlandschaften“ und „I and I“. Göhres Engagement bei der Entdeckung von Friedrich Glauser ist sprichwörtlich, kaum ein zeitgenössischer Autor hat sich so sehr und so emphatisch um einen Vorgänger in Geist & Sache verdient gemacht, so viel Herzblut eingesetzt. Das wir alle „unseren Glauser“ kennen und zu würdigen wissen, ist in weitesten Teilen Frank Göhre zuzuschreiben. Als Motto zu „Frühstück mit Marlowe“ steht ein Zitat ein Glauser:
„Die meisten Schriftsteller können nichts, weil sie die Rudimente der Kochkunst nicht verstehen.“
Landschaften und Reisen – Das Andere schmecken
“Seelenlandschaften” mit dem Untertitel „Annäherungen, Rückblicke“ (Pendragon Verlag, 2009) versammelt folgende Texte: eine Annäherung an Friedrich Glauser, einen Nachruf auf Hansjörg Martin, die Chronique scandaleuse Friedhelm Werremeiers, Porträts von Irene Rodrian, Helga Riedel, dem deutschen Thrillerautor Peter Schmidt, Peter Zeindler, dem Reporter Hans Herbst, vor dem Göhre ausdrücklich den Gut zieht (und dessen Werkausgabe eine weitere Zierde des Pendragon Verlages darstellt), die Geschichten der Filme „St. Pauli Nacht“ und „Abwärts“, Ausflüge zu Willefords Hoke Mosley, zum Rock n Roll Reporter Ed Sanders, zum Häftling, Autor und Darsteller Edward Bunker und zu den Seelenlandschaften Tony Hillermans.
Den Band „Kreuzverhör. Zur Geschichte des deutschsprachigen Kriminalromans“ (1999, gemeinsam mi Jürgen Alberts), lasse ich hier außen vor, aber auch er gehört in diese Sammlung der Ausflüge zu Geistesverwandten, Gleichgesinnten, Vorbildern und Blutsbrüdern.
„I and I. Stories und Reportagen“ (Pendragon Verlag, 2012) beginnt mit einer Hommage an Hubert Fichte, hat eine den Titel gebende, durchgeknallte Jamaikareise („Walking down the road with a pistol in your waist, Johnny you’re too bad“), an deren Ende sich selbst bei Göhre dann die Haare kräuseln, gleich im Anschluss ein Porträt des Yardies Victor Headley und des Londoner Stadtteils Tottenham. Für das große Amsterdam-Porträt verbrachte Göhre ausgiebig Zeit vor Ort, es beginnt damit, dass ein Inspektor Van der Falk einen gewissen Nicholas Freeling verhört, wir davon erfahren, dass Freelings „Love in Amsterdam“ als Liebesgeschichte gedacht war und erfolgreich als Kriminalroman vermarktet wurde, wir treffen Janwillem van de Wetering ebenso wie dem Jazz-Krimiautor Bill Moody. Göhre nimmt uns mit zu Ernest Tidyman, dem Erfinder von „Shaft“, zu James Crumley, Daniel Woodrell, David Osborn. Mehrmals nähert Göhre sich dem Filmregisseur Jean-Pierre Melville, wir begegnen Martin Scorseses Film „GoodFellas“, Michael Manns „Heat“ und einem stinknormalen Fernsehtag des Bayerischen Rundfunks.
Und dann, zum Abschluss, ein Satz, ein einziger und letzter Satz, zum Gewerbe des Autors. Zweieinhalb Seiten lang. Böse.
Das kann Frank Göhre auch sein. Oh ja.
P.S. Zwischendurch gibt es in „I und I“ kurze Einwürfe, in denen Göhre Vorbilder und Einflüsse benennt, etwa in der „Fußnote.Musik“:
„Ich erzähle etwas, ich breche die Erzählung durch eine Komprimierung auf bestimmte Punkte … Ich arbeite mit dem Prinzip schneller Videoclips, die eine Landschaft kurz abgrasen und die etwas freisetzen… In mir entsteht dann das Gefühl, jetzt müßte es wieder ruhigere Erzählmomente geben. Bevor ich damit weitermache. Es hat etwas mit Musik zu tun. Ich bin ein großer Musikliebhaber von Jazz, von Miles Davis angefangen bis Jan Gabarek, also Musik, bei der die Momente von Improvisation mit denen der Komposition abwechseln.“
Müßig zu sagen, daß Virtuosität die Voraussetzung solch innerer Freiheit ist. Deshalb bin ich glücklich, wenn ich Göhre lese.
Die hier erwähnten Bücher von Frank Göhre:
Geile Meile, Pendragon 2013
Im Palast der Träume, rororo 1983
Frühstück mit Marlowe, Wunderlich 1991
Kreuzverhör. Zur Geschichte des deutschsprachigen Kriminalromans“, Gerstenberg 1999
MO – Der Lebensroman des Friedrich Glauser, Pendragon 2008
Seelenlandschaften: Annäherungen, Rückblicke, Pendragon 2009
I and I. Stories und Reportagen, Pendragon 2012











