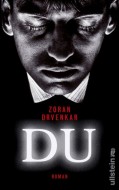 DU – Brrrr, Literatur:
DU – Brrrr, Literatur:
Das Buch ist ein Megahype – Friedemann Sprenger war neugierig.
Literatur entsteht unter anderem durch künstlerische Operationen, durch literarische Verfahren, durch ästhetische Arrangements von Text. Besonders unter Literaturverdacht, und auch von jedem, aber auch wirklich jedem Leser sofort und ohne Anhieb zu erkennen, steht ein Text (wir reden von Prosa) dann, wenn ein einzelner Kunstgriff überdeutlich hervortritt. Sich mehr oder weniger immer wieder brüllend bemerkbar macht und vor allem das einzige literarische Verfahren ist, das der Autor aufbietet.
So wie in Zoran Drvenkars Roman „DU“ die permanente Leseranrede, über lange 575 Seiten hin. In „DU“ duzen alle Erzähler und Erzählerinnen sich selbst. Zur besseren Orientierung für die nicht so cleveren Leser schreibt der Autor über jedes Kapitel, wer gerade redet, wer sich gerade duzt. Das ist nützlich, denn man muss immer nur wieder ein paar Seiten zurückblättern, dann weiß man wieder Bescheid. Erzähler sind beinahe alle im Roman auftauchenden Figuren: fünf Berliner Girlies resp. Lolitas, ein Gangster, der Sohn des Gangsters, ein Serialkiller, der Sohn des Serialkillers und diverse andere Figuren mit (meist) begrenzter Haltbarkeit. Eine Ausnahme sind zwei Killer namens „Oswald & Bruno“. Die werden von einem auktorialen Erzähler beschrieben und entfallen dann schnell final aus der Handlung. Ach ja, die aparteste Erzählerstimme, die sich duzt, gehört Oskar. Der ist aber tot und erzählt sich selbst, wie er in seiner Tiefkühltruhe allmählich zerfällt. Oskar ist nicht komisch gemeint. Aber unfreiwillig komisch ist der Kniff hier schon, weil das Prinzip starr durchgezogen wird und für die Situation unangemessen ist.
Würg, gröh!
Ein solcher Kunstgriff erzielt vor allem Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit, die die Geschichte des Romans möglicherweise nicht so ohne weiteres erzielt hätte. Das Bauprinzip ist eher unterkomplex: Zwei große Erzählstränge werden am Ende – surprise, surprise – zusammengeführt. Der eine schildert die abscheulichen Untaten eines Serialkillers, der halt einfach serialkillt. Einmal rottet er einen ganzen Stau auf der Autobahn aus, einmal ein ganzes Dorf, dann ein ganzes Hotel und einen ganzen IC. Er tötet mit seinen Händen, er würgt, erstickt, stranguliert und bricht Genicke, knack. Er bringt es auf ein paar hundert Leichen, und das mitten in Deutschland. Er hat kein Motiv, das irgendwie einsichtig wäre und ist sonst ein ganz normaler Bürger. Keine Polizei kommt ihm je nahe. Er ist aber keine Parodie, sondern eine bierernst als „dämonisch“ gezeichnete Figur, vor der wir uns arg gruseln sollen. „Der Reisende“, so heißt der Strolch, ist aber vor allem eines: peinlich papiern.
Papi mag nicht
Der zweite Strang ist womöglich noch unterkomplexer: Girlie/Lolita mit inzestuösem Verhältnis zu Papi bringt selbigen um, weil er sie nicht länger vögeln will, findet Drogen im Wert von Millionen und will sie mit Hilfe ihrer vier besten Freundinnen an Onkel Ragnar verticken, dem sie ohnehin gehören und der sie nur bei Vati (r.i.p. – es ist Oskar, die Plapperleiche aus der Tiefkühltruhe) zwischengelagert hatte. Gangster Ragnar wird uns einerseits als top-notch megacooler Superobergangster mit Durchblick vorgestellt, fängt aber, statt den Gören ein paar auf die Ohren zu geben und sein Rauschgift wieder einzusammeln, einen dilettantisch blutigen Rachefeldzug gegen die Mädels an, der zum Showdown nach Norwegen führt, wo inzwischen auch Erzählstrang numero uno, also „Der Reisende“ angekommen ist. Leichen pflastern den Weg von Ragnars Gang, die – bevor sie zu Leichen werden – sich auch eine Menge zu erzählen haben, im „Du“-Modus, versteht sich. Das zieht sich über die hunderte und aberhunderte Seiten wie Kaugummi. Man möchte die Passagen, in denen die einzelnen Ichs sich jeweils über ihre Befindlichkeiten und ihre schlimme Kindheit und was weiß ich ausmähren, flott überblättern (was man nicht tut, weil man das Buch ja fromm bespricht), so wie früher diejenigen Seiten bei Karl May, auf denen pausenlos gebetet und fromme Gedanken gehegt wurde. Denn was immer wir über die Figuren erfahren, macht sie nicht plausibler, sondern stattet sie höchstens mit einer Art Scheintiefe aus, die sich aufplustert, wie der Psychologische Realismus des 19. Jahrhunderts sich de facto nie aufgeplustert hat: Girlies plappern wie Girlies; Gangster sind knallhart und versaut von Papi; Jungs geiern hinter Mädels her. Aber bei Drvenkar ist das eher uninteressant. Spannend ist allerhöchstens, wie und wann sich die Zahl der MitspielerInnen reduziert. Wenn auch nicht wirklich sehr spannend, denn die karge Geschichte lässt kaum Wendungen zu, kaum Überraschungen, kaum Clous. Dass bei so viel Klischeeclustern dann doch noch ein Inzest (s.o., kaum noch ein Krimi ohne einen Betroffenheitsgassenhauer aus den beliebten Kategorien Pädophilie oder Inzest oder sonst was mit Kindern) aufkommt, das hätte ich mir beinahe schon gedacht. Und bingo – …
Die Literatur-Blase
Auch wenn Drvenkar den Teenie-Talk gut beherrscht und dabei ein paar hübsche Sprüche abfallen – der Roman bleibt getragen pathetisch und bedeutungsvoll mit Emo-Kitsch und Befindlichkeitsromantik vollgestopft. Der völlig überzeichnete Serialkiller (buchhalterisch, nicht literarisch) ist noch nicht einmal dämonisch. Er killt halt. Das ist nun mal sein Beruf, da darf man ihm nicht böse sein. Realistisch ist er nicht, metaphorisch auch nicht. Der Gangster ist nur böse, kein bisschen bizarr, kein bisschen schräg, realistisch ist er genauso wenig wie metaphorisch. Er ist ein böser, dummer Gangster, das ist seine Aufgabe im Text. Auch ihm darf man deswegen nicht gram sein.
Böse sein darf man aber dem Autor, weil er – als wär das Buch so nicht schon schlicht genug – böse schlampt. Man muss gar nicht lange lesen, um zu lernen, dass es im Jahre 1995 anscheinend schon Navis in den Autos gab, oder dass jemand vom Fahrtwind eines „kriechenden“ LKWs auf der Gegenfahrbahn beinahe umgeworfen wird. Datierungsfehler mit Handys und DVDs finden sich später noch mehr. Das ist zwar lässlich, spricht aber nicht dafür, dass uns der Autor (oder gar das Lektorat?) mit einem handwerklich soliden Werk erfreuen wollte. Aber wenn es noch nicht einmal das ist, was dann?
Betäubt …
Wenn das einzige ausmachbare literarische Verfahren so überdeutlich alle anderen Komponenten übertäubt, die einen Qualitätstext ausmachen könnten, dann hat der Autor damit vielleicht ein Distinktionsschnäppchen gemacht und kann kalkulieren, dass man ihm auf den Leim geht und das Buch mit einem Literarizitätsbonus ausstattet und es deswegen lieber mal toll findet. You´ll never know … Ab dann greift die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (cf. Georg Franck). Aber mit einem guten (Kriminal-)Roman, der womöglich auch noch irgendwo in irgendeiner Realität verankert sein möchte, hat die ganze Angelegenheit weniger zu tun. Und für einen schnellen, gemeinen Kriminalroman, der sich in Action und Tempo ausdrücken möchte, ist er zu aufgeplustert und ambitionös. Ästhetische Aufmerksamkeit, die man dem Roman gutwillig entgegenbringen möchte, wird schon bald durch dessen blanke Belanglosigkeit anästhesiert.
Friedemann Sprenger
Zoran Drvenkar: DU. Roman. Berlin: Ullstein 2010. 575 Seiten. 19,95 Euro.











