zettels raum
express! Eine neue Form von Kritik. Wir exp_erimentieren mit neuen Ansätzen in der digitalen Literaturkritik. Wer denkt wie und warum? Was sagt die Autorin dazu? Können Sie das nachvollziehen? Interaktiv und transparent - eine demokratische Debatte über Literatur. Zwei Literaturkritikerinnen und eine Autorin im Dialog.
In der 4. Folge der Reihe reden Kristoffer Cornils und David Frühauf mit Tim Holland über seinen Debutband vom wuchern, erschienen im gutleut Verlag 2016. Es geht weiter ...
Nachdenken auf Bäumen

Auf toten Bäumen über Bäume nachdenken, allein schon das: sehr meta. Aber schlagen wir mal einen Weg durchs Dickicht und fangen mit dem Schwierigsten an, um die Sache etwas einfacher zu gestalten: der Beschreibung der Form. Tim Hollands Debütband Vom Wuchern kommt als aufklappbare Mappe daher, die einerseits eine faltbare Karte mit darauf verstreuten (oder: systemisch angeordneten?) Gedichten enthält und andererseits ein kleines Büchlein mit dem Titel Theorie des Waldes.
Am Anfang steht also bereits eine Entscheidung, die zwischen dem poetologischen Überbau oder der Beschäftigung mit dem poetischen Material. Das allerdings ist schon wieder eine sehr strikte und vielleicht willkürliche Grenzziehung, denn die Theorie kommt bei Holland in lyrisch-grafischer Form und die Lyrik nicht ohne theoretische Anteile aus. Schon auf dem Cover von Theorie des Waldes, dem Buch im Buch, werden die Verschränkungen und Verschiebungen zwischen Semantik und Phonetik grafisch entlarvt:
wald ↔ wand
↕ ↕
wild ↔ wind
In der Theorie des Waldes - ich nehme einfach mal diese Abzweigung zuerst - geht es ähnlich weiter. Wie ein Mallarméscher Würfelwurf verstreuen sich die Wörter in unterschiedlichen Fonts über die weißen Seiten, ergänzt werden sie von grob geschwungenen oder schraffierten Bleistiftzeichnungen. »supermarkierter wald / strichcode wald« steht beispielsweise auf derselben Seite, auf der auch ein paar wüste, parallel verlaufende Striche zu sehen sind. Natürlich erkenne ich diese abstrakten Kritzeleien dann auch: als Wald. Aber wieso eigentlich? Ist das nicht nur eine Art interpretatorischer Reflex, der auf die Kontextualisierung vom Gesehenen durch Sprache erfolgt? Anders gefragt: Lasse ich mich hier gerade verarschen? Von Holland, oder aber der Sprache als System, das Sinn und Ordnung zugleich schafft?
Diskussion
die relation des baumes zum wald

System, Sinn. Sprache, Struktur. Gleich zu Beginn mit der Axt in den Wald gerannt, um Signifikantes von Signifikatem zu spalten (hier Bleistiftstrich, dort Erläuterung; oder anders gesagt: Wie man den Wald ruft, so heißt er dann auch), doch dabei dem einen Zeichensystem vielleicht zu schnell den Vorzug gegeben, d.h. die Vormachtstellung im interpretatorischen Reflex wird mir fast zu früh hier schon dem Wort zuteil. Denn: Ist es wirklich ganz so einfach? Sehe ich den Wald vor lauter Wörtern erst entstehen? Oder verklärt nicht da zuvor das Bild schon den sprachlichen Trieb (so wie auch mir hier aufgrund des Buches vom wuchern das Metaphernfeld meiner Kritik einigermaßen abgesteckt sich offeriert)? Wiegt denn überhaupt, wenn man so sagen kann, der Ein- oder der Ausdruck schwerer im oben angeführten Beispiel vom »supermarkierte[n] wald« – und zwar noch ohne irgendwas zur inhaltlichen Seite gesagt zu haben? Oder nicht vielleicht doch eher, unverschämt gefragt, allen voran das Auf-der-Hand-Liegende: das gedruckte Buch mit Mappe, Karte, Theoriebuch?
»wurzelst du in der tiefe des himmels?
greifst du in den bewegten bestand?«
Kein und, kein oder trennt und/oder verbindet diese Verse (die mir beim ersten, rein die Oberfläche Lesen ähnlich programmatisch für das Buch vom wuchern erscheinen wie das von Kristoffer hervorgehobene Cover von theorie des waldes), bis auf das angesprochene Subjekt »du« zunächst kein Bindeglied. Dieses Subjekt aber, diese/r Angerufene ist es sogleich, an der/dem es ganz offensichtlich ist, eine Entscheidung zu treffen für oder wider (so lese ich das) Seh- und Lesegewohnheiten (von links nach rechts in der Tiefe wurzeln oder doch sich im Bestehenden ganz frei bewegen). Ein mesomerer Zustand also, nicht nur zwischen »wald«, »wand«, »wild«, »wind«, sondern – zumindest so die vorläufige Behauptung – ganz augenscheinlich ausgestellt auch zwischen Buchobjekt und RezipientIn. Weshalb es mir auf den ersten Blick viel weniger wie ein vom Autor ausgeschildertes Dickicht scheint, auch nicht wie ein unbedingtes Abhängigkeits- und Bindungsverhältnis von Bild und Wort, Signifikat und -kant, Satz auf Seite o.ä., sondern basaler eher: wie eine Aufforderung, sich eigene Wege, Relationen zu erschließen, nicht blind der Karte zu vertrauen.
Diskussion
Kommentare
Der/die mündige Leser_in verarscht sich nur selbst.
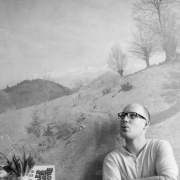
Statt sich am Blattwerk aufzuhalten, greifen die Herren gleich beherzt nach den Wurzeln. Also ihnen nach. Auffallend am Griff in die Tiefe ist, dass man sogleich sprachlich dem Wald erliegt (vonwegen Wege durchs Dickicht schlagen etc.).
Aber vielleicht geht’s ja gerade darum. Das der Text schon von sich aus über sich spricht. Die Tiefe gibt’s gar nicht, oder ist eine andere, und das worüber wir gerade sprechen, kondensiert an der Oberfläche. Wenn man die entsprechend getönte Brille aufsetzt, ist jeder Text selbstreflexiv. Plötzlich programmatisierts überall. Da den Keil zwischen „poetologischen Überbau“ und „poetischen Material“ anzusetzen scheint mir unansehnliche Scheite zu geben. Vielmehr ist es ja wirklich eins, durch „Verschiebung und Verschränkung“ scheint mal das eine klarer, mal das andere. Dafür ist eine Gleitsichtbrille gefragt. Funkenschlag dazwischen gibt’s hoffentlich.
Wo es hier konkret programmatisch wird, ist bei der Ordnung: die Ordnung ist programmatisch offen – nein, nicht „hermetisch offen“. Wobei das natürlich schon wieder nicht stimmt, weil Sprache ansich Ordnung und System ist und auch gebietet. Im kleinen werden die Buchstaben und Laute gereiht, dann würfelt die Grammatik die Wörter zusammen. Ab diesem Zeitpunkt wirds schwierig. Lieber den bekannten Mustern folgen oder bisher ungedachte Kausalitäten zulassen?
Vielleicht besser: der Text bietet mehrere - nicht beliebige - Ordnungsmöglichkeiten. Es gibt Kontexte, Subtexte, Paratexte. Die sind aber auch nur momentan gedacht. Ordnung ist da, um sie wieder zu zerstören. Schließlich machts am meisten Spaß, aus dem aufgeräumten Kinderzimmer einen Saustall zu machen. Schließlich ist nach meinem Verständnis der Text ein sich veränderndes Ding (ich war versucht „lebendiges“ zu schreiben, habe mich aber erschreckt).
Das ein Text mehr als nur eine Ordnung offeriert, scheint mir dringend notwendig und hat wohl mit soetwas wie meinem Verständnis von Gegenwart und Welt zu tun. Da ist nichts fertig, da muss man sich selber einen Reim drauf machen. In diesem Sinne verarscht sich der/die mündige Leser_in nur selbst.
Ordnung= Rodung + n
Diskussion
Kommentare
Eine Art Park

Die Zeile »ordnung = rodung + n«, die du selbst aus dem Band - genauer gesagt: aus der Theorie des Waldes - zitierst, habe ich mir auch mit fettem Ausrufezeichen dahinter in mein abgegriffenes Notizheft abgeschrieben. Ich frage mich mittlerweile, wieso. Vor allem wieso mit Ausrufezeichen.
Klar, es ist ein cleveres Anagramm. Eines, das einerseits das Prinzip der Ordnung in seiner Beschaffenheit oder viel besser noch Geschaffenheit hinterfragt und andererseits wieder die Brücke in Richtung der semantischen Umgebung schlägt: Wo Rodung ist, war ja mal Wald. Bonuspunkt für das implizite Riff auf den naturalistischen Leitspruch »Kunst = Natur - x« von, na, wie hieß er noch gleich, ach ja: Holz. Ich schätze, ich habe mir das deshalb in mein Notizheft geschrieben, weil ich sowieso gerade im Park war, als ich die Theorie des Waldes las - und was ist ein Park schon mehr als Rodung + n?
Irgendwie aber finde ich das jetzt streberhaft und damit vielleicht diese Ordnung gar nicht so programmatisch offen, wie du es selbst behauptest, Tim. Davids Vermutung, es handle sich eher um eine »Aufforderung, sich eigene Wege, Relationen zu erschließen, nicht blind der Karte zu vertrauen« scheint mir nicht basal, sondern eher banal. Fast frage ich mich sogar, ob ich das nicht sogar für eine Art evidenten Trugschluss halte: Ja, klar, ich kann mich diesem Büchlein und dem darin Enthaltenen einigermaßen frei nähern, kann mich entweder in das mit Theorie überschriebene Bändchen stürzen oder die Karte auffalten und darin jeweils kreuz- und querwärts lesen. Aber das ist eben auch seine fixe Struktur, sowohl formal wie auch sprachlich. Im Grunde nichts anderes als der Park, in den ich manchmal zum Lesen gehe.
Also: So what? War's das? Soll ich mir, wie Tim sagt, da jetzt einfach »selber einen Reim drauf machen«? Scheint mir recht selbstgenügsam, aber dann können wir heute alle immerhin früher nach Hause gehen. Oder war noch was?
Diskussion
Kommentare
Ich bin ja bloß froh, dass du
Als jemand, der den Faltplan
Mit Machete durchs Naherholungsgebiet?

Zugegeben, von urwäldischem Wildwuchs kann bei vom wuchern keineswegs die Rede sein, denn ja, es ist und bleibt ein Text, der uns teilweise als Karte, teilweise als »Theorieband« (was ange-, nein, vermessen klingt) vorliegt – geschrieben, gesetzt, gedruckt, ohne Aufforderung an irgendjemanden, selbst noch Sätze einzufügen, ohne von sich zu behaupten, anarcho-liberal, willkürlich Wörter auf ein Blatt gebracht zu haben (und somit auch ein Einwand, Tim: Die Grammatik würfelt Wörter nicht zusammen, die Verantwortung dafür, die trägst schon du). Insofern also weder ein Egglestonscher »democratic forest«, worin jedes beliebige Ding zum Vorschein kommt, noch so offen, dass man überhaupt keine Grenzen mehr sieht. Vielleicht eher eine gelenkte Demokratie (und ja, basal-banal ist dann auch dieser Kurzschluss meinerseits, denn will nicht fast jedes literarische Buch die Fantasie gezielt in eine Richtung lenken) oder ein Freizeitpark, in dem zwar die Stadtverwaltung verantwortlich ist, dass die Bäume gestutzt und die Regeln aufgestellt sind, in dem aber neben Kristoffer, der einfach bloß in Ruhe lesen möchte, auch gegrillt, Musik gehört, gespielt, »kreuz- und querwärts« (auch zwischen Theorie und Karte hin und her, nicht entweder-oder) gerannt etc. werden darf. Dass das schon Grund genug sein soll, frühzeitig nach Hause zu laufen, scheint mir so, als würde man vor dem Anpfiff das Stadion verlassen, weil man das Spielfeld ja nun bereits gesehen und als solches erkannt hat. Dabei geht es doch eigentlich gerade erst los, vom Großen zum Kleinen sozusagen, sofern ich diesen Weg hier vorschlagen darf – von der übergeordneten Struktur zu den Gedichtformen und bald schließlich auch zu dem, worum es »in Tims Text/en überhaupt[, a]lso, so inhaltlich«, geht.
»die handlungskette ist aufzudröseln, die perlen
kullern über den boden. ich falle vertrauensvoll
in die landschaft«
Also bitte: Zoom und Fokus, alles liegt schon offen an der Oberfläche, denn »[d]ie Tiefe gibt’s gar nicht« (wobei ich mich frage, ob das Understatement oder Vorwurf ist? Aber meine Zeichenanzahl ist begrenzt, deshalb bleibe ich ohnehin noch an der Oberfläche). Und auch hier zunächst scheinbar formale Strenge – über die Landkarte nachdernacht verteilen sich ein Fibonacci-Folgen-haftes Gedicht, Blöcke, Notensysteme und vor allem Pantume. Und zwischendrin beginnts zu sprießen, was mich jedoch hin und wieder auch nach der Machete fragen lässt, damit die Regelhaftigkeit erhalten bleibt. Oder gibt es eine Struktur hinter den Einschüben? Oder wünsche ich sie mir?
Diskussion
Kommentare
oberläche ist das stichwort.
ein geistige Karte, voller
das muss man doch bei jedem
Achso klar! "es ist, denke
Ich sag jetzt mal, worums geht
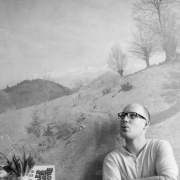
Da ich der Autor, untot und hier auch noch zur Lebendigkeit verdammt bin, machen wirs mal so:
Ich sag jetzt mal, worums geht, so inhaltlich. Es geht um Fukushima, Berichterstattung und (mediale) Katastrophen; um Liebe, natürlich unerfüllte, weil über erfüllte zu schreiben noch viel schwieriger ist; da geht es dann auch um asymptotische Annäherung, wo man crashen wollen würde (dann noch nicht nicht mehr und zurück); es geht um das Körperding und stabile Ungleichgewichte; um Big Data, und das, was das mit uns macht und in welcher Wechselbeziehung wir mit dem digitalen Gegenüber stehen; es geht ums „Wirs“; es geht um Singvögel, um Territorialverhalten und um Imitation; um Bespitzelung, „Singen“, Überwachung; es geht um den Wald, um Wiese, das Meer, nicht um den Strand, aber das Ufer und das Wasser zwischen den Ufern (sozusagen den Stream); ja, es geht um Masse und Macht (das muss man auch immer wieder lesen); es geht um den Schlaf und die Abwesenheit davon; schließlich um Identität(en), ums Flüchten, (Selbst-)Finden und Depression (#Maulwurf), es geht um soziale Netzwerke und um Logik. Gastauftritte haben Windows, Linux und Walt Disney und die Pixies und Pastior, Heißenbüttel und Beckett. Und nein, ich habe nichts vergessen.
Aber Eigentlicher geht’s um Grenzen, ganz inhaltliche Grenzen. Um Grenzen ziehen und verlegen, Ab- und Entgrenzung, um die Überwindung des scheinbar Unüberwindlichen - das #Schaflied ist ein hochpolitisch kalauerndes Schlaflied für süßeste Träume.
Das alles behaupte ich jetzt mal. Und behaupte es gerne.
Das Problem ist ja nur, das Grenzen auch Ordnungselemente sind, die sich sowohl auf der Ebene des einzelnen Textes wiederspiegeln als auch in der Konzeption des gesamten Dingens (Form/Inhalt muss ich nu aber nicht diskutieren). Jetzt kann man wieder rauszoomen.
Diskussion
Kommentare
Danke Tim. Das klingt doch
Das klingt zumindest anders,
Wir monadische Einheit

Es ist eigentlich schön, wie unser Gespräch so offen ist und sich damit zugleich verschließt - vor allen, die mitlesen. Schon wieder nimmt der Stream von express einen gewissen Lauf, der über dem Text entlangführt und eventuell sogar seine Bewegungen wi(e)derspiegelt. Ich danke also Tim für das Sinnangebot (und die Verantwortung, die er so übernimmt, das Vertrauen, das er uns damit erweist) und schlage nur das Angebot zum Rauszoomen aus. Ich will lieber in die Karte eintauchen und vielleicht dabei die Oberfläche durchbrechen.
Was sehen wir? Einen Faltplan, nicht unähnlich den Monstren, die jeden Familienurlaub mitruiniert haben, weil sich niemand darin zurechtfinden konnte. nachdernacht, so der Titel, verkompliziert sich noch mehr. Der Hintergrund lädt bereits zu Trugschlüssen ein. Links oben – dort fange ich entsprechend meiner Konditionierung an – erkenne ich eine Insel, die ich als Island lese: recht klein, abgelegen, links oben. Das ist indes falsch, denn es sind – und jetzt zoome ich kurz raus – nur solche Inseln zu sehen.
»wir sind die einzige monadische / einheit hier«, steht in dem Text, der mit block 8 überschrieben ist – ich sollte also nicht von Inseln, sondern lieber Monaden sprechen. Die Zeile finde ich interessant, weil sie im Kontext paradox scheint. Ich finde auch Fetzen wie »ich bin eins« beispielsweise, oder, nur wenige Zentimeter davon entfernt, »ich bin ein teil von dir«. Vereinte Widersprüche.
So funktionieren die Texte natürlich, als diskrete Einheiten, die sich gleichermaßen als Teil von etwas arrangieren, »eins« und also identisch mit sich selbst sind, aber zugleich damit das Gesamtbild aufsplittern. Das finde ich deshalb sehr spannend, weil es/sie damit nicht nur inhaltlich, sondern auch formal eine Erfahrung aufs Papier bringt/-en, die wir im Internet erleben: Unsere ausgelagerten, diskreten Identitäten, die gleichermaßen – big data love heißt ein Text nicht von ungefähr – als Gesamtheit erfahr- und analysierbar werden.
So habe ich beim Reinzoomen aus Versehen rausgezoomt. Ich bin versucht, zu fragen, ob vom wuchern nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Oder aber, ob ich vom wuchern gar nicht anders lesen kann. Wäre das jeweils ein Versagen für sich - und wenn ja, wer hat versagt: der Text oder ich?
Diskussion
Kommentare
Porträt des Maulwurfs als desillusionierter digital native

Langsam kristallisiert sich, will mir scheinen, ein Themenkomplex heraus, der zumindest mir die Karte neu erschließt (und das, obwohl ich die Form hinter mir lassen wollte) – las ich sie zuvor noch als reale, physisch erfahrbare Welt (Wald), in der von Baum zu Baum, von einer Insel/Monade zur anderen gewandert werden kann (und die sich insofern entgrenzen), so »drift[et] entlang der bisher vermuteten linie« meine Sicht nun hin zum Virtuellen, Digitalen. Daher auch eine Revision des Wortes »Oberfläche«: Nicht surface, sondern interface, denn die Wechselbeziehungen, die Kommunikationsversuche, der Wunsch, die/den Andere/n im (sozialen) Netzwerk und vor allem darüber hinaus greifen zu können, also all die Dinge, die »wir im Internet erleben«, werden, wie Kristoffer schreibt, »nicht nur inhaltlich, sondern auch formal [als] Erfahrung aufs Papier« gebracht und erlebbar. Wie bei einem Hypertext wird die hierarchisch lineare Ordnung zugunsten einer Multilinearität aufgegeben[1], die assoziativ-sprunghafte Struktur dem Inhalt und der Form gleichermaßen eingeschrieben und die monadischen Einheiten gehen Verbindungen (Konnexionen) ein, werden zu Vielheiten (»wir treten in schwärmen auf«), werden Teil eines Rhizoms (überhaupt lässt Deleuze, so scheint mir, in vom wuchern häufig grüßen, sei es ob der rhizomatischen Struktur, der Prozesshaftigkeit, der Komposition des Chaos’, der Faltung und also der barocken Gattungsmischung sowie Regelhaftigkeit o.a.m.). Die Konnexion hat demnach die Konjunktion ersetzt, und so tritt in einem Liebesgedicht wie big data love anstelle einer wirklich emphatischen Verbindung zweier Körper bloß noch der Kontakt über virtuelle Sphären auf den Plan (»ich suche dich/ ich sporne die suchmaschinen an«). Zwar lässt sich auch in solchen Räumen verbunden sein, wie sich etwa in dem »wir« in den Fukushima-Gedichten block 7+8 zeigt (oder auch in wir sind in bewegung), aber wenn ich der linearen Leserichtung folge und die ersten beiden Pantumzeilen lese (»nach der nacht die hände in den taschen/ leises zwicken an der schädelkalotte«), lese ich darin nun eine Ernüchterung, ein Resignieren – der Traum vom allesverbindenden Internet hat sich ausgeträumt. Und auch der Maulwurf, der zwar an sich rhizomatisch lebt, »sieht nur mit den händen gut«, d.h. auch er verlangt nach dem Realen (oder um ihm einen Pollesch-Satz ins Maul zu legen: »Ich habe Nahweltbedarf.«).
[1] Diesem skizzenhaften Interpretationsansatz folgend könnten dann die Aphorismen u.a. als zu Schrift gewordene Katzenbilder gelesen werden.
Diskussion
Kommentare
»wenn baum / dann baum«

Ich würde da mitgehen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich nimmt der Band in seiner Gesamtheit allein gewisse Strukturen auf, die wir so im Internet erleben. Nicht nur in ästhetischer und sozialer Hinsicht, wie ich das oben beschreibe, sondern auch in struktureller.
»wenn baum / dann baum // sonst gebüsch / ppürts«, steht über die ersten vier Seiten von theorie des waldes verteilt. Das lässt sich als eine Art Wittgenstein-Riff lesen und also als Strukturzwang, gegen den sich der Band auflehnt – was seinen Widerspruch ausmacht. Denn ohne streng logische Grundbedingungen wäre der Versuch der syntaktisch-semantischen Revolte im Gesamten nicht möglich.
»wenn baum / dann baum« ist im wahrsten Sinne Code, denn was ist Code schon anderes als Syntax und Semantik? Und was ist Code schon anderes als die Grundlage fürie von Tim genannten »Kontexte, Subtexte, Paratexte«, wie wir sie nicht allein in der Lyrik, sondern auch im Internet erfahren? Ist eine Metapher nicht so eine Art Hyperlink?
vom wuchern führt in seiner wuchernden Struktur sprachliche, ästhetische, theoretische und soziale Überlegungen zusammen. Aber mir persönlich führt es nicht weit genug. Denn, um nochmals Wittgenstein heranzuziehen, es scheinen mir die Grenzen von Tims Sprache zugleich die Grenzen der hier – geschaffenen, gespiegelten, abstrahierten – Welt zu sein. Vielleicht wurde dieser Prozess des Erkenntnisgewinns, der ja dankenswerter Weise kein direktes Ziel hat, bereits von diesem kleinen Merve-Bändchen vorweggenommen, das du auch völlig richtig ins Spiel bringst. Und vielleicht tröpfelt unsere Unterhaltung deshalb auch eher, als dass sie streamt: Wir haben womöglich mit einem Konsens angefangen und schlagen uns jetzt nur darum durchs Gebüsch, um weitere mögliche Bedeutungsebenen freizulegen.
Die dringlichste und zugleich banalste Frage, die ich mir stelle: Mag ich diese Texte? Sprechen sie mich ästhetisch oder emotional an? Oder sehe ich darin nur so eine Art intellektuelle Etüde – für mich, von Tim?
Diskussion
Kommentare
Der intellektuellen Etüde steht das sinnliche, dringliche Ding entgegen. Das will gelesen werden.
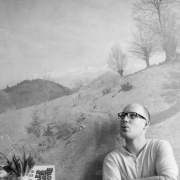
Kristoffer, deine „dringlichste und zugleich banalste Frage“ kannst du natürlich nur selbst beantworten. Aber: Handelt es sich beim vorliegenden Text um eine "intellektuelle Etüde – für mich, von Tim?"
Ich, nicht Verteidiger des Textes, sondern sein Anwalt und Zeuge, appelliere: Es handelt sich nicht um eine „intellektuelle Etüde“.
Ich greife etwas aus und gehe auf eure letzten drei Wortmeldungen ein. Sprechen wir übers Internet:
Ja, der virtuelle Raum und seine Strukturen haben sich inhaltlich und formal in den Text/ die Texte eingeschrieben und die Erfahrung des Subjektes auch formal aufs Papier gebracht (diskrete Identitäten etc.).
Einwurf: Ich finde es höchstspannend, was da, in diesem noch relativ unerforschten Raum passiert (#neuland) und wundere mich, dass es bisher sehr wenige Texte gibt, die diese Erfahrungen widerspiegeln. Hänge nur ich die ganze Zeit im Internet ab?
Gedichte, als rundgelutschte Bonbons (immer wohl im Mund zu behalten), sind für mich zum einen persönlich nicht besonders spannend, zum anderen bilden sie für mich nicht das ab, was ich täglich erfahre (#mimesis). Ich erlebe: Überforderung und Widersprüche allerorten. Ich kann nicht mehr gleichzeitig alles erfassen, nicht mehr eindeutige Antworten geben, die Hyperinformation verbietet das per se. Also: Der Text und sein/e Leser_in versagen gleichermaßen.
Das „Porträt des Maulwurfs als desillusionierter digital native“(David) gefällt mir gut. Ich bin mir nur nicht sicher, obs stimmt. Ich habe erfahren und glaube, gerade die digital natives sind doch die, die nie in die großen Utopien des Internets verliebt waren und die Grenzen des Raumes intuitiv, nämlich durch Gebrauch, begriffen. Vonwegen im Internet sind alle frei und gleich, egal ob Klasse, Rasse oder Geschlecht, alle sind mit allen verbunden. Als Sascha Lobo 2014 seine Kränkung bekannte, wurde er von den Jüngeren verlacht.
Behauptung: der Maulwurf ist nicht desillusioniert, er ist postutopisch. Und der Text ist kein Rhizom, das alles mit allem verbindet (allein weil das zu konstruieren sehr schwierig ist), es gibt DeadEnds. Die gibt es auch im Internet. Aber der Text ist ein analoger Hypertext, ein poetisches Textnetzwerk, in dem sich gegenwärtige Erfahrungen verfangen und das den digitalen Raum als Lebenswelt ernst nimmt. Die „reale, physisch erfahrbare Welt“ (David), gibt es auch im Internet. Das Virtuelle wird das Reale, das sinnlich Erfahrbare, genau so wie das Reale durch Codierung (ja, Schrift) an Abstraktion gewinnt (wenn baum, dann baum). Dazwischen Mauern hochzuziehen: problematisch.
Deswegen weiter: „ohne streng logische Grundbedingungen wäre der Versuch der syntaktisch-semantischen Revolte im Gesamten nicht möglich.“(Kristoffer). Ja, es geht ums System. Aber nicht um des System willens. Ein System wird etabliert und aufrechterhalten, aber nur so lange es notwendig ist. Genau so wichtig wie die Konstruktion des Systems, ist seine Zerschlagung oder die Flucht daraus. Sprachmaschinchen werden sabotiert, weil ich sonst auch nicht mehr schreiben müsste, die Maschinen sich selbst schrieben - uninteressant. „Intellektuelle (Sprach-) Systeme“ sind nur Leitplanken und Vehikel. Denn: Es geht um System und Sinnlichkeit.
Der intellektuellen Etüde steht das sinnliche, dringliche Ding entgegen. Das will gelesen werden.
Diskussion
Kommentare
bin ich der maulwurf?

Wars das also? Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen, die mir meine Suchmaschine auferlegt? Und der Band vom wuchern will bloß Interpretation des Wirklichen durch literarische Darstellung sein (»#mimesis«; aber: Wäre das nicht eine Nullaussage, da beinahe jeder Text das immer schon will? (und seit poststrukturalistischen Tagen wissen wir doch, dass alles bloß diskursive Konstrukte sind – was auch bedeutet: ja, touché, das Virtuelle ist das Reale und vice versa, da beides bloße sprachliche Zuschreibungen sind, doch die Mauern dazwischen ziehst selbst du, denn die Realität gewinnt nicht an Abstraktion, sondern diese ist ihr doch in jeder Sphäre bereits immanent))? Wenn es also wirklich allein das ist, was mir als »versagende/r LeserIn« mit vom wuchern erfahrbar werden soll, dann könnte man sagen: job well done, »Überforderung und Widersprüche allerorten« hast du anschaulich gemacht – aber könnte ich dazu im Grunde nicht auch einfach den Laptop öffnen und ins Internet gehen? Oder entsteht das Understatement, die affektierte Bescheidenheit dann doch erst aus der Situation heraus, dass du als Autor, »Anwalt und Zeuge« hier Erklärungen abgeben musst? Scheitere ich an einer Kritik, weil wir vom wuchern mittlerweile nur noch als Referenzpunkt betrachten und – wie Kristoffer andeutet – die Gedichte einzig daraufhin abklopfen, ob sie unserer eigenen »intellektuellen Etüde«, d.h. dem von uns herausgearbeiteten System gerecht werden – sozusagen »das wiesentliche ist für den maulwurf unsichtbar«? Bin ich der Maulwurf? Grabe ich mich blind für alles andere von Text zu Text einzig um der Verbindungen willen oder sollte ich mich nicht doch auch einfach mal am »rundgelutschten Bonbon« erfreuen, d.h. an den Gedichten für sich, die ja trotzdem auch vorhanden sind? Natürlich kann ich in all den Mehrdeutigkeiten, Paradoxien, Referenzen etc. der Gedichte und Texte immer auch aufs große Ganze schließen, weil in vom wuchern alles sehr klug und durchdacht Bezüge nimmt und sich immer auch spiegelt (Inhalt und Form, Wuchern und System – ähnlich vielleicht dem, was wir hier seit geraumer Zeit machen), aber dabei ist das doch nur spannend, solange die Texte auch dagegenhalten, Brüche schaffen, weiße Flecken, Hindernisse, das Konzept hinter sich lassen, überschreiten – was mMn mit einem der ältesten Gedichte in deinem Band am deutlichsten gelingt, vielleicht auch, weil er am wenigsten sich eingliedert und sowohl die darin beschriebene Fahrt zum Halt zwingt als auch mich als Lesenden (und daher gewissermaßen folgerichtig ganz rechts unten in der Ecke zu finden ist):
»es gab: ein navigationsgerät. schon bei antritt der fahrt hatte es blind den dienst versagt.«
Diskussion
Kommentare
DAS FAZIT ...
... unternimmt keinerlei versuch, "objektiv" oder "nachvollziehbar" zu sein; sein verfasser hat mit lust das gespräch verfolgt und versucht es nun so wiederzugeben, wie man ein geschlagenes fußballspiel einem (möglicherweise desinteressierten) zeitgenossen schnell schnell schildert ... es sei dem geneigten leser nicht erspart, das gespräch über bäume (war da nicht mal was?) in fülle zu rezipieren ... aaalso:
KC, DF und TH unter bäumen. TH hat die da hingestellt (=das buch geschrieben, um das es gehen soll), manche sind abgestorben mittlerweile, manche leben noch, der schritt schwankt, federt moosmäßig, biosphärenkreisläufe finden statt, es wird gefressen, es wird auch gefressen geworden.
so lässt sich denken, man sitze auf jenen bäumen, während man über sie nachdenke, sagt KC; er bewegt sich so meta für meta in die höhe und/oder voran. bzw. es wird die metapher unscharf, und KC weist darauf hin, dass wir es bei dem ding, das TH gepflanzt hat, um so einen ganz klassischen wald-oder-bäume-holzbestand handle: das dargereichte ding besteht aus einem büchlein, linear/diachron; und einer art textlandkarte, quadratisch/synchron.
DF sagt "schlechte metapher". oder nein. sagt "langweilige metapher", und sagt, dass da ein du-subjekt durch äste raschelt, das sei viel wichtiger zu nehmen als die bloße landschaft. du, se questing beast ... ihm hintendrein ins unterholz ... hurrah! ...
TH, verfasserverfasser, beschreibt den zugriff der beiden anderen auf seinen wald in schönen/erfreulichen sätzen: "Auffallend am Griff in die Tiefe ist, dass man sogleich sprachlich dem Wald erliegt (vonwegen Wege durchs Dickicht schlagen etc.)." "Wenn man die entsprechend getönte Brille aufsetzt, ist jeder Text selbstreflexiv. Plötzlich programmatisierts überall." "Ordnung = Rodung +n"
KC, freundlich im tonfall und hart in der sache, weist nun drauf hin, dass THs gewucher selber "rodung+n" sei, dh. nicht gewachsen, sondrrrn angelegt, sprich: 1 park und kein urer wald ... von wegen "man suche sich eigene wege durchn text" (als wären die nicht als kiespfade im park schon angelegt)
DF nun an KC: ja aber deswegen kannst du ja trotzdem lustwandelen, alter! muss ja nicht immer urwald sein!
TH: 'guckt mal, ich hab hier tatsachensubstrate!' ... und kaum guckt man hin und will sie auf den text beziehen (diese mehrern hände voll vorlyrischen schreibanlässen: fukushima, grenzen, depressionen, maulwürfe) ... zieht er sie wieder weg und packt sie ein: "Das alles behaupte ich jetzt mal. Und behaupte es gerne."
KC: weigert sich, über den zaubertrick von TH zu staunen: "...schlage nur das Angebot zum Rauszoomen aus. Ich will lieber in die Karte eintauchen und vielleicht dabei die Oberfläche durchbrechen." und bringt passenderweise das ganze problem mit karte:territorium <---> sprache:gedanke auf; inklusive der frage, wo das problem mit der analogie ist, und: wie sie zum verständnis eines lyrikbuchs mit faltplan fruchtbar ... ... ...
...
er geht an dieser stelle noch um einiges weiter, dieser express-text über THs gedichtband und bibliophiles spezialobjekt "vom wuchern". gleichwohl erscheint mir, man könne sich alles, was noch kommt, als ein gespräch visualisieren, das drei wanderer führen, über eine karte gebeugt, von der sie sich nicht ganz einig sind, ob sie sie richtig halten, und betreffend die frage, wo sie denn nun eigentlich sind ... und erscheint mir darüber hinaus, als wäre es nicht ohne unterhaltungswert, das ganze gespräch nun noch einmal, so imaginiert, von vorn zu lesen ...
Fixpoetry 2016
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Ihr Kommentar wurde erstellt.