150 Jahre Kapital
 Signierte Erstausgabe des Kapitals aus dem Jahr 1867
Signierte Erstausgabe des Kapitals aus dem Jahr 1867
„Das Kapital“ von Karl Marx ist ein Klassiker der politischen Ideengeschichte und das bekannteste Wirtschaftsbuch in deutscher Sprache. Der erste Band der „Kritik der politischen Ökonomie“, so der Untertitel, erschien 1867 in Hamburg, im Verlag von Otto Meissner. Dauerte es damals ganze vier Jahre, bis die ersten 1.000 Exemplare verkauft waren, so zählt das Werk heute neben der Bibel zu den auflagenstärksten Büchern der Welt – und gewiss zu den einflussreichsten und umstrittensten.
Das Museum der Arbeit nimmt das 150-jährige Jubiläum der Erstveröffentlichung in Hamburg zum Anlass einer spannenden und kontroversen Ausstellung zur Geschichte und Aktualität von Karl Marx‘ „Das Kapital“. Sie spannt einen Bogen von der Zeit der Entstehung des Werks im 19. Jahrhundert über die widersprüchliche Rezeption im 20. Jahrhundert bis zu heutigen Fragen der Produktion und Verteilung von Reichtum und Armut. Ziel der Ausstellung ist es, zum Nachdenken über Aktualität und Grenzen dieses umkämpften Klassikers anzuregen – und zwar weder dogmatisch noch akademisch, sondern assoziativ und partizipativ.
Marx kam es darauf an, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Deshalb fragt die Ausstellung auch danach, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Führt der Kapitalismus zu Freiheit und Wohlstand oder zu Unterdrückung, Ausbeutung und Krise? Wieso werden die Mechanismen des aktuellen Wirtschaftssystems so unterschiedlich bewertet? Und sind Alternativen wünschenswert und möglich? Die Ausstellung gibt der Diskussion solcher und ähnlicher Fragen breiten Raum und bindet die Meinungen und Positionen von Besuchern direkt ein.
Ausstellung ab 06.09.2017
- und schon morgen im Museum der Arbeit:
Sonntag, 3. September 2017, 19 Uhr
“Das Kapital” verfilmen
Nachrichten aus der ideologischen Antike: Marx, Eisenstein, Das Kapital von Alexander Kluge
Filmabend im Metropolis
1929 plante Sergei Eisenstein “Das Kapital” von Karl Marx zu verfilmen, doch dazu sollte es nie kommen. 80 Jahre später versucht Alexander Kluge sich diesem Wagnis in Zitationen, Kommentaren und Gesprächen anzunähern. Daraus entsteht ein zehnstündiges Filmessay zu diesem zentralen Werk, unter anderem mit der Beteiligung von Prof. Oksana Bulgakowa, Hans Magnus Enzensberger, Helge Schneider und Tom Tykwer. Das Museum der Arbeit zeigt in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg die 83-minütige, für das Moskauer Filmfestival 2009 erstellte Kinofassung. Einführung mit dem Filmhistoriker Thomas Tode.

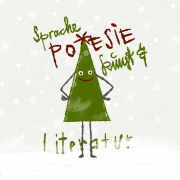
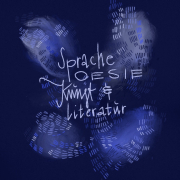
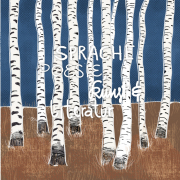
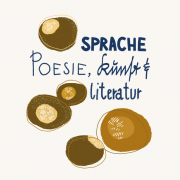



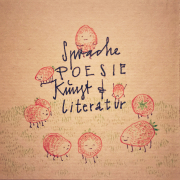
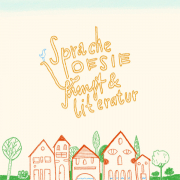
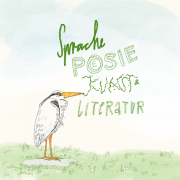
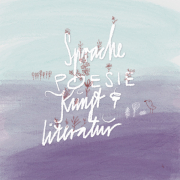
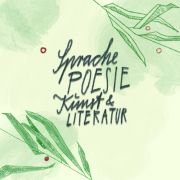
Neuen Kommentar schreiben