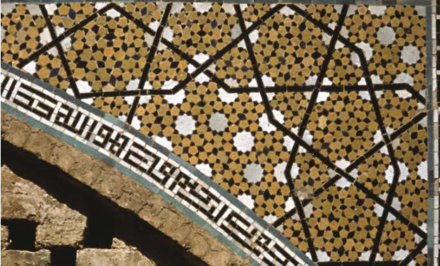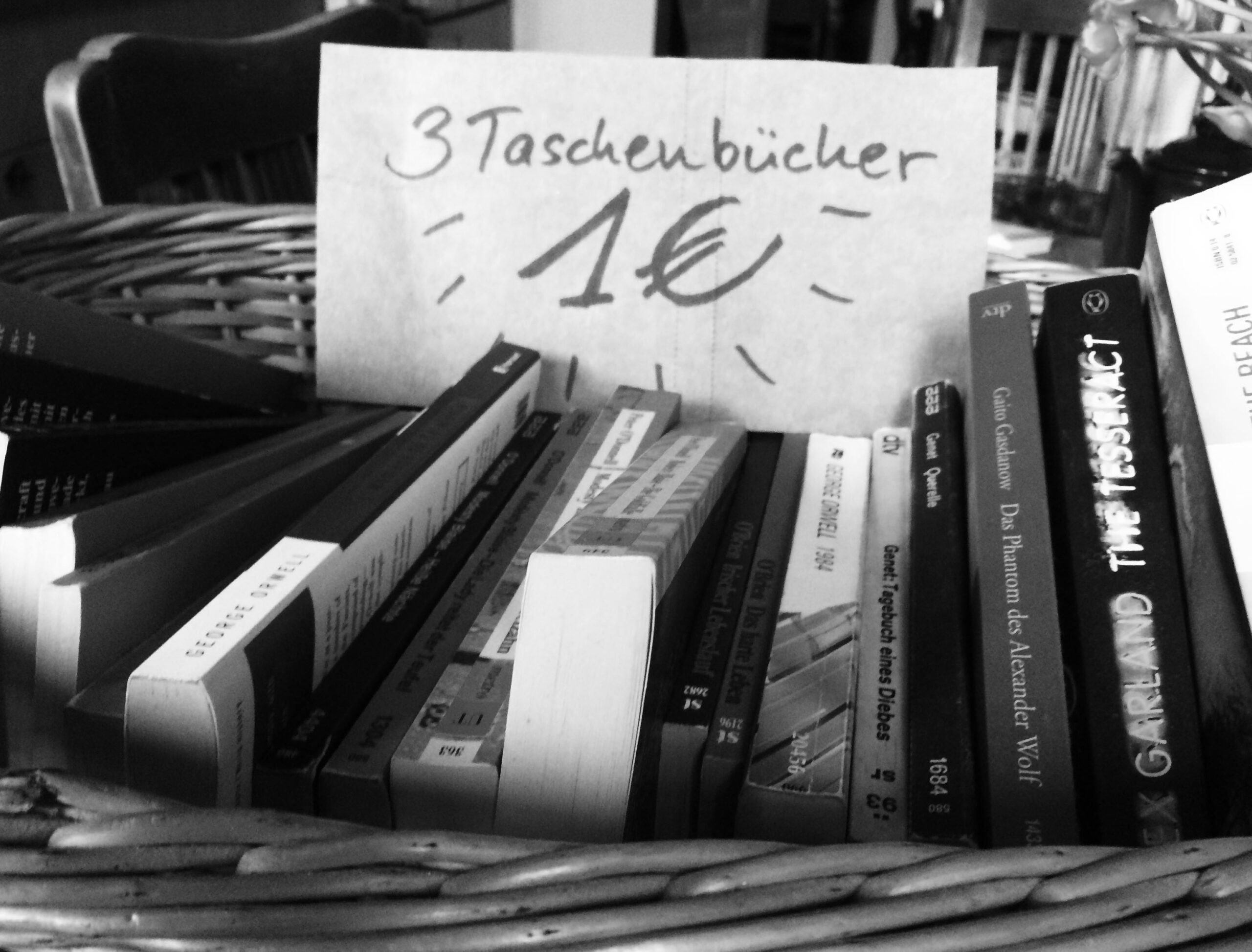engtanznummer
engtanznummer
Norbert Hummelt
reprisen
reprisen
I
schwarze rosen
ein finnisches lied
irgendwas
zwischen tango u. beat
die trauerstunden
du weißt es wohl
das alles geht nicht
ohne alkohol
das alles geht nicht
ohne phanodorm
erst wenn du schlafen kannst
beginnt die form
sich auszulösen
aus dem traumgesicht
so fremd am morgen
du begreifst es nicht
woher die worte sind
halb bild, halb beat
schwarze rosen
ein finnisches lied.
II
die trauerstunden
zu früh geübt
schon schwarz getragen
u. erst kaum verliebt
die engtanznummer
du weißt es wohl
dort in der brust
der unruhepol
den kopfhörer über
um gräber schleichen
auch was in vasen
vermodert gibt zeichen
ich sah die vermoosten
inschriften an
im hintergrund rauschte
die autobahn
noch kein gedicht gewußt
nur das geklimper hier
auf dem erwähnten
schwarzen klavier.
„schwarze rosen / ein finnisches lied“ – das können doch nur die Leningrad Cowboys sein, jene schwarz gekleideten Mannen mit den Sturmfrisuren und Schnabelschuhen aus Aki Kaurismäkis Filmen. „ohne alkohol“ können die ja nicht mal frühstücken, wie jeder weiß, und der Schaukelrhythmus des Gedichts schreit doch nach einem Akkordeon.
Ganz falsch.
Nicht sie, sondern Gottfried Benn summt aus diesem Pastiche; in seinem Tonfall, unverkennbar, schwingt der Klöppel einer hallenden Glocke, schwer und schwermütig. Die kursiv gedruckten Einsprengsel entstammen einem Fragment aus Benns Nachlass, Stichworte nur, nicht weiter ausgeführt. Norbert Hummelt nimmt sich ihrer an, entführt sie den Philologen und rettet sie in unser Jahrhundert.
„reprisen“ heißen die beiden Gedichte, musikalisch gesprochen: Wiederaufnahmen eines schon vorgestellten Themas. Zunächst wird damit einfach der Gestus der Anverwandlung bezeichnet. Der Sprechende nimmt Benns Stimme an, mit ihr besingt er den kreativen Prozess und das tastende Suchen der Pubertät. Und der Reiz, das Wunder besteht darin, dass genau die Mischung aus Sentimentalität und Schnoddrigkeit zustande kommt, die uns Benn – Gedichte so teuer machen, gleichzeitig jedoch etwas Neues, Eigenes, das über die Anverwandlung hinausgeht.
Die Atmosphäre kennt man bestens: Alles ist irgendwie furchtbar, die Rosen müssen schwarz sein, der Pullover auch, wer nicht trauert, ist ein Hohlkopf, ohne Alk geht gar nichts und Tabletten fördern das „automatische Schreiben“ oder wie immer man das Gekritzel nennen mag, „halb bild, halb beat“, das da halb besinnungslos abgesondert wird. Aber wessen Produktionsprozess wird eigentlich geschildert? Benn mit „beat“? Der junge Norbert Hummelt mit „phanodorm“? Schöne Anachronismen, schöne Zweideutigkeiten! Unter der milde erheiternden Oberfläche geht es aber um das Thema, das den Lyriker am brennendsten interessiert: die Entstehung des Gedichts. „Form“ bis hin zum „Satzbau“ ist für Benn eine metaphysisch aufgeladene Kategorie. Erst sind die Rhythmen da, die Strukturen und das Reizpotential bestimmter Klänge, nicht herbeizuzwingen und den vorbewussten Schichten entsteigend. „woher die worte sind“ – keiner begreift das, aber genau dadurch wird ihre Wahrheit bezeugt.
Am Ende des erstens Teils seufzen wir jedenfalls kellertief, schauen auf die immer noch nicht erröteten Rosen und hören die Sehnsuchtsmelodie, finnische Variante, und hier fänden dann doch die Leningrad Cowboys ein Plätzchen (oder Sibelius, dessen schmachtende Geigen Benn liebte).
In II erzählt ein Heutiger seine Jugend, der vom letzten Anhauch des Existentialismus schon mürbe ist, obwohl das ‚richtige Leben‘ für ihn noch gar nicht begonnen hat. Ach, wer könnte sich nicht an die „engtanznummer“ erinnern, egal mit wem, Hauptsache Kontakt? An die ratlose Schlaffheit bei gleichzeitig rastlos vorantreibendem „unruhepol“? An den Friedhof als Lebensschauplatz? Alles anrührend und ein bisschen peinlich, und sogenannte lebenstüchtige Leute verdrängen die Erinnerung an solche Zustände, kaum dass sie die erste Gehaltsüberweisung verbucht sehen. In der krausen Zeit jedoch, da man noch sucht, gilt: Je jünger, desto Grufti und unangekratzt von der Ahnung, dass die Gefühle, Gedanken und Taten dieser Lebensphase lauter Reprisen sind, tausendmal erlitten und Literatur geworden…
Mitten im sattesten Klischee sagt der Sprechende plötzlich „ich“, tritt ganz nah an sich heran und rückt gleichzeitig von sich ab durch das Imperfekt der Verbformen. Er erinnert sich an die Zeit, bevor er schrieb, die Wörter sind noch nicht da, geschweige denn der Ehrgeiz und die Sucht nach Form. Nur ein erstes „Geklimper“ macht sich bemerkbar „auf dem erwähnten / schwarzen klavier.“ Erwähnt wird das Klavier in dem Gedicht „schattenmorellen“ aus dem Band „zeichen im schnee“. Auch dort geht es um eine Erinnerung: Die kranke Großmutter möchte Händels ‚Largo‘ hören, das Kind bringt nur Geklimper zustande. Doch es spielt auf einem neu angeschafften, braunen Instrument, das schwarze wurde im Krieg zerstört. Obwohl das Ich also das schwarze Klavier gar nicht aus eigener Anschauung kennt, klimpert dieses in ihm fort und stimmt es schon ein auf die Musik der Worte, der es sein Leben widmen wird. „Im Gegenwärtigen Vergangenes“, lautete Goethes Formel, die hier in mehrfacher Brechung durchgespielt wird.
Die Seufzer bleiben. Die Ironie, glücklicherweise, bleibt auch.
Gisela Trahms
Zu Neuer Wort Schatz (11): Florian Voß
Zu Neuer Wort Schatz (9): Nadja Küchenmeister
Das Gedicht „reprisen“ ist zu finden in:
Norbert Hummelt
Stille Quellen
Sammlung Luchterhand
München 2004
Das Gedicht „schattenmorellen“ ist zu finden in:
Norbert Hummelt
Zeichen im Schnee
Sammlung Luchterhand
München 2001
Foto des Autors: Susanne Schleyer