
Kurzbesprechungen von fiction – Joachim Feldmann (JF), Tobias Gohlis (TG), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Wolfgang Schweiger (WS) und Thomas Wörtche (TW) über:
Friedrich Ani: Letzte Ehre
Kate Atkinson: Weiter Himmel
Jakob Bodan: Das Schöne, Wahre und Böse
Frauke Buchholz: Frostmond
Patrick Deville: Amazonia
Isabella Huser: Zigeuner
Bernhard Jaumann: Caravaggios Schatten
Jörg Maurer: Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel
Colin Niel: Nur die Tiere
Richard Osman: Der Donnerstags Mord Club
Jeremy Reed: Rimbauds Delirium
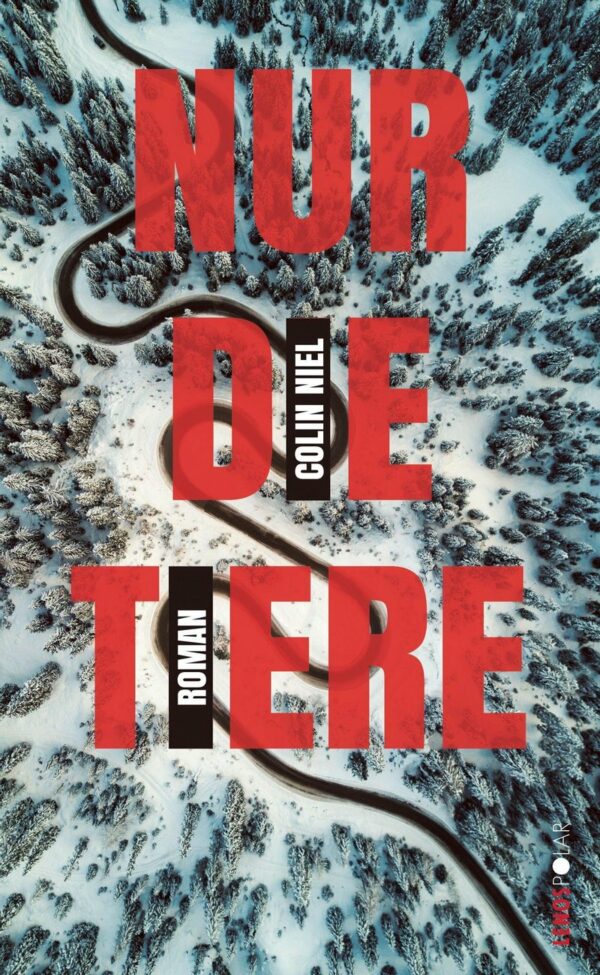
Große Handwerkskunst
(TW) Der Roman Nur die Tiere von Colin Niel ist eine Art Plot-Wunder. Ein Kriminalroman über Missverständnisse, Irrtümer, über Zufall, missglückte Kommunikation und leise menschliche Tragödien, der zwischen dem französischen Massif Central und der Elfenbeinküste spielt.
Fünf Figuren erzählen von einer im rauen Bergland verschwundenen Frau, der Gattin eines reichen Unternehmers, die eigentlich nur wandern gehen wollte. Dass sie ermordet wurde, darüber besteht für uns Leser*innen kein Zweifel, wir wissen auch bald, wo die Leiche ist. Wer sie ermordet hat, wissen wir lange nicht. Warum – dafür gibt es Angebote: Alice, die frustrierte Ehefrau eines Rinderzüchters, Joseph, ein eigenbrötlerischer Schafzüchter mit leicht soziopathischen Zügen, Maribé, eine arme, reiche junge Frau, die die Gelegenheits-Liebhaberin des Opfers war, Michel, der Rinderzüchter, von der Ehe mit Alice zermürbt – sie alle hätten vielleicht Mord-Gründe gehabt. Nur die fünfte Stimme, Armand, ein brouteur, also ein Internetabzocker aus der Elfenbeinküste, der konnte nicht der Täter gewesen sein. Aber das mit der Schuld, das ist so eine Sache …
Alle Figuren von Niel sind einsame Menschen, arme Schweine, die eigentlich nur geliebt werden wollen, ob in der unwirtlichen französischen Provinz oder im heißen Äquatorialafrika. Aber die Umstände, sie sind nicht so. Denn die gierigen Klauen des Kapitalismus reißen an den verwundeten Seelen, ob sie es merken oder nicht, und ohne dass Niel das jemals erwähnen würde. Und so legt sich jede Figur eine eigene Wahrheit zu, eine eigene Erklärung für die Ereignisse, einen eigenen Umgang damit, wohl wissend, dass es keine sinnvolle Kohärenz für sie gibt, was zu neuen Lebenslügen führt, zu Indolenz oder Fatalismus. Denn was wirklich passiert ist, das ist so irrsinnig, dass nur eine Person am Ende einigermaßen klarsieht, aber gewollt hat sie das nicht. Das ist alles in der Tat noir, Ironie des Schicksals, rabenschwarz eingefärbt und ziemlich radikal.
„Nur die Tiere“ ist ein schönes Beispiel, wie man den guten alten Whodunit sinnvoll wiederbeleben und gleichzeitig demontieren kann, weil es keinen Masterplan gibt, und in dieser Welt, die der Roman schildert, auch gar nicht möglich wäre. Wie Niel die fünf Perspektiven so montiert, dass am Ende kein Rashomon-Effekt entsteht, sondern Zufall und Irrtum erzählbar werden, und es tatsächlich eine Wahrheit gibt, ist große Handwerkskunst, die aber nur so brillant funktionieren kann, weil hier eine substantielle Geschichte erzählt wird, die einen wirklichen „Sitz im Leben“ hat, und anders gar nicht erzählt werden könnte. Beeindruckend.
Colin Niel: Nur die Tiere (Seules les bêtes, 2017). Deutsch von Anne Thomas. Lenos Verlag, Basel 2021, 286 Seiten, 22 Euro.
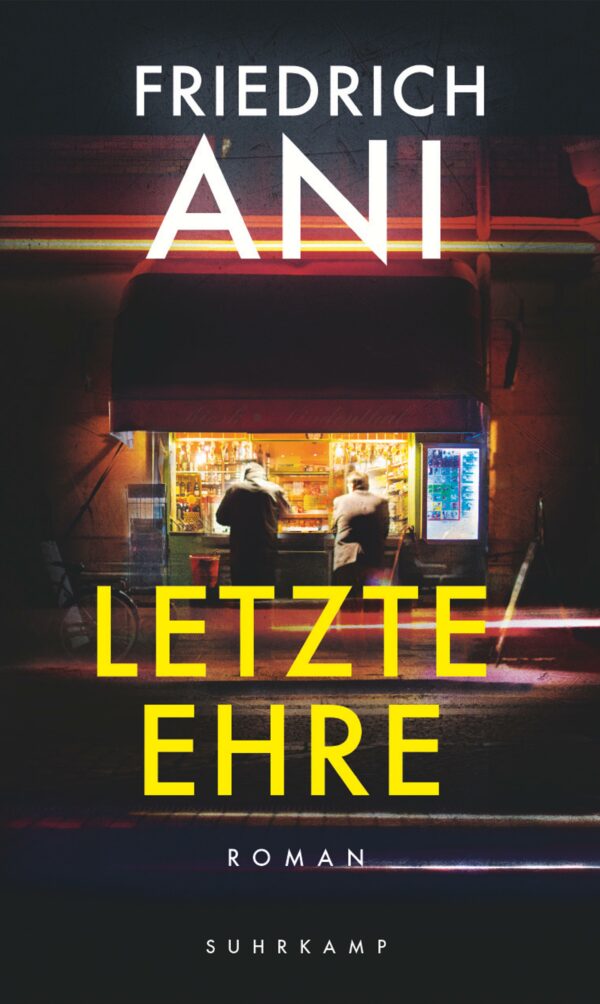
Ungeheuer vielschichtig
(TG) Fariza Nasri, eine der vielen Ermittlerfiguren in Friedrich Anis letztem Roman „All die unbewohnten Zimmer“ (2019), rückt in seinem jüngsten Letzte Ehre ins Zentrum einer Vielzahl von Fällen von Männergewalt – mit einer Ausnahme, die im Hintergrund mitspielt und dem Roman eine überraschende Wende gibt, die auch ein Ende ist.
Die von mir seit Jahren vertretene Auffassung, Ani sei einer der besten Kriminalschriftsteller (und damit einer der besten Schriftsteller) deutscher Sprache, wird durch diesen ungeheuer vielschichtigen Roman erneut bestätigt. Er ist akkurat in der Darstellung der Polizeiarbeit, jongliert mit unterschiedlichen Handlungsebenen und Verdachtsmomenten, die alle eine Auflösung finden, erzählt vom Kosmos männlicher Gewalt und weiblichen Leidens in so vielen Schattierungen, dass einem übel werden kann. Vor allem aber findet er für all das beschriebene Lebensleid eine Sprache, die sich den gängigen allgemeinplätzigen Zuordnungen wie „traumatisiert“, „Opfer“, „Brutalität“, „Zärtlichkeit“ durch konsequente Konkretheit widersetzt: der Schmerz, das Leid sind nicht allgemein, sondern individuell.
Nur zwei Beispiele seiner Sprachkunst: Der Fachausdruck „Verhämmerung“ wird in einer gefühlt seitenlangen Autopsie unerträglich plastisch. Die Phrase vom Ermittler, der sich verpflichtet sieht, „für die Opfer zu sprechen“, steht bei Ani in Fariza Nasri eine Ermittlerfigur entgegen, die es versteht, einer im Schmerz verstummten, unendlich gequälten Frau zu helfen, ihre Stimme wiederzufinden. Genau das ist auch Anis Kunst, der auch sonst mit seiner Figur einiges gemeinsam hat, den syrischen Vater und das Aufwachsen in einer oberbayrischen Kleinstadt. Dieses mit 270 Seiten vergleichsweise kurze Buch ist reich und groß.
Friedrich Ani: Letzte Ehre. Suhrkamp Verlag, Berlin 20121. 272 Seiten, 22 Euro.
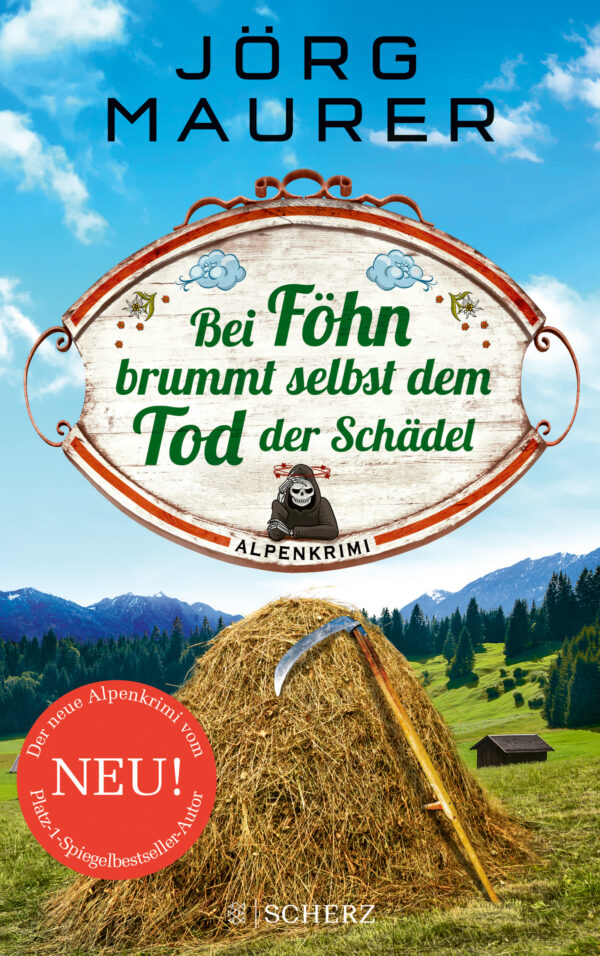
Metafiktionale Komik
(JF) Dass den Romanen des literarisch hochversierten Autors Jörg Maurer mit der Bezeichnung „Alpenkrimi“ Unrecht widerfährt, ist an dieser Stelle schon einmal festgestellt worden. Auch das neueste Werk gebürtigen Garmisch-Partenkircheners überzeugt mehr durch metafiktionale Komik denn durch rustikale Kriminalistik. Mit gleichem Recht könnte man Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel als Techno-Thriller bezeichnen, denn was sonst als eine avancierte neuronale Spielerei könnte dahinterstecken, als sich Maurers Star-Ermittler Jennerwein nach unruhiger Nacht im Körper des Postboten Leonhard Pelikan wiederfindet.
Doch bis sich diese Zusammenhänge klären und die gewohnte Ordnung (fast) wiederhergestellt ist, schlägt der Plot, in den unter anderem ein miserabel kochender Mafiaboss und der päpstliche Geheimdienst involviert sind, so manchen unterhaltsamen Haken. Da bleibt nur zu sagen: Auf die Bestsellerliste mit dem guten Stück.
Jörg Maurer: Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel. Alpenkrimi. Scherz Verlag, Frankfurt 2021. 411 Seiten, 16,99 Euro.
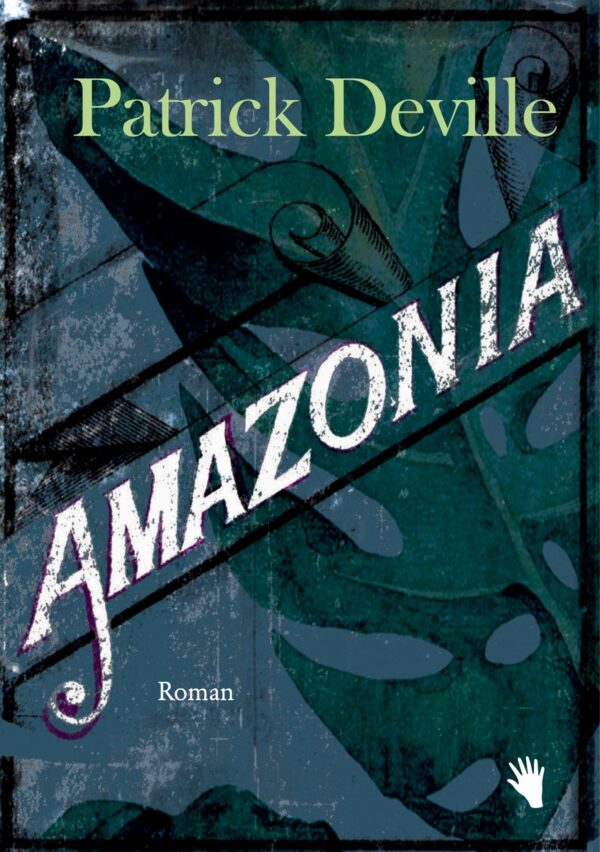
Grand Prix de Littérature
(AM) Der weitgereiste, kosmopolitische Patrick Deville hat für sich eine Erzählweise entwickelt, die zwischen Reisebericht und Biographie, Re-Enactment und philosophischer Reflektion changiert und unsere westliche Kolonialgeschichte eins ums andere Mal hinterfragt. Fundiert, lehrreich und klug. Man folgt ihm gerne. Gerade wurde er dafür von der Académie française mit dem „Grand Prix de Littérature“ für das Gesamtwerk geehrt. Im deutschsprachigen Raum hat sich der Zürcher Bilger-Verlag große Verdienste um seine Verbreitung erworben. Handlich, handschmeichlerisch und bestens ausgestattet sind die bisher erschienenen Hardcover „Taba-Taba“, „Viva“, „Kampuchea“, „Pest & Cholera“, „Äquatoria“ – und jetzt, ganz neu, Amazonia. Deville ist diesmal mit seinem Sohn Pierre unterwegs, erzählt wird so auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Nein, mehrere: auch die von Kipling, Malcolm Lowry, Jonas Savimbi …
Es ist das siebte Buch des Abracadabra-Projektes, führt in rund 60 Kapiteln quer durch den lateinamerikanischen Subkontinent mitsamt einer Überquerung der Andenkette, fährt den Amazonas hinauf von Belém am Atlantik und reist bis Santa Elena am Pazifik. Stationen sind unter anderem Santarém, der Río Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil und die Galápagosinseln. Wir treffen Konquistadoren, Forschungsreisende, Abenteurer, Hasardeure und vom Wahnsinn Getriebene, Simon Bolívar, Alexander Humboldt, Charles Darwin, Lope de Aguirre und Brian Sweeney Fitzgerald, genannt Fitzcarraldo. Im Kapitel „mit Werner“ begegnen wir Werner Herzog, den es zweimal nach Amazonien zog. Mick Jagger sollte ursprünglich in der großen Urwald-Oper mitspielen, er irritierte mit Modeaufnahmen, Jason Robard mit seinen Launen. Schließlich wurde Kinski geholt.
Patrick Deville: Amazonia (2019). Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Bilger Verlag, Zürich 2021. 334 Seiten, gebunden, 26 Euro.
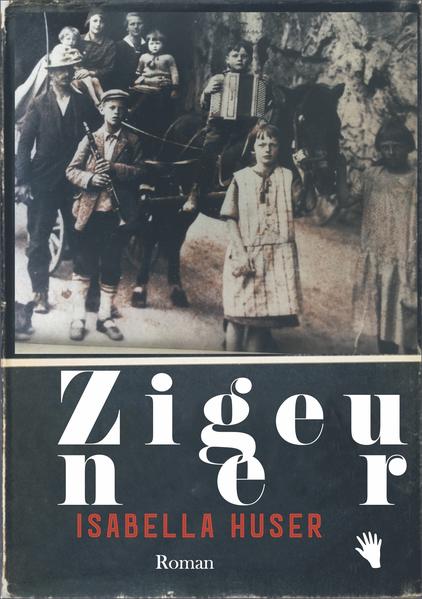
Ein Subgeschichte der Schweiz
(AM) Kaum ein Verlag hat für das Sperrige, Beschützenswerte und handlich Haptische, das Bücher ausmacht, ein solch eigenes Format entwickelt wie der Zürcher Ricco Bilger. In Zigeuner von Isabella Huser steht: „Lektorat: Christian Döring“. Und ja, es ist der Herausgeber der Anderen Bibliothek, der an diesem eindrucksvollen Buch beteiligt gewesen ist. Zehn Jahre insgesamt hat die Autorin sich mit ihrem Stoff beschäftigt, die Schicksale ihrer jenischen Vaterfamilie recherchiert und dabei Material gefunden, das bis zur Entstehung der modernen Schweiz im 19. Jahrhundert zurückreicht. Es sind Geschichten, in denen sich ein Land wie die Schweiz – aber eben nicht nur die alleine, diese Erfahrung ist universell – im Umgang mit dem Fremden oder fremd Geglaubten selbst begegnet. Isabella Huser erzählt das facettenreich und genau, sie hat einen filmischen Blick, eine dokumentarische Ruhe, ein erzählerisches Herz. Und es ist nicht nur das ihre, das stockt, wenn sie in einem Archiv in einer Akte Formulierungen begegnet, die in Abgründe führen: „Es wurde auch amtlicherweise erhoben, dass der Vater mit zwei seiner Töchter, als er in lachen wohnte, herumzog, und dass sie zusammen öffentlich unanständige Lieder vortrugen. Diese Töchter sind 10 und 9 Jahre alt.“ Oder, noch deutlicher: „Die Familie Huser ist eine Vagantenfamilie, die nach kurzem Aufenthalt ihre Wohnstelle immer wieder wechselt. Den Kindern wird dadurch eine normale Schulbildung vorenthalten. Zur weiteren Erziehung sind sie richtig zu versorgen.“ Solche Kindswegsnahmen gab es bis ins Jahr 1972.
Isabella Huser: Zigeuner. Bilger Verlag, Zürich 2021. 256 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen, 26 Euro.
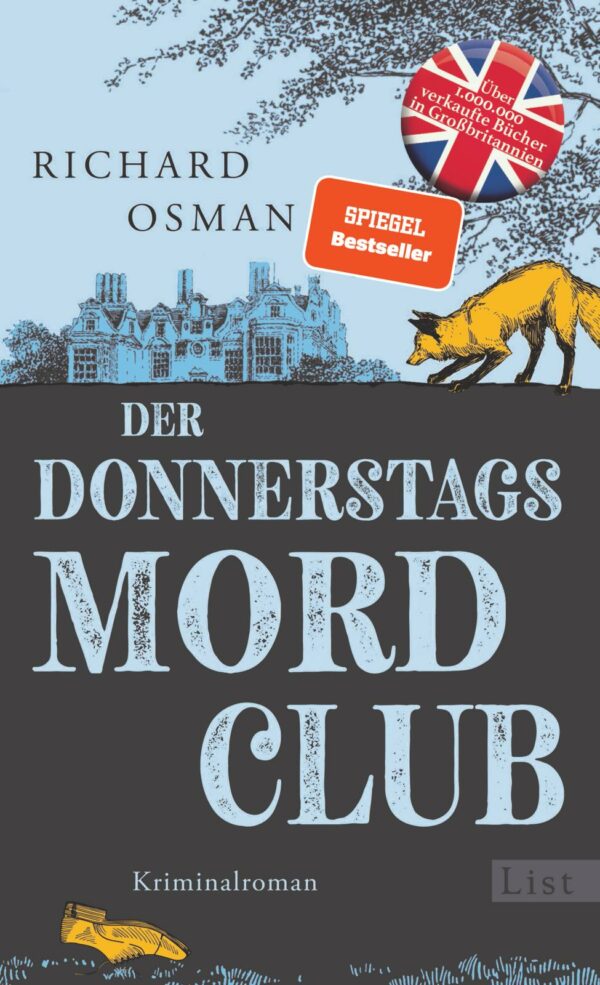
Wellness-Produkt
(TW) Es ist ja lobenswert, Seniorinnen und Senioren zu den Helden von Kriminalromanen zu machen, auch demente Menschen zu inkludieren. John Niven mit „Old School“ oder Young-Ha Kims „Aufzeichnungen eines Serienmörders” etwa haben da schon Maßstäbe gesetzt (und wenn ich darüber nachdenken würde, würden mir auch noch ein paar andere Beispiele einfallen). Jetzt also Richard Osman mit Der Donnerstags Mord Club. Irgendwo tauchte der Begriff „warmherzig“ auf und mäandert jetzt durch die Besprechungen. Okay.
Im schönen Kent, in einem putzigen und puscheligen Inspector-Barnaby-England, gibt es eine schicke Seniorenresidenz, deren Insass*innen sich die Zeit damit vertreiben, echte Morde, also cold cases, aufzuklären. Und dann passiert ein Mord an jemandem, den sie alle kannten. Die örtliche Polizei, vertreten durch eine junge, ehrgeizige Frau und ihrem netten, eher weicheiigen Vorgesetzen sind über die Hilfe der Greis*innen begeistert. Und dann werden ein paar Nebenrätsel geklärt und am Schluss … Naja, eben. Ermittelt wird wie bei Old Lady Agatha, inklusive der ganzen Langeweile, die entsteht, wenn pausenlos diskutiert wird, wer wann wo wen gesehen hat oder wer wen wann wo mit wem war. Dieser grenzdebile Mechanismus geht anscheinend immer noch als „anspruchsvoll“ durch, selbst nach hundert Jahren. Und sicher ist es köstlich, wenn man unter „britischem Humor“ immer noch dieselben Stereotypen versteht, die seit 200 Jahren die Menschheit zum „Schmunzeln“ (abscheuliches Sprachspiel) bringt – leicht schrullig eben, Miss-Marple-haft. Sowas geht in der Regel so 10 bis 20 Seiten gut, also ´ne nette Kurzgeschichte halt. Ab Seite 50 wird es unerträglich.
Und eben „warmherzig“, was in einem schicken Luxus-Resort doch entschieden leichter fällt, als in den handelsüblichen Siechenhäusern und Altenverwahranstalten.
Aber schon klar, so soll „Krimi“ sein – spielt in einer Parallelwelt, ist amüsant, d.h. muss man nicht ernstnehmen, verwirrt nicht durch irgendwelche Komplexionen, ist total verlogen, kann im Fernsehen auf dem Rosamunde-Pilcher-Platz kommen, und ist das perfekte Wellness-Produkt. Enjoy!
Richard Osman: Der Donnerstags Mord Club (The Thursday Murder Club, 2020). Deutsch von Sabine Roth. List, München 2021. 458 Seiten, 15,99 Euro.
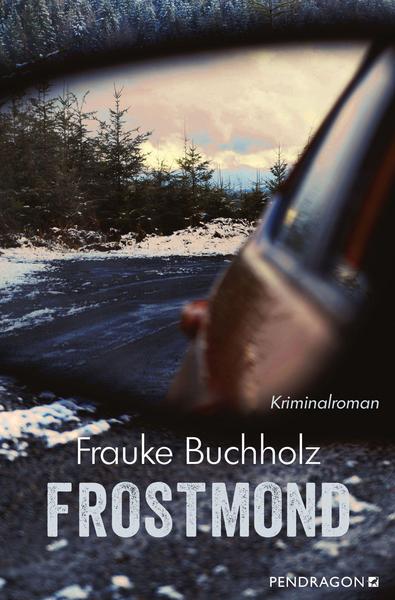
Geschickt variiert
(JF) „First Nations“ werden die indigenen Völker Kanadas offiziell genannt, doch für die Polizei in Montreal sind es natürlich noch immer Indianer, gerne als „Chief“ oder „Indian Boy“ adressiert. Und wenn sie Opfer von Verbrechen werden, ist der Aufklärungseifer nicht besonders groß. Das ändert sich allerdings, als die Leiche einer 15-Jährigen aus dem Cree-Volk im St. Lawrence River gefunden wird. Die Medien steigen groß ein, denn es handelt sich bereits um den neunzehnten in einer Reihe ungeklärter Morde an Frauen indigener Herkunft. Schon wird über einen Serienmörder spekuliert und ein Profiler muss her. Für den studierten Psychologen Ted Garner ist der Einsatz in der Provinz Quebec eine wunderbare Gelegenheit, all seine Vorurteile gegenüber Frankokanadiern bestätigt zu sehen. Seinem Kollegen von der örtlichen Polizei ist er schon bald in herzlicher gegenseitiger Abneigung verbunden. Dass er nur ein paar Brocken Französisch spricht, macht die Sache nicht besser. Und nun sollen die beiden im Cree-Reservat ermitteln, wo man weißen Polizisten mit grundsätzlichem Misstrauen begegnet.
Mit dieser geschickt variierten Standardsituation beginnt Frauke Buchholz ihren Kriminalroman Frostmond, um wenig später mit dem rachedürstenden Cousin des Mordopfers eine weitere zentrale Figur einzuführen, die erheblich mehr zum Sympathieträger taugt als die beiden besoldeten Ermittler. Der Plot entwickelt sich dementsprechend rasant und kann gleich zweimal mit einem zünftigen Showdown aufwarten. Das ist gekonnt gemacht, aber auch nicht frei von einschlägigen spannungsliterarischen Klischees. Überzeugender sind die Schilderungen der erbärmlichen Lebenssituation eines Großteils der indigenen Bevölkerung Kanadas. Frauke Buchholz zeigt sich hier als ebenso engagierte wie kenntnisreiche Autorin. Ein vielversprechendes Debüt.
Frauke Buchholz: Frostmond. Pendragon Verlag, Bielefeld 2021. 286 Seiten, 18 Euro.
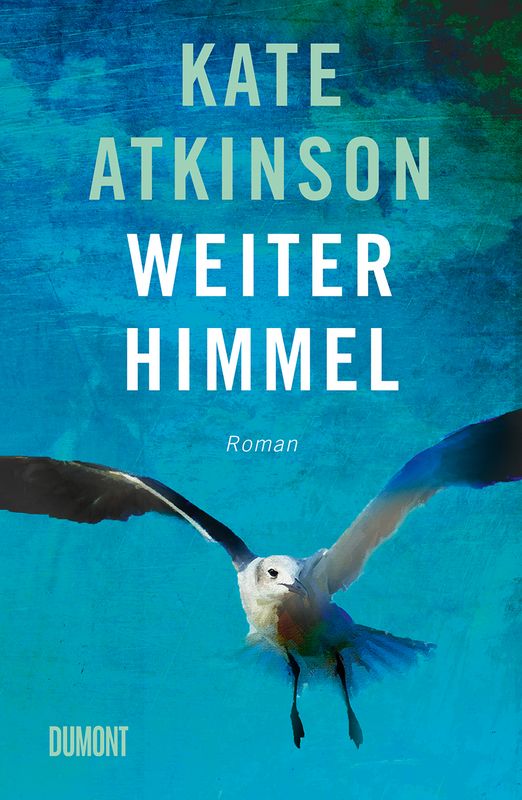
Frauen, die sich behaupten
(rum). Es ist der fünfte Auftritt von Kate Atkinsons schwer gebeuteltem Privatdetektiv Jackson Brodie, der sich inzwischen an der nordenglischen Küste auf Unspektakuläres konzentriert – untreue Ehemänner, Kleinkram für einen Anwalt – und derweil versucht mit sich, seinem pubertierenden Sohn und seiner Ex klarzukommen. Über einen harmlosen Auftrag stolpert er dann doch in heftige Untiefen. Derweil ermitteln zwei kalt gestellte Polizistinnen in einem alten Fall, in dem es um Kindesmissbrauch ging, stoßen auf Ungereimtheiten, eine neue Zeugin, Hinweise, denen sie nachgehen und die sie schließlich auf dieselbe Spur führen, auf der auch Brodie unterwegs ist. Die Polizei kümmert sich indes um einen Mordfall und nähert sich von dieser Seite jener Gruppe von Geschäftsmännern, die da zusammen Golfen gehen, Jobs und Familie haben, ihr Geld aber mit modernem Sklavenhandel machen, ein florierender Nebenerwerb, bei dem sie junge Frauen mit falschen Versprechungen ins Land locken, drogenabhängig machen und weiter in die Prostitution verkaufen .
Die 1951 geborene Kate Atkinson nimmt in Weiter Himmel zunächst einen langen Anlauf, reiht ihr eindrucksvolles Personal auf, seziert die Verhältnisse, widmet sich ein paar alltäglichen Widrigkeiten und Dramen, bevor diese Geschichte mit ihren zahlreichen Strängen Fahrt aufnimmt. Besonders stark sind ihre Frauenfiguren, die angesichts der Verhältnisse versuchen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Allen voran Crystal, die ihre Vergangenheit nur zu gerne vergessen würde. Deshalb hat sie „sich nach oben gekrallt, Hand um Hand“, hat geheiratet, einen Sohn bekommen, für den sie alles tun würde. Alles andere hingegen sieht sie ganz pragmatisch als Sicherung ihrer Ansprüche in einem Umfeld, in dem Männer scheinbar unbehelligt die Welt nach ihren Regeln gestalten können.
Das ist großartig geplottet, weil Atkinson die Erzählfäden zunächst locker hält, sie erst allmählich miteinander verknüpft. Ihre Figuren stolpern da über etwas, das sich in einem anderen Zusammenhang plötzlich zu einem Bild, oder zumindest zu einem Teil des Bildes fügt. Dadurch entsteht eine wilde Dynamik, die Atkinson gekonnt und intelligent bündelt. Denn sie hält einerseits stets angenehm Distanz und erzählt doch nah am Leben, und zwar wunderbar pointiert, grundiert mit diesem extrem trockenen Humor, der ihren Themen nichts von ihrer Vehemenz nimmt. Ganz im Gegenteil.
Kate Atkinson: Weiter Himmel (Big Sky, 2019). Aus dem Englischen von Anette Grube. Dumont Verlag, Köln 2021. 478 Seiten, 24 Euro.

Das Rätsel
(AM) Kultiviere, was das Publikum dir vorwirft: Das bist du. Dieser Satz von Jean Cocteau steht Rimbauds Delirium von Jeremy Reed voran. Er meint: „Es spielt keine Rolle, wie lange unser Planet bestehen wird, Rimbaud wird immer der letzte Dichter sein. Und das nur wegen seiner Flucht aus der Dichtung. Jean-Nicholas-Arthur Rimbaud, der arrogante Teenager, der es nicht schaffte, in der Dichtung eine physische Umsetzung seines halluzinierten Deliriums zu finden, wirbelte einen Sandsturm über seinen poetischen Spuren auf. Kritiker reiben sich heute die Augen, in der Hoffnung, dass sich der rote Schleier zwischen ihnen und ihrem Subjekt als löschbare Illusion entpuppt. Kann es sein, dass jemandem sein Werk so unwichtig war?“
Ich kann jetzt sagen, dass Kunst eine Dummheit ist, notierte Rimbaud einmal. Er war ein Früh-Punk, kein Wunder, dass der Avantgardist Jeremy Reed sich zu ihm hingezogen fühlt. (Ebenfalls von ihm bei Bilger: „The Nice“.) Es waren ganze vier Jahre, in denen Rimbaud an die Magie der Sprache glaubte, diese Zeit von 1871– 1873 bildet den Mittelpunkt des zwischen Studie, Höllenritt und Poesie oszillierenden Buches, über den sich ein eigener Nachthimmel spannt: Baudelaire, Lautréamont, Verlaine, Rilke, Trakl, Apollinaire, Breton, St-John Perse, T.S. Eliot, Neruda, Montale. Pociao hat übersetzt.
Jeremy Reed: Rimbauds Delirium (Delirium, 1991). Aus dem Englischen von pociao. Bilger Verlag, Zürich 2021.180 Seiten, Hardcover, 24 Euro.
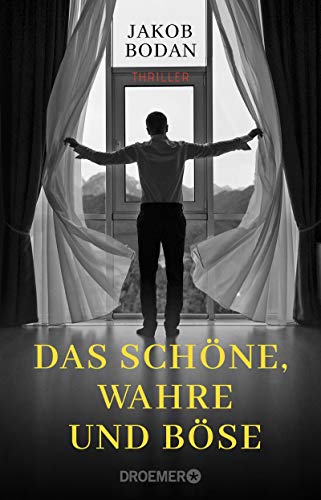
Zähe Angelegenheit
(JF) Presse, Politik und viel, viel Geld. Daraus lässt sich eine hübsche Verschwörungstory mit Knalleffekt und einer aufrechten Reporterin als Identifikationsfigur basteln. Ein schmissiger Titel tut das Übrige. Aber leider ist der als Thriller annoncierte Roman Das Schöne, Wahre und Böse den Formulierungskünsten seines Autors zum Trotz eine ausgesprochen zähe Angelegenheit. Selten wirkten kurze Sätze so lang, schienen pfiffig gemeinte Dialoge kein Ende zu nehmen. Vielleicht sollte sich Jakob Bodan, so das Pseudonym des Verfassers, der so genannten ernsten Literatur zuwenden.
Jakob Bodan: Das Schöne, Wahre und Böse. Thriller. Droemer, München 2021. 368 Seiten, 14,99 Euro.
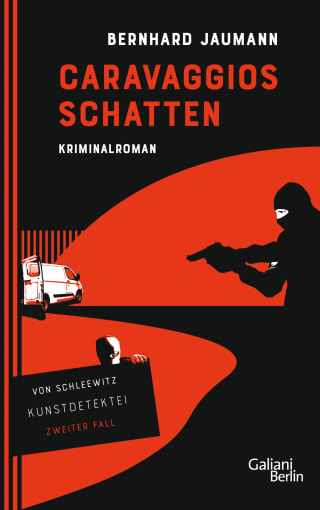
Hintergründig
(JF) „Der ungläubige Thomas“ ist eines der berühmtesten Gemälde Caravaggios, zu sehen in der Gemäldegalerie im Park des Schlosses Sanssouci in Potsdam. Dass es zum Ziel eines Messerangriffs wird, ist glücklicherweise Fiktion. Ausgedacht hat sich diesen Fall von Kunstvandalismus der Schriftsteller Bernd Jaumann für seinen Roman Caravaggios Schatten. Rupert von Schleewitz, Inhaber der gleichnamigen Kunstdetektei und hier zum zweiten Mal im literarischen Einsatz, muss hilflos zusehen, wie ein Galeriebesucher die Leinwand mit einer Klinge attackiert. Sein Schock ist umso größer, als er gemeinsam mit dem Täter gekommen ist. Schließlich handelt es sich um seinen alten Schulfreund Alban, mit dem er während der Internatszeit ein Zimmer geteilt hat. Doch das ist fünfundzwanzig Jahre her. Über ein mögliches Motiv könnte von Schleewitz nur rätseln, aber eigentlich mag er sich mit dem Vorfall nicht so recht befassen. Und Alban verweigert die Aussage.
Ein lukrativer Auftrag sorgt für Ablenkung, auch wenn er mit dem Attentat zusammenhängt. Auf dem Weg zum Restaurator nämlich wird das malträtierte Bild gestohlen, und wer, wenn nicht die Kunstdetektei von Schleewitz, hätte die Expertise, es wiederzubeschaffen. Denn die meisten Kunsträuber sind eigentlich Erpresser, die sich die Herausgabe des Diebesgutes fürstlich bezahlen lassen. „Artnapping“ nennt man das, und es erfordert eine beträchtliche kriminelle Energie. Komplizierte Verhandlungen deuten sich an. Doch die führt der Chef weitgehend alleine, während seine beiden Angestellten mit anderen Dingen befasst sind. Klara Ivanovic kommt einer heiklen Geschäftsidee ihres parkinsonkranken Vater auf die Schliche, und Max Müller widmet sich weiterhin den Hintergründen des Kunstattentats. Dass ihn ausgerechnet eine Episode des Fernsehkrimis „Der Bulle von Tölz“ auf eine Spur führt, die direkt in von Schleewitz‘ Vergangenheit führt, ist eine ironische Pointe dieses hintergründigen Detektivromans.
Bernd Jaumann nämlich ist kein Autor, der sich mit der schlichten Übernahme lang erprobter Genremuster zufriedengäbe. Wer Kriminalromane in der Hoffnung auf rückstandslose Aufklärung liest, muss sich auf eine Enttäuschung gefasst machen, andere dürfen sich auf ein intelligentes literarisches Spiel freuen. Denn nicht immer ist der Erzähler schlauer als die Figuren, und manchmal legt selbst ein Detektiv keinen Wert auf die Wahrheit.
Bernhard Jaumann: Caravaggios Schatten. Galiani Verlag, Berlin 2021. 303 Seiten, 15 Euro.
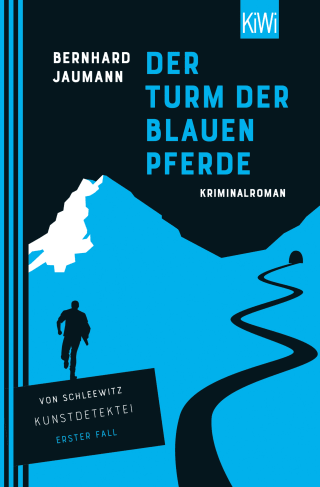
Und noch eine zweite Stimme
Wolfgang Schweiger – seine Texte bei uns hier –, länger Jahre fast ein Nachbar von Bernhard Jaumann, meint dazu:
(WS) Vor wenigen Wochen ließ eine Meldung aus Madrid die Kunstwelt aufhorchen: Auf Betreiben der spanischen Regierung wurde die Versteigerung eines Ölgemäldes aus dem 17. Jahrhundert gestoppt, weil es sich dabei möglicherweise um ein Werk des Frühbarock-Meisters Caravaggio (1571 bis 1610) handelt. Ein Gemälde dieses Künstlers bestimmt auch die Handlung des neuen Kriminalromans von Bernhard Jaumann, der vor zwei Jahren mit „Der Turm der blauen Pferde“ seinen ersten „Kunstkrimi“ vorgelegt hat, und damit den ersten Fall für die Münchner Kunstdetektei von Schleewitz. Jetzt sind die Ermittler wieder aktiv.
Bernhard Jaumann, 1957 in Augsburg geboren und lange Zeit als Gymnasiallehrer in Bad Aibling tätig, schrieb ab 1997 mehrere Krimiserien, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem 2011 mit dem Deutschen Krimipreis für seinen Roman „Die Stunde des Schakals“. Auch sein neuer Roman beweist, dass die Entführung eines Kunstwerks als Thema für einen spannenden Krimi wunderbar funktionieren kann, zumal Jaumann ein überaus versierter Autor ist, der seine Protagonisten mit sicherer Hand durch die komplexe Handlung führt. So dass Krimifreunde und Kunstliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.










